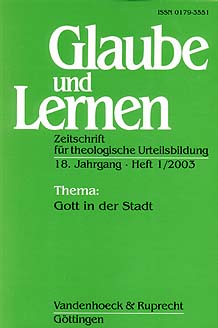|
Glaube und Lernen 1/2003 Theologie interdisziplinär und praktisch Gott in der StadtVandenhoeck & Ruprecht - Verlagswebsite besuchen ISSN 0179-3551 2003 92 Seiten, paperback, 15 x 23 cm 13.90 Euro Bestellen per eMail |
||||
|
Seit den 80er Jahren ist der Bereich sozialer Dienstleistungen von Privatisierungsprozessen erfasst, der in unterschiedlicher Geschwindigkeit wesentliche Teile der öffentlichen Infrastruktur (z.B. Transportwesen, Energieversorgung, Bildung) verändern. Öffentliche Einrichtungen, Non-profit-Organisationen wie die Diakonie und die Caritas und For-profit-Organisationen sind vielfach zu Konkurrenten geworden. Sie finden sich auf einem Quasi-Markt wieder, der sich von einem normalen Warenmarkt dadurch unterscheidet, dass die Nutzer der Dienstleistungen meistens nicht direkt bezahlen und oft gar nicht dazu in der Lage wären. Zudem ist die Nutzung sozialer Dienstleistungen häufig nicht freiwillig, sondern aufgenötigt. Der Quasi-Markt sozialer Dienstleistungen setzt verschiedene Unterstützungssysteme voraus. Es bedarf gesetzlicher Regelungen, um den Quasi-Markt zu ermöglichen (z.B. Pflegeversicherung) und gleichzeitig einer Kontrollmacht, die diesen Markt reguliert. Diese Funktionen verblieben bei der öffentlichen Hand, die damit auf diesem Markt sowohl selbst als Anbieter, gleichzeitig aber auch als Finanzier und als Kontrollmacht (Leistungskontrolle) auftritt. Die öffentliche Administration entwickelt sich zunehmend vom Dienstleistungsproduzenten zum Arrangeur und Kontrolleur der Dienstleistungen, die von anderen erbracht werden. Es handelt sich mithin nicht um eine Privatisierung als Entstaatlichung, sondern um eine zumindest indirekt gesteuerte Privatisierung. Häufig wird hervorgehoben, dies sei ein Prozess administrativer Rationalisierung, der den einzelnen Akteuren mehr Autonomie garantiere. Dies trifft für die Leistungsfähigen zu. Die öffentliche Regulierung nimmt dennoch zu, und zwar als staatliche Regulierung durch Gesetzgebung. Aus dem Klienten wird ein Kunde. Dieser „wird nicht länger als ein soziales Geschöpf verstanden, das die Befriedigung seines oder ihres Bedürfnisses nach Sicherheit, Solidarität und Wohlfahrt sucht, sondern als Individuum, das aktiv sein und ihr eigenes Leben zu gestalten und zu verwalten sucht, um seine Erträge hinsichtlich Erfolg und Leistung zu maximieren".1 Der Diakonie wird in dieser Situation empfohlen, ihre Dienstleistungen zu standardisieren und für bestimmte Nutzergruppen (z.B. zahlungskräftige und hilfsbedürftige) zu differenzieren, aber sich gleichzeitig diakonisch zu profilieren, und zwar: a) auf der Beziehungsebene durch Vermittlung einer Atmosphäre bedingungsloser Zuwendung und Akzeptanz (Nächstenliebe) b) inhaltlich durch Erschießung der Gottesbeziehung als ein Mittel zur Erhöhung der Lebensqualität, Spiritualität als existenzielle Erfüllung. Die Beiträge dieses Heftes stellen diese Veränderungsprozesse im Sektor sozialer Dienstleistungen in den Horizont der Gottesbeziehung („Gott und Stadt") und damit unter das Motto „Suchet der Stadt Bestes", über dessen ursprünglichen Sinn Werner H. Schmidt nachzudenken hilft. Christofer Frey erörtert im Kennwort den Zusammenhang zwischen zivilgesellschaftlichen Entwicklungen, Liebesgebot und Solidarität. Frank Crüsemann expliziert das Verhältnis von sozialem Engagement und Recht im Alten Testament. Ernstpeter Maurer fragt nach den Möglichkeiten der Glaubenskommunikation inmitten des städtischen Pluralismus. Wolfgang Grünberg stellt Beispiele gelungener Stadtkirchenarbeit vor. Der Jurist Görg Haverkate zeigt die Veränderungstrends in der Entwicklung des europäischen Sozialrechts und plädiert für eine stärkere Marktorientierung im Dienstleistungsbereich, da diese die Selbstbestimmung und Lebensqualität im sozialen Sektor fördern kann. Freilich sieht auch er, dass Schwächere der Fürsprache bedürfen, um das ihnen Dienliche auch wählen zu können. Damit kommt die Aufgabe in den Blick, soziale Lebenslagen und damit verbundene Herausforderungen zu erkunden. Dies ist ein Ziel diakonischer Bildungsprozesse, wie sie von Renate Zitt am Beispiel der Bahnhofsmission beschrieben werden. Der Lesehinweis von Georg Lämmlin ist einem Sammelband zur Stadtkirchenarbeit gewidmet, der Hoffnung machen will und kann. InhaltsverzeichnisZu diesem Heft ZUM NACHDENKEN Werner H. Schmidt „Suchet der Stadt Bestes"............................................................. 5 KENNWORT Christofer Frey Gott in der Stadt.......................................................................... THEOLOGISCHE KLÄRUNG Frank Crüsemann Soziales Engagement und soziales Recht im Alten Testament....... Ernstpeter Maurer Glaubenskommunikation unter interkulturellen Bedingungen ......................................... 35 AUFGABEN DER MITTEILUNG Wolfgang Grünberg Was ist Stadtkirchenarbeit?... 46 Görg Haverkate Europäische Verfassung und Sozialstaat....................................... 60 IMPULSE FÜR DIE PRAXIS Renate Zitt Diakonie und Bildung. Beispiel Bahnhofsmission............................................................. LESEHINWEIS Georg Lämmlin Friedemann Green/Gisela Groß/Ralf Meister/Torsten Schweda (Hg.), Um der Hoffnung willen. Praktische Theologie mit Leidenschaft. FS für Wolfgang Grünberg (Kirche in der Stadt 10), Hamburg 2000, 390............................................................. 86 |
|||||