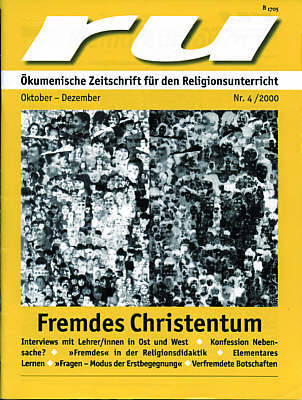|
ru 4/2000 Ökumenische Zeitschrift für den Religionsunterricht Fremdes ChristentumInterviews mit LehrerInnen in Ost und West - Konfession Nebensache? - "Fremdes" in der Religionsdidaktik - Elementares Lernen - "Fragen - Modus der Erstbegegnung" - Verfremdete BotschaftenKösel - Verlagswebsite besuchen ISSN 0341-0005 2000 36 Seiten, geheftet, 21 x 28 cm 7.00 Euro Bestellen per eMail |
||||
|
Zu diesem Heft /Von Norbert Weidinger und Harry Noormann Wird im »christlichen Abendland« falls es dieses je gab - das Christentum zur »Fremdreligion«? Die Shell-Studie 2000 (vgl. ru 30 [2000] S. 119!) scheint dies für Deutschland zu bestätigen. Wie stehen Religionslehrer/innen dieser Frage gegenüber? Kommt sie nicht (doch) verfrüht? Was ist überhaupt darunter zu verstehen? Welche Zeit-Zeichen und Beobachtungen v. a. in Schule und Unterricht deuten auf ein fremd gewordenes bzw. gebliebenes Chrisentum hin? Wie reagieren Praktiker/innen darauf? Welche Art von Didaktik ist gefordert, falls die Antwort ja' lautet? Dieses Themenheft möchte beitragen, das Terrain zu sondieren und erste Wegmarkierungen abzustecken. Bei Lehrerfortbildungen und über das internet haben wir (im Sinne einer Vorstudie) per Fragebogen Religionslehrer/innen gefragt: »Stimmt nach Ihrer Erfahrung der Satz: Das Christentum ist für die meisten heutigen Schüler/innen eine Fremdreligion geworden wie der Islam oder das Judentum'?« Insgesamt 87 Kolleg/innen im Osten (24) und Westen (63) haben geantwortet und auf der Ratingskala Zustimmung (1 = ja) oder Ablehnung (9 = nein) signalisiert. Das Ergebnis weist mit einem Durchschnittswert von 4,9 ein »klares« Unentschieden aus. Wie zu erwarten neigen die RL in den neuen Bundesländern etwas mehr zu einem ja (4,2) als in den alten (5,2), ebenso die in der Stadt unterrichtenden (4,4) eher als die auf dem Land (5,3). Dennoch erstaunt, dass die Ost-West-Wertungen so nahe beieinander liegen. Ferner zeigt sich, dass mit den Dienstjahren (= Dj.) die Zustimmung zu steigen scheint von 4.9 (1 Dj.) auf 3,7 (10 Dj.) und wieder abnimmt 4,2 (25 Dj.), sie nimmt auch zu von der Grundschule (5. 1) zur Sek. 1. (4,6) zur Sek. 11 (4.0) - (also auch mit dem Alter der Schüler? Mit den Jahren des genossenen RU?); ferner: dass die ev. Lehrkräfte die These eher befürworten (4,5) als die kath. (5,3) die Frauen eher (4,8) als die Männer (5,0). Diese ersten empirischen Anhaltspunkte wecken die Neugier für konkrete Erfahrungen und Lösungsversuche, die hinter diesen Zahlen stecken. Die Interviews von Simone Ferme und Dorothee Christ sowie Dirk Ahrens spiegeln Einschätzungen von Kolleg/innen in lokal und regional höchst disparaten schulischen Kontexten. Wahrgenommene »Fremdheit« dem Christentum gegenüber scheint zu oszillieren zwischen feindseliger Abwehrhaltung (wie in Vorpommern), distanzierter Gleichgültigkeit (vergl. den Beitrag von Susanne Drewniok) und konfessionellen Prägun gen, die Bärbel Husmann selbst unter jugendlichen Gymnasiasten beobachtet, die »vordergründig« konfessionsfrei sind. Hinter dem größten gemeinsamen Nenner der Situationsdeutungen - ihrer je unvergleichbaren Besonderheit zeichnen sich dennoch schemenhaft gemeinsame Bemühungen ab, in fachdidaktischen »Situationen nie vorhanden gewesenen Einverständnisses und religiöser Indifferenz« (K.E. Nipkow) den RU noch konsequenter an den Fragehaltungen von Kindern und Jugendlichen auszurichten, die hier als Lernende immer häufiger erstmals ausdrücklich mit dem Christentum in Kontakt kommen (Peter Beer und Matthias Hahn). Dazu gehört einerseits eine größere Kompetenz auf Seiten der RU-Lehrer/innen, die Vielfalt religiösen Zeichengebrauchs in der Alltagskultur empfindsam wahrzunehmen, zu deuten und didaktisch fruchtbar zu machen (Gottfried Siegers). Andererseits gewinnt die unverwechselbare Kenntlichkeit christlicher Überzeugungen und Haltungen an Bedeutung, die in der Lebenswirklichkeit begreifbare Gestalt annehmen soll - nicht zuletzt in der Person der/des Unterrichtenden (Bärbel Husmann). Schließlich: Religion handelt mit und vom Unverfügbaren, das seine Fremdheit nicht verliert. Muss nicht ein evangeliumsgemäßes Christentum, das sich für eine zivilreligiöse Indienstnahme für die Werteordnung und die Moral nicht missbrauchen lässt, aus innerem Antrieb zur Fremdreligion werden, der Welt fremd sein und bleiben (Joh!)? Der RU darf sich nicht instrumentalisieren und damit neutralisieren lassen. »Metanoia«, Umdenken und Umkehr sind gefragt und zu initiieren. Der RU muss sich von theologischer Deutlichkeit her neu positionieren und seine Didaktik überdenken (Dorothea Bähr). »Nicht darum geht es, der Jugend Religion aufzuerlegen, sie in eine Ordnung des Wissbaren und Tubaren einzustellen, sondern darum, in ihr ihre eigene, latente Religion zu erwecken, das ist: die Bereitschaft, der Berührung des Unbedingten standzuhalten. Es gilt nicht der Jugend zu predigen, diese und keine andere sei Gottes Offenbarung, sondern ihr zu zeigen, dass kein Ding unfähig ist, ein Gefäß der Offenbarung zu werden; nicht von ihr zu fordern, dass sie als einzig verpflichtend für ihr Leben anerkenne, was zu irgendeiner Stunde der Vergangenheit geschehen ist, sondern ihr zu bestätigen, dass jeder Mensch seine Stunde hat'...« Martin Buber: Cherut - Rede über Jugend und Religion, Wien/Berlin 1919 InhaltsverzeichnisIn diesem Heft zu lesen»Fremdreligion?« Zu diesem Heft »... wirklich einefremde Religion« Erkundungen unter Kolleg/innen im Raum Hannover Simone Ferme / Dorothee Christ Fremdreligion? Feindbild! Schlaglichter aus Mecklenburg-Vorpommern Dirk Ahrens Waddehaddedudeda? Elementares Lernen: Fremdes in der Religionsdidaktik Dorothea Bähr Konfession Nebensache? Ein Erfahrungsbericht und 5 Thesen zum Religionsunterricht Bärbel Husmann »Sachen, die sonst keiner weiß!« Wer etwas kennt und weiß aus der fremden Welt der Religionen, kann fragen lernen Susanne Drewniok Fragwürdigkeit als Chance Fragen als Modus der Erstbegegnung mit dem Christentum Peter Beer »Kirchensteuer wird nichtfällig« Einladungen zur Erstbegegnung an ostdeutschen Schulen Matthias Hahn Verfremdete Botschaften Mit Kunst und Musik der Glaubenswelt Jugendlicher eine Sprache geben Gottfried Siegers Rubriken ru Handbibliothek ru online |
|||||