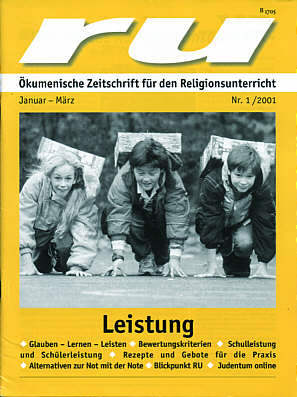|
ru 1/2001 Ökumenische Zeitschrift für den Religionsunterricht LeistungGlauben - Lernen - Leisten - Bewertungskriterien - Schulleistung und Schülerleistung - Rezepte und gebote für die Praxis - Alternativen zur Not mit der Note - Blickpunkt RU - Judentum onlineKösel - Verlagswebsite besuchen ISSN 0341-0005 2001 36 Seiten, geheftet, 21 x 28 cm 7.00 Euro Bestellen per eMail |
||||
|
Zu diesem Heft/ Von Dietlind Fischer Was leistet der Religionsunterricht? Die Frage richtet sich darauf, die Art und Qualität des tatsächlich gehaltenen Unterrichts zu beurteilen, neudeutsch: zu evaluieren. Von der pädagogischen Reichweite und potenziellen Wirksamkeit des tatsächlich gehaltenen Unterrichts ist die Leistung von Schülerinnen und Schülern abhängig. Man müsste also die Unterrichtsleistung und die Schülerleistung in Beziehung setzen können. Das ist schwierig. Oberstufen-Schülerinnen, befragt nach ihren Erfahrungen mit Religionsunterricht, erinnerten sich besonders häufig und positiv an ihren Religionsunterricht in der Grundschule (Fischer 2000 b): »Der Reli-Unterricht ist der einzige Unterricht, der mir noch von der Grundschulzeit in Erinnerung geblieben ist, da er immer sehr anschaulich war. Wir haben in der Schule religiöse Feste gefeiert, wie zum Beispiel das Passahfest oder haben erste Kontakte mit anderen Hochkulturen geknüpft, zum Beispiel Ägypten.« Ob diese Äußerungen den tatsächlich erteilten Religionsunterricht angemessen widerspiegeln, lässt sich nicht rekonstruieren. Seine individuelle Wirksamkeit wird darin deutlich. Religionsunterricht ist nach dem Grundgesetz ordentliches Lehrfach in der Schule; niemand ist zur Teilnahme gezwungen, man kann sich aus Gewissensgründen von diesem Fach abmelden. Die mit dieser Doppelstruktur positiver und negativer Religionsfreiheit gegebene Beteiligungsoffenheit muss Religionslehrerinnen dazu veranlassen, um der fachlichen Attraktivität willen pädagogisch besonders »dicht« bei den Lernenden zu sein, damit sich niemand abmeldet. Ein »ausreichend« oder gar »mangelhaft« als Zeugnisnote würde vermutlich nicht zu mehr Anstrengungsbereitschaft, sondern eher zur individuellen Abmeldung vom Religionsunterricht führen. Es geht ja nicht nur um den Erwerb von Wissen und Kenntnissen über christliche Religion, sondern auch um das Offenhalten von Zugängen zu Glaubensfragen, um Erfahrungen mit gelebter Religion auch in ihren spirituellen und rituellen Formen, und um deren Bedeutung für ethisches Handeln im Umgang der Menschen miteinander (vgl. Fischer 2000 a). In der genannten Befragung drückt eine Schülerin diese Wirkung prägnant aus: Religionsunterricht sorgt sich darum, dass Kinder und Jugendliche so etwas wie »religiöse Kompetenz« (religious literacy) erwerben als eine »erlernbare, komplexe Fähigkeit zum verantwortlichen Umgang mit der eigenen Religiosität in ihren verschiedenen Dimensionen und in ihren lebensgeschichtlichen Wandlungen« (Hemel 1988,674). Ein Dilemma entsteht durch die selbstverständliche Leistungserwartung des Schulfachs Religion auf der einen Seite und die Thematisierung eines ideologiekritischen, theologischen Verständnisses von Leistung im Zusammenhang von Gerechtigkeit und Gnade (vgl. Nipkow 1979). Nach theologischer Dogmatik ist menschliche Würde nicht abhängig von persönlichen Leistungen, Verdiensten oder besonderem Vermögen, sondern von einem »Qualitätsmaß« jenseits menschlicher Machbarkeit. Die bedingungslose Annahme des Menschen durch Gott bedeutet, sich als geschenkt verstehen zu dürfen, sich zu verdanken ohne Verdienst. Die mehrfache Funktion schulischer Leistungsbeurteilung, einerseits spätere Bildungswegsentscheidungen vorzubereiten durch Allokation und Selektion (vgl. Tillmann/Vollstädt 1999), andererseits individuelle Lernprozesse zu stimulieren und zu verstärken, ist widersprüchlich, und der Religionsunterricht steckt »ordentlich« mitten drin. Es ist wichtig, sich als Unterrichts-Praktikerin immer wieder der leitenden Annahmen bei der Leistungsbeurteilung zu vergewissern und zu reflektieren, wie mehr Transparenz, Gerechtigkeit und Differenziertheit möglich werden kann. »Der Unterricht hatte nichts Differenziertes, der junge Mensch hätte diese Dinge nicht begriffen. Er prägte eher das Unbewusste, die Geschichten vom verzeihenden Gott, die Weihnachtsgeschichte, all dies prägte das Verhältnis zum christlichen Glauben. Wenn ich mich an diese vier Jahre erinnere, so einseitig von ihrer Betrachtung der Sache sie auch waren, so machten sie doch Hoffnung und die damals ohnehin heile Welt noch ein bisschen besser.« Als Unterrichts-Theoretikerin ist es wichtig, sich von widersprüchlichen praktischen Erfahrungen mit der Leistungsbeurteilung befragen und zu Konkretionen nötigen zu lassen. Dazu geben die Beiträge in diesem Heft Anstöße und Beispiele. InhaltsverzeichnisIn diesem Heft zu lesenWas leistet Retigionsunterricht? Zu diesem Heft Glauben - Lernen - Leisten Theologisch tastende Annäherungen Christoph Bizer Schulleistung - Leistung der Schule Überlegungen zu einem prekären Verhältnis Wolfgang Schöning Wie hältst du's mit der Leistung? Bewertungskriterien im Religionsunterricht Rainer Oberthür »Mein Freund, der Fehler« Vorschläge zur Selbstbeobachtung und Selbstbewertung von Schüler/-innen Horst Klaus Berg Zeugnis oder Unterrichtsbericht? Berliner Erfahrungen mit einem alternativen Zeugnismodell Andrea Hannewahr Leistungen im Projektunterricht Lothar Kuld, Marianne Späth Zehn Gebote für den Umgang mit Leistung, Leistungskontrolle und Fehlern Horst Klaus Berg Wegweisungen für die Lernerfolgskontrolle Bernhard Jendorff Briefwechsel - Feedback Eine Alternative zu Schulnoten Barbara Koch-Priewe ru - im Blickpunkt: Es geht um die Sache mit Gott Ein Gespräch mit Staatsrat Lange, Hamburg Rubriken ru Handbibliothek ru online ru Magazin |
|||||