|
|
|
Umschlagtext
Hans Küngs Vision des „Weltethos“
„Diese eine Weltgemeinschaft braucht einige verbindende und verbindliche Normen, Werte, Ideale und Ziele.“ So bringt Hans Küng die Programmatik seines Weltethos-Projekts treffend auf den Punkt. Wo Menschen friedlich zusammenleben und verantwortlich agieren wollen, brauchen Sie gemeinsame „Spielregeln“, die nicht durch eine einzelne Weltanschauung vorgegeben werden können, sondern sich aus den Quellen aller Weltreligionen und humanistischen Traditionen speisen müssen: in Kindertagesstätten und Schulen, in Wirtschaftsunternehmen und Banken, in den Medien und der Politik. Die von Hans Küng vor bald dreißig Jahren als „Weltethos“ vorgelegte Idee wurde und wird weltweit diskutiert und ist für alle Bereiche unserer Gesellschaft von großer Bedeutung. Dieser Band enthält u.a. das Schlüsselwerk „Projekt Weltethos“, die Dokumente „Erklärung zum Weltethos“ und „Allgemeine Erklärung der Menschenpfl ichten“ sowie das „Handbuch Weltethos“. Hans Küng ehemaliger Universitätsprofessor, Gründer der Stiftung Weltethos Hans Küng, Dr. theol., geb. 1928, bis zum Entzug der Lehrerlaubnis Professor für Dogmatik und Ökumenische Theologie an der Universität Tübingen, anschließend fakultätsunabhängiger Professor für Ökumenische Theologie und Direktor des Instituts für ökumenische Forschung, Gründer der Stiftung Weltethos, zahlreiche Auszeichnungen und Ehrendoktorwürden. Er ist einer der herausragenden Theologen der Gegenwart. Gegenüber Positionen der katholischen Kirche äußert er sich wiederholt kritisch. Stephan Schlensog, geb.1958, Dr. theol., Generalsekretär der Stiftung Weltethos. Rezension
Der Herder-Verlag in Freiburg/i. Br. gibt z.Zt. Hans Küngs Sämtliche Werke in voluminösen 24 Bänden heraus (vgl. Editionplan). Der Tübinger Theologe Hans Küng hat ein umfangreiches theologisches Werk verfasst, in dem er sich mit zentralen Themen des christlichen Glaubens auseinandersetzt: z.B. Christentum, Gotteslehre, Jesus Christus, Kirche, Rechtfertigung, Eschatologie, Ökumene, bis hin zum Dialog der Religionen, dem Projekt Weltethos oder auch der Frage nach einem menschenwürdigen Sterben (zusammen mit dem Tübinger Rhetoriker Walter Jens). Geboren 1928 in Sursee/Schweiz studierte Küng an der Päpstlichen Universität in Rom Philosophie und Theologie, nahm als Experte am Zweiten Vatikanischen Konzil teil, ist katholischer Priester und Professor emeritus für Ökumenische Theologie an der Universität Tübingen und Präsident der Stiftung Weltethos. 1979 wurde ihm wegen Kirchen- und Katholizismus-kritischer Äußerungen (zur Unfehlbarkeit des Papstes) vom Papst die kirchliche Lehrbefugnis entzogen. - Das Weltethos ist die Formulierung eines Grundbestandes an ethischen Normen und Werten, der sich nach Hans Küng aus religiösen, kulturellen und philosophischen Traditionen der Menschheitsgeschichte herleiten lässt. Das von Küng begründete Projekt Weltethos stellt den Versuch dar, ein gemeinsames Ethos der Weltreligionen aufzustellen, das von allen akzeptiert werden kann. Küngs Grundüberzeugung lautet: Diese eine Welt braucht ein Ethos; diese eine Weltgesellschaft braucht keine Einheitsreligion und Einheitsideologie, wohl aber einige verbindende und verbindliche Normen, Werte, Ideale und Ziele. Dazu gehören die Grundüberzeugungen: kein Zusammenleben auf unserem Globus ohne ein globales Ethos, kein Frieden unter den Nationen ohne Frieden unter den Religionen, kein Frieden unter den Religionen ohne Dialog zwischen den Religionen, kein Dialog zwischen den Religionen und Kulturen ohne Grundlagenforschung, kein globales Ethos ohne Bewusstseinswandel von Religiösen und Nicht-Religiösen. Das Weltethos verpflichtet auf eine Kultur der Gewaltlosigkeit und der Ehrfurcht vor allem Leben, eine Kultur der Solidarität und eine gerechte Wirtschaftsordnung, eine Kultur der Toleranz und ein Leben in Wahrhaftigkeit und auf eine Kultur der Gleichberechtigung und die Partnerschaft von Mann und Frau.
Thomas Bernhard, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
zur Reihe: Hans Küng Sämtliche Werke (20 Artikel) Hans Küng hat ein umfangreiches und vielschichtiges Werk verfasst, in dem er sich mit theologischen Kernthemen (etwa Gotteslehre, Christus, Kirche, Rechtfertigung, Eschatologie, Ökumene), dem Dialog der Religionen, dem Projekt Weltethos oder der Frage nach einem menschenwürdigen Sterben auseinandersetzt. In seinen z.T. umfangreichen Büchern wird sein innovatives theologisches Denken deutlich, das seiner Zeit oft voraus war. Die Reihe Hans Küng – Sämtliche Werke versammelt das Werk des herausragenden Theologen. Die im Wesentlichen chronologische Anordnung der Texte zeigt zugleich die Entwicklung der verschiedenen Themen, mit denen sich Hans Küng beschäftigt hat und beschäftigt. Die einzelnen Bände enthalten auch thematisch passende Texte, die in späterer Zeit entstanden sind, sodass die einzelnen Bände zugleich in sich stehen und das Denken Küngs zu einzelnen Themen verdeutlichen. Jedem Band ist eine Einführung vorangestellt, die die aktuelle und bleibende Bedeutung des Bandes verdeutlicht. Mitherausgeber der Reihe ist Dr. Stephan Schlensog, Generalsekretär der Stiftung Weltethos und Geschäftsführer des Weltethos-Instituts (Universität Tübingen). Editionsplan Band 1: Rechtfertigung Band 2: Konzil und Ökumene Band 3: Kirche Band 4: Kirchenlehrer, Frauen, Sakramente Band 5: Unfehlbarkeit Band 6: Kirchenreform Band 7: Philosophie – Theologie Band 8: Christ sein Band 9: Existiert Gott? Band 10: Ewiges Leben Band 11: Glaubensbekenntnis und Naturwissenschaft Band 12: Christentum und Weltreligionen Band 13: Spurensuche Band 14: Theologie im Aufbruch Band 15: Judentum Band 16: Christentum Band 17: Islam Band 18: Literatur, Kunst, Musik Band 19: Weltethos Band 20: Weltpolitik und Weltwirtschaft Band 21: Erinnerungen I Band 22: Erinnerungen II Band 23: Erinnerungen III Band 24: Varia Inhaltsverzeichnis
Einleitung: Weltethos – eine zukunftsweisende Vision 19
1. Ein Blick fürs Ganze 19 2. Wegmarken 20 3. Weltethos-Reden 22 TEIL A. Vorarbeiten für das Projekt Weltethos I. Spirituelle Grundlage: Grundvertrauen und Grundethos 27 Einführung 27 Das Original 27 Vom Grundvertrauen zum Weltethos (biographischer Kontext) 27 Was mir sicher schien 27 Woran ich zweifelte 27 Ich kann Ja oder Nein sagen 28 Wie einen Stand gewinnen? 30 Wie das Kind ein Grundvertrauen gewinnen kann 33 Wie sich Grundvertrauen und religiöser Glaube verhalten 35 Grundvertrauen als Basis des Ethos 36 Humanistisches Ethos und Ethos der Religionen 38 Die radikale Fraglichkeit der Wirklichkeit bleibt 38 II. UNESCO in Paris: 1. Kolloquium mit Religionsvertretern (1989) 41 Einführung 41 Das Original 41 Biographischer Kontext 41 Kein Weltfriede ohne Religionsfriede. Ein ökumenischer Weg zwischen Wahrheitsfanatismus und Wahrheitsvergessenheit 42 1. Religionen – zu Krieg oder Frieden? 42 2. Die Wahrheitsfrage: Drei Strategien – keine Lösung 46 3. Voraussetzung einer ökumenischen Strategie: Selbstkritik 49 4. Spezifische Wahrheitskriterien für jede Religion 51 5. Die Suche nach ökumenischen Wahrheitskriterien 52 6. Das Humanum als ökumenisches Grundkriterium 54 7. Glaubensbewahrung und Friedensbemühung: keine Gegensätze 56 8. Die Religionen in einer postmodernen Konstellation 58 9. Ökumenische Imperative 60 III. World Economic Forum (WEF) in Davos: Eine Friedensvision für den Nahen Osten (1991) 64 Einführung 64 Das Original 64 Biographischer Kontext 64 Eine Friedensvision für den Nahen Osten. Verantwortung von Juden, Christen und Muslimen 65 1. Eine kollektive Gewissenserforschung 65 2. Der Friedensbeitrag der Religionen 68 3. Eine Friedensvision für den Nahen Osten 71 TEIL B. Hauptwerk: „Projekt Weltethos“ (1990) Einführung 79 Das Original und seine Übersetzungen 79 Biographischer Kontext 80 Einleitung 81 A. Kein Überleben ohne ein Weltethos. Warum wir ein globales Ethos brauchen 87 I. Von der Moderne zur Postmoderne 87 1. Der Beginn eines Paradigmenwechsels 87 a. Die Wende: 1918 88 b. Katastrophale Fehlentwicklungen 90 2. Parolen ohne Zukunft 92 a. Staatssozialismus 92 b. Neokapitalismus 93 c. „Japanismus“ 96 3. Das Ende der modernen Großideologien 98 a. Kritik an den westlichen Errungenschaften 98 b. Entzauberung der modernen Fortschrittsideologien 98 c. Jenseits von Kommunismus und Kapitalismus 100 4. Grenzerfahrungen und Innovationsdurchbrüche 101 a. Die Notwendigkeit einer Krisenprophylaxe 101 b. Grenzerfahrungen des Machbaren 102 c. Die postindustrielle Gesellschaft 103 d. Der postmoderne Durchbruch 105 5. Die heraufkommende Weltkonstellation der Postmoderne 107 a. Dimensionen der postmodernen Gesamtkonstellation 107 b. Nicht Wertezerfall, sondern Wertewandel 108 c. Ganzheitliche Sicht 108 d. Nicht Gegenmoderne, nicht Ultramoderne, sondern „Aufhebung“ der Moderne 109 II. Wozu Ethik? 113 1. Jenseits von Gut und Böse? 114 a. Warum nicht das Böse tun? 114 b. Warum das Gute tun? 115 2. Keine Demokratie ohne Grundkonsens 116 a. Das Dilemma der Demokratie 116 b. Ein Minimum an gemeinsamen Werten, Normen, Haltungen 117 c. Frei gewählte Bindungen 118 3. Parole der Zukunft: Planetarische Verantwortung 118 a. Statt Erfolgs- oder Gesinnungsethik Verantwortungsethik 118 b. Verantwortung für Mitwelt, Umwelt und Nachwelt 120 c. Ziel und Kriterium: der Mensch 120 d. Ethik als öffentliches Anliegen 122 e. Keine Weltordnung ohne Weltethos 123 III. Eine Koalition der Glaubenden und Nichtglaubenden 124 1. Warum nicht Moral ohne Religion? 125 a. Religionen: ambivalente Erscheinungen 125 b. Können Menschen nicht auch ohne Religion moralisch leben? 125 c. Entscheidungsfreiheit für oder gegen Religion 126 2. Gemeinsame Verantwortung in gegenseitigem Respekt 127 a. Notwendigkeit einer Koalition 127 b. Realisierbarkeit einer Koalition 128 IV. Ethik im Spannungsfeld von Autonomie und Religion 129 1. Die Schwierigkeiten der Vernunft mit der Ethik 129 a. Dialektik der Aufklärung 129 b. Woher die Verbindlichkeit? 130 2. Die Widerständigkeit der Religion 133 a. Ein nachmetaphysisches Zeitalter? 133 b. Das Ende der Religion? 135 c. Religion – nur Projektion? 137 3. Die Schwierigkeiten der Religion mit der Ethik 138 a. Fixe moralische Lösungen aus dem Himmel? 138 b. Differenzierte Lösungen auf Erden 139 c. Wissenschaftliche Methoden 139 d. Vorzugs- und Sicherheitsregeln 140 4. Die Religionen – mögliches Fundament des Ethos 141 a. Kann menschlich Bedingtes unbedingt verpflichten? 141 b. Nur Unbedingtes kann unbedingt verpflichten 143 c. Grundfunktionen der Religion 144 V. Weltreligionen und Weltethos 146 1. Ethische Perspektiven der Weltreligionen 147 a. Das Wohl des Menschen 147 b. Maximen elementarer Menschlichkeit 148 c. Vernünftiger Weg der Mitte 149 d. Goldene Regel 150 e. Sittliche Motivationen 150 f. Sinnhorizont und Zielbestimmung 151 2. Das besondere Engagement der Weltreligionen 151 a. Bewertungs- und Unterscheidungskriterien 151 b. Globale Laster und Tugenden? 153 c. Eine erste gemeinsame Erklärung 154 VI. Christliche Konkretionen 155 1. Ein exemplarischer christlicher Beitrag 156 a. Kirchliche Selbstkritik 156 b. Ein neuer Grundkonsens bezüglich integrierender humaner Überzeugungen 157 2. Postmoderne Forderungen 158 a. Nicht nur Freiheit, sondern zugleich Gerechtigkeit 158 b. Nicht nur Gleichheit, sondern zugleich Pluralität 158 c. Nicht nur Brüderlichkeit, sondern Geschwisterlichkeit 158 d. Nicht nur Koexistenz, sondern Frieden 159 e. Nicht nur Produktivität, sondern Solidarität mit der Umwelt 159 f. Nicht nur Toleranz, sondern Ökumenismus 160 B. Kein Weltfriede ohne Religionsfriede. Ein ökumenischer Weg zwischen Wahrheitsfanatismus und Wahrheitsvergessenheit 161 I. Das Doppelgesicht der Religionen 161 1. Religionen zum Krieg 161 a. Der Fall Libanon 161 b. Negative Folgen 162 2. Religionen zum Frieden 163 a. Deutschland, Frankreich, Polen als Gegenbeispiele 163 b. Kein Weltfriede ohne Religionsfriede 164 II. Die Wahrheitsfrage 165 1. Die Aufgabe 165 a. Ungleichzeitigkeiten des Bewusstseins 165 b. Zwischen Wahrheitsfanatismus und Wahrheitsvergessenheit 166 2. Drei Strategien – keine Lösung 166 a. Die Festungsstrategie 166 b. Die Verharmlosungsstrategie 167 c. Die Umarmungsstrategie 168 3. Voraussetzung einer ökumenischen Strategie: Selbstkritik 169 a. Nicht alles ist gleich gut und wahr 169 b. Der kritische Spiegel der Weltreligionen 170 c. Im Namen der Religion alles erlaubt? 171 III. Die Suche nach ökumenischen Wahrheitskriterien 171 1. Das Maßnehmen am Ursprung 172 a. Maßgebliche Schriften oder Gestalten 172 b. Notwendigkeit und Beschränktheit eigener spezifischer Wahrheitskriterien 172 2. Eine vierte, ökumenische Strategie 173 a. Allgemein-ethische Kriterien 173 b. Späte Realisierung der Menschenrechte im Christentum 173 c. Religiöse Begründung humaner Werte 174 d. Fortschritt in Richtung Humanität 175 IV. Das Humanum als ökumenisches Grundkriterium 176 1. Menschenwürde als Basis 176 a. Ein erstes Religionskolloquium an der UNESCO 176 b. Das wahrhaft Menschliche als universales Kriterium 177 2. Zum Verhältnis von Religion und Menschlichkeit 177 a. Religionen zwischen Menschlichkeit und Unmenschlichkeit 177 b. Religion – Menschlichkeit: ein dialektisches Wechselverhältnis 178 c. Ein möglicher Konsens 179 V. Dialogfähigkeit und Standfestigkeit – keine Gegensätze 180 1. Was heißt „Standfestigkeit“? 181 a. Eine vernachlässigte Tugend 181 b. Konstanz und Widerstand 181 2. Hinführung zum Dialog 182 a. Blockiert ein Glaubensstandpunkt den Dialog? 182 b. Ein kritisch ökumenischer Standpunkt 183 c. Wahrheit in Freiheit 183 3. Interreligiöse Kriteriologie 184 a. Drei verschiedenartige Kriterien 184 b. Zum spezifisch christlichen Kriterium 185 c. Außen- und Innenperspektive 186 4. Wohin führt Dialogbereitschaft ohne Standfestigkeit? 187 a. Konsequenzen eines freischwebenden Dialogs 187 b. Und in praxi? 188 5. Wohin führt ein Dialog auf der Basis von Standfestigkeit? 188 a. Konsequenzen eines glaubensmäßig verankerten Dialogs 188 b. Und in praxi? 189 6. Dialogfähigkeit ist Friedensfähigkeit 190 a. Auf dem Weg 190 b. Ein epochales Unterfangen 190 C. Kein Religionsfriede ohne Religionsdialog. Prolegomena zu einer Analyse der religiösen Situation der Zeit 192 I. Kein Religionsdialog ohne Grundlagenforschung 192 1. Ein christlicher Theologe über andere Religionen? 192 a. Sachlichkeit und Sympathie 192 b. Ein ökumenisches Forschungsprojekt zur religiösen Situation der Zeit 193 2. Dem Risiko der Synthese nicht ausweichen 194 a. Das Ganze zu Gesicht bekommen 194 b. Geschichtliche Versuche 195 II. Wie Geschichte nicht mehr geschrieben werden kann 195 1. Zu G.W. F. Hegels Geschichtsphilosophie 195 a. Eine Philosophie der Welt- und Religionsgeschichte 195 b. Eine logisch-notwendige Entwicklung? 197 2. Zu Oswald Spenglers Kulturmorphologie 198 a. Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte 198 b. Untergang also des Abendlandes? 199 3. Zu Arnold Toynbees Kulturkreistheorie 200 a. Spirituelle Evolution in Zyklen 200 b. Auf eine Einheitsreligion hin? 201 III. Anwendung der Paradigmentheorie auf die religiösen Systeme 203 1. Was will die Paradigmentheorie? 203 a. Multidisziplinäres Studium der Religion 203 b. Historisch-systematische Methode 206 c. Ein dreifaches Ziel 208 2. Dieselbe Religion in verschiedenen Paradigmen 208 a. Epochale Umbrüche 208 b. Das Andauern konkurrierender Paradigmen 209 3. Die drei großen religiösen Stromsysteme heute 210 a. Konzentration auf die heutigen Weltreligionen 210 b. Die prophetischen, mystischen, weisheitlichen Religionen 211 c. Ähnliche Grundfragen und Heilswege 212 IV. Eine ökumenische Theologie für den Frieden 212 1. Verständigung und Zusammenarbeit 213 a. Keine Einheitsreligion 213 b. Eine kreativ-konkrete Friedenstheologie 213 c. Der ökumenische Horizont 214 2. Ausblick 215 a. Das Programm 215 b. Eine differenzierte globale Übersicht 216 V. Imperative für den interreligiösen Dialog in der Postmoderne 216 1. Interreligiöser Dialog mit allen Gruppen 217 a. Politiker, Geschäftsleute, Wissenschaftler 217 b. Kirchen, Theologie, Religionsunterricht 218 c. Die verschiedenen Religionen 218 2. Interreligiöser Dialog auf allen Ebenen 219 a. Inoffizielle und offizielle Dialoge 219 b. Wissenschaftlicher und spiritueller Dialog 219 c. Der alltägliche Dialog 219 TEIL C. Parlament der Weltreligionen: „Erklärung zum Weltethos“ (1993) „Erklärung zum Weltethos“ 223 Einführung 223 Das Original und seine Übersetzungen 223 Biographischer Kontext 224 Erklärung zum Weltethos des Parlaments der Weltreligionen (Chicago, 4.9.1993) 228 Einführung 229 Die Prinzipien eines Weltethos 231 I. Keine neue Weltordnung ohne ein Weltethos 232 II. Grundforderung: Jeder Mensch muss menschlich behandelt werden 234 III. Vier unverrückbare Weisungen 236 1. Verpflichtung auf eine Kultur der Gewaltlosigkeit und der Ehrfurcht vor allem Leben 236 2. Verpflichtung auf eine Kultur der Solidarität und eine gerechte Wirtschaftsordnung 237 3. Verpflichtung auf eine Kultur der Toleranz und ein Leben in Wahrhaftigkeit 239 4. Verpflichtung auf eine Kultur der Gleichberechtigung und die Partnerschaft von Mann und Frau 241 IV. Wandel des Bewusstseins 242 Geschichte, Sinn und Methode der Erklärung zu einem Weltethos 246 1. Die Vorgeschichte 247 2. Die Vorbereitungen für den Text 250 3. Was in einer Weltethos-Erklärung zu vermeiden war 253 4. Was eine Weltethos-Erklärung enthalten sollte 256 5. Im Namen Gottes? Der Einspruch der Buddhisten 258 6. Umstrittene Fragen 261 7. Ein Zeichen der Hoffnung 266 TEIL D. InterAction Council: „Allgemeine Erklärung der Menschenpflichten“ (1999) Einführung 271 Das Original und seine Übersetzungen 271 Biographischer Kontext 272 Einleitende Bemerkungen 275 Allgemeine Erklärung der Menschenpflichten 276 Präambel 276 Fundamentale Prinzipien für Humanität 277 Gewaltlosigkeit und Ehrfurcht vor dem Leben 278 Gerechtigkeit und Solidarität 278 Wahrhaftigkeit und Toleranz 279 Gegenseitige Achtung und Partnerschaft 280 Schluss 280 Es ist an der Zeit, von Menschenpflichten zu sprechen 282 Von den Rechten zu den Pflichten 284 Keine Angst vor dem Ethos! Warum man neben Rechten auch von Pflichten reden muss 287 I. Die Globalisierung erfordert ein globales Ethos 287 II. Menschenpflichten stärken Menschenrechte 290 III. Die „Pflicht“, aber auch das „Recht“ kann missbraucht werden 295 IV. Nicht alle Pflichten folgen aus Rechten 298 Zwei Dokumente, eine Konzeption. Die allgemeine Erklärung der Menschenpflichten des InterAction Council und Die Erklärung zum Weltethos des Parlamentes der Weltreligionen: Ein Vergleich beider Dokumente 302 TEIL E. Vereinte Nationen: „Brücken in die Zukunft“ (2001) Einführung 309 Das Original und seine Übersetzung 309 Biographischer Kontext 309 Weltethos an der UNO 309 Ein Schreckenstag mit weitreichenden Folgen 311 Vereinte Nationen: „Brücken in die Zukunft“ (Auszüge) 312 Gemeinsame Werte 312 Die Entwicklung des Ethos 318 Zivilgesellschaft und Weltethos 320 Versöhnung und Weltethos 322 TEIL F. Handbuch Weltethos (mit Günther Gebhardt und Stephan Schlensog; 2012) Einführung 333 Das Original und seine Übersetzungen 333 Biographischer Kontext 333 I. Was ist Weltethos? 334 1. Weltethos als Chance 334 (1) Ein globales Zeitalter erfordert ein globales Ethos 334 (2) Weltethos zur Krisenvermeidung 335 (3) Demokratische und ethische Werte 336 (4) Menschenpflichten stärken Menschenrechte 337 (5) Bei aller Vielfalt Gemeinsamkeit 338 2. Missverständnisse geklärt 340 (1) Das Projekt Weltethos ist kein explizit religiöses, sondern ein allgemein ethisches Projekt 340 (2) Das Weltethos beschränkt sich nicht auf Individualethik, sondern gilt jederzeit für alle Menschen und Institutionen 340 (3) Das Projekt Weltethos zielt nicht auf eine Einheit der Religionen, sondern auf Frieden zwischen den Religionen 340 (4) Frieden zwischen den Religionen heißt, die Differenzen zwischen ihnen nicht ignorieren, aber übersteigen 340 (5) Obwohl Religionen oft in Konkurrenz zueinander stehen, ist ein gemeinsames Engagement zur Friedensstiftung möglich 341 (6) Weltethos meint keine neue Weltideologie, wohl aber eine realistische Vision 341 (7) Das Weltethos will die Ethik der einzelnen Religionen nicht ersetzen, sondern unterstützen 341 (8) Das Weltethos reduziert die Religionen nicht auf einen ethischen Minimalismus, sondern weist auf einen Grundstock von elementaren humanen Lebensregeln hin 342 (9) Weltethos ist nicht ein westliches Programm, das dem Rest der Welt auferlegt werden soll, sondern es speist sich aus allen großen Weltkulturen 342 (10) Das Weltethos entscheidet nicht die zwischen und in den Religionen notorisch umstrittenen ethischen Fragen 342 3. Wesentliche Dimensionen 343 (1) Ethos meint nicht eine Sittenlehre, sondern sittliches Bewusstsein, Überzeugung, Haltung 343 (2) Ethische Werte, Normen, Grundhaltungen sind kulturspezifisch und zeitbedingt, und doch gibt es universelle ethische Konstanten 343 (3) Nur bezüglich der elementaren Moral ist ein globaler Konsens möglich und notwendig 344 (4) Konkrete Normenkonflikte erfordern eine Güterabwägung 344 (5) Ethische Regeln lassen sich von der Vernunft ohne Rückgriff auf eine transzendente Instanz entwickeln und leben 345 (6) Eine rational abstrakte Argumentation kann allerdings Menschen verschiedener Kulturen und Milieus nur schwer überzeugen 346 (7) Eine ethische Koalition von religiösen und nichtreligiösen Menschen und Gruppierungen ist eine gesellschafts- und weltpolitische Notwendigkeit 346 (8) Religiöse Traditionen sind nicht zu ignorieren, sondern kritisch zu reflektieren 347 II. Wie wird Weltethos begründet? 348 1. Pragmatische Begründung: Gelingt Zusammenleben ohne ethische Maßstäbe? 348 (1) Jedes Spiel – vom Schachspiel bis zum Fußball – bedarf der Regeln 349 (2) Fairplay, ein regelgerechtes Spiel, setzt die Beachtung ethischer Normen voraus 349 (3) Der globale Sport braucht ein globales Ethos 350 (4) Die vier Imperative der Menschlichkeit finden auch im Sport ihre Anwendung 351 2. Philosophische Begründung: Inwiefern spricht die Vernunft für ein Weltethos? 352 (1) Voraussetzungen für das Projekt Weltethos in der Philosophie des 20. Jahrhunderts 353 (2) Wie erreicht man Übereinstimmung? 354 (3) Pragmatische Anerkennung 355 3. Kulturanthropologische Begründung: Seit wann gibt es ein Weltethos? 356 (1) Der Mensch ist aus dem Tierreich hervorgegangen, hat darin aber eine Sonderstellung 357 (2) Der Mensch ist von seiner Evolution her immer Geistwesen und Triebwesen 357 (3) Der Mensch musste lernen, sich menschlich zu benehmen 358 (4) Schon die Ureinwohner verfügten über ein elementares Ethos, das ihnen ein Leben und Überleben ermöglichen half und das bis heute grundlegend für ein menschliches Miteinander ist: ein Ur-Ethos 359 4. Politische Begründung: Was ist Wertebasis für die moderne Gesellschaft? 360 (1) In der modernen Gesellschaft können christliche Werte sinnvoll und effizient nur im Kontext allgemeiner menschlicher Werte vertreten werden 361 (2) Andererseits bedürfen moderne demokratische Grundwerte zur Realisierung einer ethischen Basis 361 (3) Die moderne Gesellschaft kann nur durch ein verbindendes und verbindliches Weltethos zusammengehalten werden 361 (4) Der notwendige neue Gesellschaftskonsens ist nicht möglich ohne den politischen Willen und ethischen Impuls der Verantwortlichen 362 5. Juristische Begründung: Inwiefern setzt Weltrecht ein Weltethos voraus? 363 (1) Das Recht hat ohne Sittlichkeit keinen Bestand 363 (2) Das Weltethos will keine juristische oder ethische Kasuistik bieten, wohl aber Grundsätze und Leitlinien für die Kasuistik 364 (3) Die allgemeinen Rechtsgrundsätze können gestützt werden durch weltethische Prinzipien 365 (4) Weltethische Prinzipien können eine Unterstützung, ja sogar eine Quelle für allgemeine Grundsätze des internationalen Rechtes sein 366 6. Physiologisch-psychologische Begründung: Ist der Mensch frei zu ethischem Handeln? 368 (1) Ohne Gehirn gibt es keinen Geist und ohne die Aktivität bestimmter Hirnzentren keine geistige Leistung 368 (2) Eine neurowissenschaftliche Verharmlosung von Verantwortung und Schuld ist nicht zu rechtfertigen 369 (3) Die Hirnforschung bietet zur Zeit keine empirisch nachprüfbare Theorie über den Zusammenhang von Geist und Gehirn 369 (4) Die Hirnforschung kann die Frage nach freiem oder unfreiem Willen nicht entscheiden 370 (5) Die Freiheit des Willens lässt sich erfahren 371 (6) Die Notwendigkeit eines Wissenschaftlerethos 373 7. Religionswissenschaftliche Begründung: Stimmen die Religionen im Ethos überein? 374 (1) Weltfrieden: das neue Paradigma internationaler Beziehungen 376 (2) Weltreligionen: Friedenspotential statt Streitpotential nutzen 377 (3) Weltethos: trotz großer „dogmatischer“ Unterschiede gemeinsame ethische Standards beachten 380 (4) Das Plus der Religion 382 III. Was bedeutet Weltethos praktisch? 382 1. Politik und Weltethos 382 (1) Keine rücksichtslose Realpolitik 384 (2) Aber auch keine moralisierende Gesinnungsethik 384 (3) Ein Mittelweg der verantworteten Vernunft 385 (4) Statt Thetik oder Taktik eine verantwortete Gewissensentscheidung 386 (5) Keine globale Politik ohne globales Ethos 386 2. Wirtschaft und Weltethos 388 (1) Welches wirtschaftspolitische Konzept? Marktwirtschaft sozial 389 (2) Wege aus der Weltwirtschaftskrise? Drei Komplexe des Versagens 389 (3) Verantwortungsvolles Wirtschaften: ohne institutionalisierte Gier und Lüge 390 (4) Globale Marktwirtschaft erfordert ein globales Ethos der Humanität 390 (5) Keine unökonomische Gesinnungsethik 391 (6) Auch keine gesinnungslose Erfolgsethik 391 (7) Für eine ethisch fundierte Unternehmenskultur 392 (8) Ein Manifest für ein globales Wirtschaftsethos 394 TEIL G. Mein Weltethos-Vermächtnis (2013) Einführung 399 Das Original 399 Biographischer Kontext 399 Mein Weltethos-Vermächtnis 400 Dankeswort 414 Weitere Titel aus der Reihe Hans Küng - Sämtliche Werke |
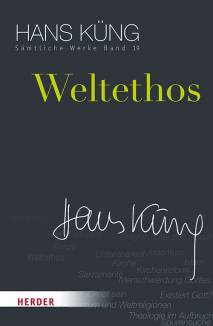
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen