|
|
|
Umschlagtext
Das Christentum und die nicht-christlichen Religionen
Interreligiöser Dialog hat heute Charakter eines weltpolitisch vordringlichen Desiderats erhalten; er kann helfen, unsere Erde friedlicher und versöhnter zu machen. Küng hat schon früh seine Aufgabe darin gesehen, Einsichten in die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Religionen zu gewinnen. Seine Texte zu Hinduismus, Buddhismus, Islam und Chinesischer Religion geben einen Überblick über Themen und Inhalte dieser Weltreligionen. Sie gipfeln in dem Programmwort: »Kein Weltfrieden ohne Religionsfrieden!«. Hans Küng, Dr. theol., geb. 1928, bis zum Entzug der Lehrerlaubnis Professor für Dogmatik und Ökumenische Theologie an der Universität Tübingen, anschließend fakultätsunabhängiger Professor für Ökumenische Theologie und Direktor des Instituts für ökumenische Forschung, Gründer der Stiftung Weltethos, zahlreiche Auszeichnungen und Ehrendoktorwürden. Er ist einer der herausragenden Theologen der Gegenwart. Gegenüber Positionen der katholischen Kirche äußert er sich wiederholt kritisch. Herausgeber/in: Stephan Schlensog, geb.1958, Dr. theol., Generalsekretär der Stiftung Weltethos. Rezension
Im hier anzuzeigenden Band 12 der Sämtlichen Werke Hans Küngs geht es um das Christentum und die Weltreligionen; ein zentrales Thema für den Gründer der Stiftung Weltethos, der immer am interreligiösen Dialog interessiert gewesen ist mit dem Motto "Kein Weltfrieden ohne Religionsfrieden!" Der Band enthält als Hauptwerk dazu als Teil C "Christentum und Weltreligionen. Hinführung zum Dialogmit Islam, Hinduismus, Buddhismus" von 1984. Hinzu treten kleinere Texte, u.a. zur Chinesischen Religion (Teil D), vgl. Inhaltsverzeichnis. - Der Herder-Verlag in Freiburg/i. Br. gibt z.Zt. Hans Küngs Sämtliche Werke in voluminösen 24 Bänden heraus (vgl. Editionplan). Der Tübinger Theologe Hans Küng hat ein umfangreiches theologisches Werk verfasst, in dem er sich mit zentralen Themen des christlichen Glaubens auseinandersetzt: z.B. Christentum, Gotteslehre, Jesus Christus, Kirche, Rechtfertigung, Eschatologie, Ökumene, bis hin zum Dialog der Religionen, dem Projekt Weltethos oder auch der Frage nach einem menschenwürdigen Sterben (zusammen mit dem Tübinger Rhetoriker Walter Jens). Geboren 1928 in Sursee/Schweiz studierte Küng an der Päpstlichen Universität in Rom Philosophie und Theologie, nahm als Experte am Zweiten Vatikanischen Konzil teil, ist katholischer Priester und Professor emeritus für Ökumenische Theologie an der Universität Tübingen und Präsident der Stiftung Weltethos. 1979 wurde ihm wegen Kirchen- und Katholizismus-kritischer Äußerungen (zur Unfehlbarkeit des Papstes) vom Papst die kirchliche Lehrbefugnis entzogen.
Thomas Bernhard, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Hans Küng Sämtliche Werke Hans Küng hat ein umfangreiches und vielschichtiges Werk verfasst, in dem er sich mit theologischen Kernthemen (etwa Gotteslehre, Christus, Kirche, Rechtfertigung, Eschatologie, Ökumene), dem Dialog der Religionen, dem Projekt Weltethos oder der Frage nach einem menschenwürdigen Sterben auseinandersetzt. In seinen z.T. umfangreichen Büchern wird sein innovatives theologisches Denken deutlich, das seiner Zeit oft voraus war. Die Reihe Hans Küng – Sämtliche Werke versammelt das Werk des herausragenden Theologen. Die im Wesentlichen chronologische Anordnung der Texte zeigt zugleich die Entwicklung der verschiedenen Themen, mit denen sich Hans Küng beschäftigt hat und beschäftigt. Die einzelnen Bände enthalten auch thematisch passende Texte, die in späterer Zeit entstanden sind, sodass die einzelnen Bände zugleich in sich stehen und das Denken Küngs zu einzelnen Themen verdeutlichen. Jedem Band ist eine Einführung vorangestellt, die die aktuelle und bleibende Bedeutung des Bandes verdeutlicht. Mitherausgeber der Reihe ist Dr. Stephan Schlensog, Generalsekretär der Stiftung Weltethos und Geschäftsführer des Weltethos-Instituts (Universität Tübingen). Editionsplan Band 1: Rechtfertigung Band 2: Konzil und Ökumene Band 3: Kirche Band 4: Kirchenlehrer, Frauen, Sakramente Band 5: Unfehlbarkeit Band 6: Kirchenreform Band 7: Philosophie – Theologie Band 8: Christ sein Band 9: Existiert Gott? Band 10: Ewiges Leben Band 11: Glaubensbekenntnis und Naturwissenschaft Band 12: Christentum und Weltreligionen Band 13: Spurensuche Band 14: Theologie im Aufbruch Band 15: Judentum Band 16: Christentum Band 17: Islam Band 18: Literatur, Kunst, Musik Band 19: Weltethos Band 20: Weltpolitik und Weltwirtschaft Band 21: Erinnerungen I Band 22: Erinnerungen II Band 23: Erinnerungen III Band 24: Varia Inhaltsverzeichnis
Einleitung: Meilensteine des interreligiösen Dialogs 17
TEIL A. „Christenheit als Minderheit“ (1965) Christenheit als Minderheit. Die Kirche unter den Weltreligionen 23 Einführung 23 Das Original und seine Übersetzungen 23 Biographischer Kontext 23 Außerhalb kein Heil? 25 Fragwürdige Ekklesiozentrik 30 Gottes umfassende Gnade 35 1. Altes Testament 36 2. Die Verkündigung Jesu 38 3. Die Apostolische Verkündigung 39 Die Weltreligionen vor der Kirche 42 Die Kirche für die Weltreligionen 51 TEIL B. „Eine Ökumene der Weltreligionen?“ (1980/81) „Eine Ökumene der Weltreligionen?“ 61 Einführung 61 Biographischer Kontext 61 „Eine Ökumene der Weltreligionen?“ 62 I. Eine persönliche Perspektive 63 II. Keine theologischen Scheinlösungen 69 III. Was die Religionen zu bieten haben 71 IV. Buddhismus und Gottesfrage 73 V. Das große Zeugnis für den einen Gott 77 VI. Auf dem Weg zu immer größerer Wahrheit 84 TEIL C. Hauptwerk: „Christentum und Weltreligionen. Hinführung zum Dialog mit Islam, Hinduismus, Buddhismus“ (zusammen mit Josef van Ess, Heinrich von Stietencron, Heinz Bechert; 1984) sowie zwei Beiträge zum christlich-buddhistischen Dialog Christentum und Weltreligionen 89 Einführung 89 Das Original und seine Übersetzungen 89 Biographischer Kontext 90 Hans Küng: Zum Dialog 93 Auf dem Weg zu einem globalen ökumenischen Bewusstsein 93 Was ist Religion? 95 Jenseits von Absolutismus und Relativismus 97 Zur Aussprache indischer und arabischer Wörter 100 A. Islam und Christentum 102 Zeittafel 102 I. Muhammad und der Koran: Prophetie und Offenbarung 103 1. Josef van Ess: Islamische Perspektiven 103 Ein schlechtes Image und seine Folgen 103 Die Zeitstellung als Wertmaßstab 105 Muhammad, ein „arabischer Prophet“ 105 Form und Inhalt der neuen Offenbarung 107 Der Aufbruch nach Medina 110 Das prophetische Selbstverständnis Muhammads 112 Der Inspirationsbegriff 113 Die Wunderbarkeit des Koran 115 Die Überhöhung des Propheten 116 2. Hans Küng: Eine christliche Antwort 117 Von der Ignoranz über die Arroganz zur Toleranz 118 Der Islam – ein Heilsweg? 121 Muhammad – ein Prophet? 122 Der Koran – Wort Gottes? 127 Offenbarung außerhalb der Bibel 128 Wort für Wort inspiriert? 130 Von der Bibelkritik zur Korankritik 132 II. Sunniten und Schiiten: Staat, Recht und Kultus 136 1. Josef van Ess: Islamische Perspektiven 136 Ein welthistorischer Erfolg und seine Mängel 136 Die verschiedenen Geschichtsbilder 137 Die Verwaltung der Macht und das Recht 140 Tradition und juristische Methode 141 Theonomes Gesetz, weltlicher Staat und individuelles Gewissen 143 Die Grundgebote des Islam 146 Der Sinn der Gebote 148 2. Hans Küng: Eine christliche Antwort 149 Alte Religion in neuer Zeit 149 Ein mittelalterliches Paradigma von Religion? 150 Das Relevanz- und Identitätsdilemma 153 Der dritte Weg: Religion in säkularer Gesellschaft 154 Ansätze zu einer innerislamischen Reform 156 Kann der islamische Fundamentalismus überleben? 159 Das Problem einer vergesetzlichten Religion 162 Gottes Gebote – um der Menschen willen 163 Ansätze zu einer innerislamischen Gesetzeskritik 166 III. Gottesbild und islamische Mystik, Menschenbild und Gesellschaft 170 1. Josef van Ess: Islamische Perspektiven 170 Der Primat des Monotheismus 170 Gott als der barmherzige Herr 171 Die Vertiefung des Liebesbegriffs in der islamischen Mystik 172 Die Natur als Spiegel göttlicher Macht 174 Göttliche Macht und menschliche Freiheit 176 Die leibseelische Einheit des Menschen 178 Die Gemeinschaft der Gläubigen 180 Die islamische „égalité“ und ihre Grenzen 181 2. Hans Küng: Eine christliche Antwort 183 Zur Frauenfrage im Islam 183 Gemeinsamkeiten des Glaubens an den einen Gott 185 Gottes Handeln und des Menschen Freiheit 187 Ewige Vorausbestimmung und ewiges Leben 189 Eros und Agape 191 Die Radikalität der christlichen Liebe 193 In sinnlosem Leiden ein Sinn-Angebot 194 Der Gott der Liebe 196 IV. Der Islam und die anderen Religionen. Jesus im Koran 197 1. Josef van Ess: Islamische Perspektiven 197 Zur Dialogbereitschaft im Islam 197 Jesus im Koran 198 Der (Heilige) „Geist“ 200 Judentum und Christentum in der Sicht islamischer Heilsgeschichte 201 Juden und Christen im Koran und im islamischen Recht 202 Die praktische Behandlung der „Schriftbesitzer“ 204 „Toleranz“ nach außen und nach innen 205 Bekehrung und Mission 207 Zusammenfassung: Stärke und Schwäche des Islam 208 2. Hans Küng: Eine christliche Antwort 209 Stimmt das Jesus-Porträt? 210 Trinität – unüberwindliches Hindernis? 212 Muslimische Trinitätskritik 214 Die Sucht zu definieren 216 Was heißt: Gott hat einen Sohn? 217 Das spezifisch Christliche 219 Jesus als Gottesknecht 223 Worüber man reden sollte 228 Muhammad – „nichts als ein deutlicher Warner“ 229 Grundlegende Literatur zum Islam 232 B. Hinduismus und Christentum 235 Zeittafel 235 I. Was ist Hinduismus? Zur Geschichte einer religiösen Tradition . 237 1. Heinrich von Stietencron: Hinduistische Perspektiven 237 Der „Hinduismus“: ein von Europäern geprägter Begriff 238 Der „Hinduismus“: ein Kollektiv von Religionen 241 Toleranz, Wahrheit und Tradition 244 Die Industal-Kultur und die Einwanderung der Arier 247 Die Veden: älteste heilige Schriften der Inder 249 Geistiger Aufbruch und soziale Restriktion: die Philosophie und das Kastensystem 251 Reformation und Integration: Selbsterlösung durch Wissen 252 Einbeziehung von Religionsformen der Unterschichten 254 Die Integrationsleistung der Brahmanen und die orthodoxen Systeme 255 Die Begegnung mit Islam und Christentum und der Neohinduismus 258 2. Hans Küng: Eine christliche Antwort 260 Europa und die Entdeckung Indiens 262 Religion als Kompensation? 264 Neue Sehnsucht nach Indien? 266 Was ist mystische Erfahrung? 268 Ist jede Mystik religiös? 270 Gibt es die eine mystische Erfahrung? 273 Mystische und prophetische Religion 276 Alle Religionen gleich? 279 Gegenseitige Durchdringung 281 II. Welt und Gottheit: Konzeptionen der Hindus 284 1. Heinrich von Stietencron: Hinduistische Perspektiven 284 Kosmische Ordnung 284 Kosmische Zeit 286 Die Entstehung der Welt 290 Brahman und Ātman 291 Das Eine und die Vielheit 293 Die Potenzen Gottes und die Welt als Spiel 294 Vom Wesen Gottes 296 2. Hans Küng: Eine christliche Antwort 300 Die Rolle des Mythos im Leben 300 Monismus oder Dualismus? 302 Einheit in Unterschiedenheit – indisch verstanden 305 Schöpfung aus Nichts? 306 Schöpfung in Entfaltung 309 Personales oder apersonales Gottesverständnis? 310 Die Welt als Spiel Gottes? 312 III. Mensch und Erlösung in Religionen der Hindus 315 1. Heinrich von Stietencron: Hinduistische Perspektiven 315 Woher kommt die Ungleichheit der Menschen? 315 Lebensseele und Wiedergeburt 317 Wege zur Erlösung 321 Der Weg des Wissens (jñāna-mārga) 323 Der Weg des Handelns (karma-mārga) 324 Der Weg der Gottesliebe (bhakti-mārga) 325 2. Hans Küng: Eine christliche Antwort 328 Sehnsucht nach Erlösung 328 Parallele Wege 329 Weltliche Frömmigkeit 330 Gnadenreligion 332 Ein einziges oder mehrere Leben? 333 Ein Leben vor dem jetzigen Leben? 335 Ein Leben nach diesem Leben? 337 Verifikation der Reinkarnationslehre? 339 Geschichte zirkulär oder zielgerichtet? 341 Glaube an den Fortschritt? 344 IV. Religiöse Praxis: Ritus, Mythos, Meditation 345 1. Heinrich von Stietencron: Hinduistische Perspektiven 345 Erste Eindrücke des Touristen 345 Das häusliche Ritual 347 Die vier Lebensstadien (āshrama) der Zweimalgeborenen 349 Steht das Kastensystem vor seiner Auflösung? 352 Tempel und Götterbild 354 Das Tempelritual und die innere Vorbereitung des Brahmanen 356 Der Mythos – ein vielschichtiges Phänomen 359 Yoga als meditatives Training 360 Die Ebenen des Denkens und die Wahrheit 362 2. Hans Küng: Eine christliche Antwort 363 Volkshinduismus und Volkskatholizismus 363 Monotheismus oder Polytheismus? 365 Was steckt hinter der Volksfrömmigkeit? 366 Kritische Rückfragen 368 Transformation der Religion 369 Mystik und Aktion 372 Die Wahrheit von Bildern und Geschichten 374 Was soll mit den Mythen geschehen? 376 Die historische Frage 379 Die historische und die kosmische Dimension 381 Christus und Krishna 384 Gemeinsamer Ansatzpunkt: der Jesus der Bergpredigt 388 Inkulturation und kritisch-kontextuelle Theologie 390 Grundlegende Literatur zu Hindu-Religionen 391 C. Buddhismus und Christentum 393 Zeittafel 393 I. Der historische Buddha: Seine Lehre als Weg zur Erlösung 394 1. Heinz Bechert: Buddhistische Perspektiven 394 Lebensumstände und Bedeutung des historischen Buddha 394 Sinn und Ziel der Lehre des Buddha 397 Nutzlosigkeit des Glaubens und Koexistenz mit anderen Religionsformen 399 Leiden und Wiederverkörperung 400 Der Weg zur Erlösung 402 Das Nirvāna 404 Buddhistische Kosmologie 407 2. Hans Küng: Eine christliche Antwort 409 Die ersten Kontakte 410 Die Wende in Wissenschaft und Kirche 412 Buddhismus – eine Sache der Erfahrung allein? 414 Zum Verhältnis von Wahrheit und Geschichte 417 Von der Notwendigkeit, auf den Buddha der Geschichte zurückzufragen 422 Legendenbildungen 424 Was Jesus und Gautama verbindet 426 Was Jesus und Gautama unterscheidet 428 Der Erleuchtete und der Gekreuzigte 430 Nirvāna oder ewiges Leben? 431 II. Die buddhistische Gemeinde und ihre ältere Geschichte 433 1. Heinz Bechert: Buddhistische Perspektiven 433 Der Sangha 433 Die buddhistischen Laien 436 Überlieferung der Lehre und heilige Texte 437 Ashoka und die Anfänge der buddhistischen Weltmission 439 Theravāda-Buddhismus 440 Ältere Geschichte des Buddhismus in Indien 442 2. Hans Küng: Eine christliche Antwort 444 Der ideale Buddhist 445 Söhne Buddhas – Söhne Christi? 446 Mönchtum – ursprünglich christlich? 447 Paradigmenwechsel von der Elitereligion zur Massenreligion . 451 Sangha und Kirche 455 Weltentsagung und Weltgestaltung 457 Toleranz? 458 Heilssuche und Ökonomie 460 Immanente Spannung zwischen mönchischer und laikaler Existenz 462 Konsequenzen für das Gespräch mit dem Theravāda- Buddhismus 465 III. Vom Theravāda zum Reinen Land: Formen buddhistischen Denkens und Lebens 467 1. Heinz Bechert: Buddhistische Perspektiven 467 Shrāvakayāna (Hīnayāna) und Mahāyāna 467 Shūnyavāda und Yogācāra 468 Vajrayāna-Buddhismus 471 Shaktistischer Tantrismus 473 Der Untergang des indischen Buddhismus 476 Die Ausbreitung des Buddhismus in Asien 477 Der ostasiatische Buddhismus 478 2. Hans Küng: Eine christliche Antwort 481 Paradigmenwechsel vom Kleinen zum Großen Fahrzeug 481 Buddhistisches Wirklichkeitsverständnis 484 Die Würde der menschlichen Person 488 Selbstverbrennung des Denkens durch das Denken selbst 492 Die „Leere“ – negativ oder positiv verstanden? 494 Das Absolute Sein? 496 Der Buddhismus – atheistisch? 498 Das Absolute – personal oder apersonal? 502 Vom Ineinanderfallen der Gegensätze 504 Gott östlich – westlich verstanden 505 IV. Buddhismus und Gesellschaft: Buddhismus in unserer Zeit 508 1. Heinz Bechert: Buddhistische Perspektiven 508 Niedergang und Erneuerung 508 Der Buddhismus im Abendland 509 Abendländische und asiatische Reaktionen 511 Buddhistische Ökumene 514 Ambedkar und der indische Neobuddhismus 514 Rückblick und Ausblick 517 Überlegungen zum buddhistisch-christlichen Religionsgespräch 519 2. Hans Küng: Eine christliche Antwort 521 Nochmals: zur Methode des Dialogs 521 Paradigmenwechsel vom Großen zum Diamant-Fahrzeug 523 Religiosität und Sexualität 525 Widerspruch zur Lehre des Buddha? 527 Der Buddhismus der Meditation 530 Meditation oder Gebet? 533 Christliche Meditation und buddhistisches Gebet 535 Der eine Buddha und die vielen Buddhas 537 Der Buddhismus des Glaubens 541 Buddhologie und Christologie 544 Leid und Vollendung 547 Grundlegende Literatur zum Buddhismus 550 Hans Küng: Kein Weltfrieden ohne Religionsfrieden! Schlusswort 552 Dankeswort 555 Zwei Beiträge zum christlich-buddhistischen Dialog 558 I. „God’s Self-Renunciation and Buddhist Emptiness: A Christian Response to Masao Abe“ 558 Einführung 558 Das Original 558 Biographischer Kontext 558 God’s Self-Renunciation and Buddhist Emptiness: A Christian Response to Masao Abe 558 From modern Nihilism to postmodern Belief in God 561 The kenosis of God himself? 563 The true dialogical hermeneutic? 565 Sunyata – Being – God 566 Sunyata – The central concept of buddhism? 568 Two Buddhist options with regard to ultimate reality 570 An eastern-western understanding of God 572 Postscriptum 573 II. „Response to Francis Cook: Is it just this? Different paradigms of Ultimate Reality in Buddhism“ 574 Einführung 574 Das Original 574 Biographischer Kontext 574 Response to Francis Cook Is It Just This? 576 1. Historical remarks 577 2. The Buddhist concept of reality 580 3. Two Buddhist options regarding ultimate reality 582 4. An eastern-western understanding of God 584 Discussion 586 TEIL D. „Christentum und Chinesische Religion“ (zusammen mit Julia Ching; 1988) Einführung 593 Das Original und seine Übersetzungen 593 Biographischer Kontext 593 Christentum und Chinesische Religion 595 Hans Küng: China – ein drittes religiöses Stromsystem 595 Zur Aussprache chinesischer Wörter 602 Zeittafel 603 I. Die Religion des chinesischen Altertums 605 1. Julia Ching: Chinesische Perspektiven 605 Einleitung: Sind die Chinesen religiös? 605 Chinesische Zivilisation und Religion 607 Das alte China: Mythologie und Archäologie 608 Wahrsagung 610 Opfer 614 Schamanismus 618 Königtum 620 Der ekstatische Charakter der alten Religion 623 2. Hans Küng: Eine christliche Antwort 626 Die Permanenz archaischer Religion in der Volksreligion heute 627 Ahnenverehrung – aber wie? 629 Opferpraktiken: Prozesse der Verinnerlichung und Vergeistigung 632 Wahrsagung und die andere Dimension des Lebens 634 Was steckt hinter der Volksreligion? 637 Das Dilemma des Christentums angesichts der Volksreligion 641 Der Unterschied zwischen Schamane und Prophet 643 Glaube oder Aberglaube? 645 Die Frage nach dem Humanum 647 II. Der Konfuzianismus: Humanismus als Religion 648 1. Julia Ching: Chinesische Perspektiven 648 Einleitung: Der Aufstieg des Humanismus 648 Der Konfuzianismus – ein ethischer Humanismus 649 Menzius und Hsün-tzu 655 Der Konfuzianismus – eine „Staatsreligion“ 657 Der Neo-Konfuzianismus als konfuzianisches Erbe 659 Der Konfuzianismus heute 662 Das moderne Dilemma 663 2. Hans Küng: Eine christliche Antwort 668 Konfuzianisches Erbe heute 668 Die transzendente Dimension 671 Dualität der Gottesnamen in der altchinesischen und altisraelitischen Religion 673 Die Rückfrage nach dem historischen Konfuzius 675 Gemeinsamkeiten zwischen Konfuzius und Jesus von Nazaret 679 Ein dritter Grundtypus von Religiosität 682 Das Humanum als Grundnorm einer Ethik der Weltreligionen 686 Der Mensch – von Natur gut oder böse? 687 Menschenliebe – Nächstenliebe – Feindesliebe 689 Eine Zukunft für den Konfuzianismus? 691 „Es sind 5000 Jahre alte Piktogramme“ 694 III. Taoistischer Naturalismus: Philosophie und Religion 697 1. Julia Ching: Chinesische Perspektiven 697 Einleitung: Was ist Taoismus? 697 Der Taoismus als Philosophie 698 Der Taoismus als Religion 702 Taoismus als Erlösungsreligion 709 Ist Taoismus auch Volksreligion? 714 Welche Bedeutung hat der Taoismus heute? 714 2. Hans Küng: Eine christliche Antwort 717 Eine vielschichtige Religion des Heiles 717 Heil – Heilung – Heilkunst 720 Erfahrungswissen in chinesischer und israelitischer Spruchweisheit 723 Protest gegen die Weisheit: in China – in Israel 725 Was ist das Tao: Weg oder Sein? 726 Tao = Gott? 729 Polarität in Gott: Licht und Dunkel? 730 Polarität im Tao: Yin und Yang? 731 Die klassische Synthese: Han-Orthodoxie und Patristik 734 Mittelalterliche Parallelen: Neo-Konfuzianismus und Scholastik 735 Die Provokation des Negativen in der Moderne 738 Tödliche Konfrontation 740 Durchkreuzte Weisheit 743 IV. Der Buddhismus: Eine fremde Religion in China 745 1. Julia Ching: Chinesische Perspektiven 745 Einleitung: Die ethnischen und die missionarischen Religionen 745 Der Einzug des Buddhismus 746 Die Übersetzung der buddhistischen Schriften 748 Das Aufblühen buddhistischer Sekten 752 Das buddhistische Erbe 757 „Chinesische Religion“ – eine oder drei? 760 Das Christentum – eine fremde Religion 762 Das dritte Flusssystem 765 2. Hans Küng: Eine christliche Antwort 766 Verpasste Chancen – neue Möglichkeiten? 766 Modell 1: Äußerliche Angleichung 768 Modell 2: Synkretistische Vermischung 769 Modell 3: Komplementäre Ebenen 771 Modell 4: Missionarische Konfrontation 773 Modell 5: Kulturelle Überfremdung 777 Modell 6: Antimissionarische Reaktion 778 Modell 7: Kontextuelle Inkulturation 784 Eine chinesische Theologie für die Postmoderne 788 Problemfelder asiatischer Theologie 789 Schwerpunkte chinesischer Theologie: Gottes-, Christus-, Geistverständnis 791 Was der Westen vom östlichen Denken lernen kann 797 Hans Küng: Epilog 801 Religiöse Doppelbürgerschaft: eine Herausforderung an den Westen 801 Das Problem 801 Doppelbürgerschaft kulturell? 802 Doppelbürgerschaft ethisch? 804 Doppelbürgerschaft im Glauben? 806 Bibliographie 810 1. Allgemeine Literatur 810 2. Spezialliteratur 811 Dankesworte 814 TEIL E. „Christlicher Glaube und Weltreligionen“ (2004) Einführung 819 Das Original 819 Biographischer Kontext 819 Christlicher Glaube und Weltreligionen 820 Dankeswort 829 Weitere Titel aus der Reihe Hans Küng - Sämtliche Werke |
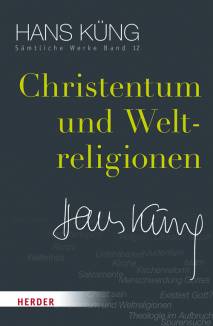
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen