|
|
|
Umschlagtext
Während Inklusion in Schulen breit diskutiert wird, ist von Exklusion kaum die Rede. Dabei ist die Umsetzung von Inklusion in widersprüchliche Praktiken verstrickt, die mitunter das Gegenteil dessen bewirken, was sie erreichen wollen. Hendrik Richter setzt sich in seiner – an einer österreichischen Mittelschule durchgeführten – Ethnografie mit solchen Exklusionseffekten auseinander und analysiert sonderpädagogische Zuschreibungs- und Veranderungspraxen aus einer intersektionalen Perspektive, die Behinderung mit anderen Differenzlinien wie Klasse, Ethnizität und Geschlecht diskutiert. Vom Subjekt aus gedacht richtet er den Blick auf die Umgangsweisen der Schüler:innen mit den Exklusionsmechanismen: Wie erleben sie Ausgrenzung und welche selbstermächtigenden Antworten finden sie darauf?
Hendrik Richter (Dr. phil.), geb. 1989, ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur für Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Inklusive Bildung an der Technischen Universität Dresden. Der Bildungswissenschaftler promovierte an der Universität Innsbruck und war dort Mitglied des Doktoratskollegs 'Dynamiken von Ungleichheit und Differenz im Zeitalter der Globalisierung'. Rezension
Faktisch sind Schüler*innen mit Behinderung trotz Inklusion von Ausgrenzung und Diskriminierung bedroht. Während allerorten von Inklusion gesprochen wird, greift dieses Buch gezielt Exklusionsmechanismen im Schulalltag auf. Das Buch nimmt eine herrschaftskritische Perspektive ein und fragt danach, wie sich Schüler*innen zu den Exklusionsmechanismen eines Schulsystems, das soziale Ungleichheiten und Differenzen auf empfindliche Weise reproduziert, verhalten. Die Umgangsweisen und Ausdrucksformen der Schüler*innen stehen dabei im Mittelpunkt der Studie. Die Darstellung liefert einen seltenen Einblick in den Schulalltag von benachteiligten Schüler*innen. Zugleich schärft das ethnografische Material den Blick für Phänomene der Exklusion in der Inklusion, womit auch hegemoniale Diskurse in der Erziehungswissenschaft kritisch hinterfragt werden. Das Buch begreift schulischen Protest und Widerstand als Antwort auf ungerechte Gesellschaftsstrukturen zu lesen. Damit erweitert sich die Perspektive schulischer Inklusion um die Dimension gesellschaftlicher Exklusionsphänomene und um die Frage sozialer Ungleichheit: Wie und unter welchen Bedingungen wird hier Inklusion eigentlich hergestellt?
Oliver Neumann, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Schlagworte: Bildungsforschung, Soziale Ungleichheit, Sozialpädagogik, Bildungssoziologie, Kulturanthropologie, Qualitative Sozialforschung, Jugend, Armut, Bildungspolitik, Behinderung, Sozialarbeit, Rassismus, Migration, Kultursoziologie, Politische Soziologie, Sozialpolitik, Politik, Politikwissenschaft, Demokratie, Menschenrechte, Gewalt, Migrationspolitik, Rechtsextremismus, Bildung, Pädagogik, Neoliberalismus, Soziologie, Bevölkerung, Familiensoziologie, Flüchtlingsforschung Inhaltsverzeichnis
Einleitung. Schule und Exklusion 9
Inklusion und Exklusion 18 Behinderung und Ableismus 25 Intersektionalität und soziale Differenz 28 I. Back to school. Ethnografisch forschen 33 Teilnehmende Beobachtung, Zugang und Vertrauen 35 Zwischen Qualitätsmanager und Verdächtigem 42 Die Autorität des Feldtagebuches 45 Ereignislosigkeit und Langweile 47 Forschen in der (Corona-)Krise 50 II. Ein Ort der Ungleichheit. Die NMS Bachmannstraße 55 Zur Schule. Stadt, Bildung, Ungleichheit 56 Stadtteil und Migrationsgeschichte 57 Bildungsungleichheit und Biografie 61 Schulreform und Neue Mittelschule 64 Biografische Brüche und Verletzungen 65 (Alltags-)Rassismus 67 Soziale Klasse und Lebensentwürfe 72 Häusliche Gewalt und Armut 76 III. Ordnung. Machtverhältnisse im Schulalltag 79 Ordnungen in Raum und Zeit 80 Macht und Disziplinierung 84 Rituale des Übergangs 88 Außeralltägliche Ereignisse 90 Reproduktion, Qualifikation und Leistung 91 Nur positiv reicht 97 Leistung und Ideologie 100 Ungleichheit und kulturalisierende Zuschreibungen 103 Bestrafungspraktiken. Vom Schimpfen zur Demütigung 106 Wut und Enttäuschung 108 Ausschluss und Verstoß 110 Beschämung und Demütigung 112 IV. Inklusion und Exklusion. Der sonderpädagogische Förderbedarf 117 Von außen. Veranderung und Ausschluss 118 Der Förderbedarf 119 Exkludierende Raum-Zeit-Zonen 126 Performative Sprechakte 131 Von innen. Subjektwerdung und Selbsterzählung 136 Abgrenzung nach unten 136 Marginalisierung des Selbst 139 Sicherheit und Entlastung 143 Lehrkräfte und Inklusion 147 Kollektive Skepsis und Schreckgespenster 148 Rollenkonflikte unter Lehrer:innen 154 Berufsbiografische Rekonfigurationen 158 V. Ohnmacht. Erleben und Erleiden 163 Gefühle der Exklusion 164 Kollektive Langeweile 165 Von der Wut zur Zerstörungsimagination 171 Scham und Neid 176 Gefühle postmigrantischer Identität 183 Sprache der Anderen 187 Sprechen und nicht gehört werden 188 Geheimsprachen und Monolingualität 191 Falsche Grammatik, falsches Deutsch 195 VI. Stärke. Handeln und Widerstand 199 Widerständigkeit und Konformität 200 Humor als Waffe 206 Die Schultoilette als Raum des Widerstands 209 Geheimnisträger:innen 212 Weibliche Anpassungsstrategien 214 Gefährlichkeitsfiguren 218 (Kick-)Boxen und die Aufführung von Gefährlichkeit 220 Ästhetische Selbstfigurierungen 227 Verlierer der Performanz gefährlicher Männlichkeit 230 Gefahren 233 Kriminelle Figuren 237 Schluss: Abolish Schools 243 Anhang – Liste des Materials 251 Literaturverzeichnis 253 Danksagung 297 Weitere Titel aus der Reihe Gesellschaft der Unterschiede |
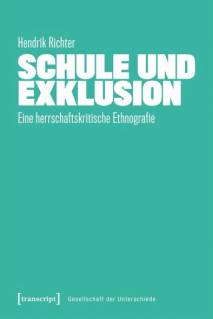
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen