 | Die Geschichte der Ikone, die prägend und stilbildend für die Theologie und religiöse Kunst aller orthodoxen Kirchen ist, beginnt im zweiten Jahrhundert nach Christi. In der Regel in Enkaustik oder mit Eitempera auf eine Holztafel gemalt erfüllte sie verschiedene Funktionen: sie wurde als Andachtsbild zu Hause oder in der Öffentlichkeit verehrt, zur Verbreitung des Evangeliums eingesetzt, war fester Bestandteil des Gottesdienstes und öffnet... |  | Die bildende Kunst gerät im Verlauf der Christentumsgeschichte immer wieder zwischen die Fronten von Ikonodulen und Ikonoklasten, von Bilderverehrern und Bilderstürmern. Das Reformationszeitalter neigt eher zur Bilderstürmerei, jedenfalls im linken Flügel der Reformation und bei den Schweizer Reformatoren (Zwinglianer und Calvinisten); bei Luther bleiben die Bilder zwar erhalten, sie werden aber ihrer theologischen Bedeutung beraubt, indem di... |
 | Wer nicht gerade Spezialist für Kunstgeschichte und Kunstkritik ist, dürfte mit dem Namen Daniel Arasse nichts anfangen können. Arasse ist ein hoch angesehener französischer Wissenschaftler, dessen Essay 'Bildnisse des Teufels' (im Original 'Le Portrait du Diable') jetzt in einer wunderfeinen Ausgabe von Matthes & Seitz vorliegt. Wunderfein nicht nur deshalb, weil auf Satz und Layout größter Wert gelegt wurde, sondern auch, weil die Überse... |  | 'An die Kunst glauben' stellt eine Reihe thematisch verwandter Texte Wolfgang Ullrichs zusammen, die zwischen 2007 und 2011 in verschiedenen Zusammenhängen entstanden sind. Ullrich, bekannt für seine unkonventionellen und erfrischenden Ansichten (vgl. etwa sein Buch 'Raffinierte Kunst. Übungen vor Reproduktionen'), beschäftigt sich in diesem Sammelband in unterschiedlicher Perspektivik vor allem mit der Problematik von Religion und Kunstrelig... |
 | Die christliche Religion und Theologie ist als monotheistische Religion im Gefolge des Judentums eigentlich bilderfeindlich, aber die Kirchengeschichte schwankt im Laufe der Jahrhunderte regelmäßig zwischen Ikonodulen und Ikonoklasten, Bilderverehrern und Bilderstürmern. Im Mittelpunkt steht selbstverständlich das Christusbild. Dem Christusbild war auch ein Symposion vom 22.-24. November 2007 in Koblenz gewidmet, das in diesem Band dokumentie... |  | Bücher dieser Art wünschte man sich öfter: kompakt, kompetent, klar aufgebaut, informativ, samt hilfreichen und aussagekräftigen Illustrationen, Anmerkungen, Literaturverweisen und einem Personenregister. Und dies zu einem Thema, das nach dem Streit um die Mohammed-Karikaturen immer wieder diskutiert wird, oft ohne dass ein entsprechender Wissenshintergrund vorhanden wäre.
Silvia Naef liefert ihn und beendet ihre fundierten Darlegungen mit... |
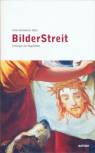 | Der vorliegende Band versammelte die Beiträge einer Ringvorlesung, die die Katholisch-Theologische Fakultät Würzburg im Wintersemester 2005/2006 veranstaltet hat. So unterschiedlich die Fachgebiete sind, die hierzu beitragen, so unterschiedlich sind auch die abgedruckten Untersuchungen und Vorträge. Was sie verbindet, ist das Thema des biblischen 'Bilderverbotes' und seine Auswirkungen in der Geschichte des christlichen Umgangs mit Bildern. W... |  | Es scheint zu einem immer größeren Problem zu werden: Die Kirchen erreichen mit ihrer Botschaft immer weniger Menschen. Sie scheint mit ihrer Sprache und den Inhalten nicht mehr zeitgemäß zu sein. Doch woher nimmt der moderne Mensch seine Sinndeutungsantworten? Was beeinflusst sein Suchen? Welche Bedeutung hat in diesem Zusammenhang Religion? Das sind einige wenige Fragen, denen das vorliegende Buch "Sinnfragen" nachgeht. Wilhelm Gräb verdeu... |
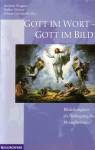 | Mit dem jüdisch-christlichen Monotheismus scheint das Bilderverbot wesentlich verbunden; der biblische Gott ist kein Kultobjekt wie andere und weder räumlich zu fixieren noch namentlich zu fassen (Ex 3,14). Im Verbot, sich ein Bildnis von Gott zu machen, spiegelt sich Gottes monotheistische Exklusivität. Auch im Neuen Testament und damit im Christentum dominiert zunächst die Bilderlosigkeit, dann aber setzt in der Kirchengeschichte ein erbitt... |  | Die Zeit zwischen dem 5. und dem 9. Jahrhundert gehört sicherlich zu den unbekannteren Epochen in den Kirchengeschichtsdarstellungen, die eher von der Alten Kirche und der Reformationszeit dominiert werden. Allzu kompliziert und unverständlich erscheinen auch viele Themen aus dieser Zeit: Wer versteht schon die christologischen Streitigkeiten beim Konzil von Chalkedon 451 n. Chr., wer kann mit den Stichworten Monophysitismus, Monenergismus oder... |