|
|
|
Umschlagtext
"In der Teufelsgestalt kehrt sich die Heiligkeit des Göttlichen in ungeheurer Weise um." Daniel Arasse
"Daniel Arasse gehört zu den Schwergewichten der französischen Kunstkritik. Dabei kommen seine Interpretationen eher leichtfüßig daher. Das heißt, es ist für den Leser ein Leichtes, Arasse auf seinen Gedankengängen zu begleiten. So ist auch sein Essay 'Bildnisse des Teufels' ein Text, der zum eigenen Mit- und Nachdenken anregen möchte." Andreas Puff-Trojan, Recherche Daniel Arasse (1944 - 2003), einer der berühmtesten Kunsthistoriker Frankreichs, dessen Ruf auf der Verbindung von stilistischer Brillanz mit wissenschaftlicher Autorität gründete. Er veröffentlichte historische Studien zu Leonardo und Vermeer aber auch zur Gegenwartskunst über Rothko, Cindy Sherman und besonders Anselm Kiefer. G.H.H. lebt und arbeitet in Berlin, Paris und Wien. 2010 erschienen von ihm 'Gedichte in zwei Sprachen'. Rezension
Wer nicht gerade Spezialist für Kunstgeschichte und Kunstkritik ist, dürfte mit dem Namen Daniel Arasse nichts anfangen können. Arasse ist ein hoch angesehener französischer Wissenschaftler, dessen Essay 'Bildnisse des Teufels' (im Original 'Le Portrait du Diable') jetzt in einer wunderfeinen Ausgabe von Matthes & Seitz vorliegt. Wunderfein nicht nur deshalb, weil auf Satz und Layout größter Wert gelegt wurde, sondern auch, weil die Übersetzung durch G.H.H. (Wer mag das sein? Das Internet verrät nur: g.h.h. lebt und arbeitet in berlin und paris. wenn in berlin: anzutreffen im S-CAFÉ am s-bahnhof friedenau gegen halb zehn uhr morgens) um ein ausführliches und sorgfältig kommentiertes Literaturverzeichnis ergänzt wurde. Außerdem ist das Bändchen großzügig illustriert, so dass man auch immer sehen kann, wovon die Rede ist.
Worum geht es in diesem Buch? Arasse schildert, wie sich die Darstellung des Teufels im Laufe der Kunstgeschichte verändert hat. Im Mittelpunkt seiner Betrachtung stehen das 15. und 16. Jahrhundert, als die traditionelle Darstellung des Teufels in dem Sinne vermenschlicht wurde, dass der Dämon, bislang schematisch visualisiert, jetzt individuelle Züge bekommt. Darin spiegelt sich auch eine Veränderung des Begriffs des Bösen, das nicht mehr nur als mythische, auch 'außerirdische' Macht erscheint, sondern in der Geschichte der Menschheit konkrete (Gesichts-)Züge annehmen kann. Noch weiter geführt in die ('wissenschaftliche') Physiognomik der Neuzeit, soll es am Ende gar möglich sein, das böse und verbrecherische Potential direkt aus den Gesichtern abzulesen. Was Arasse nur anreißen kann, ist die theologische Dimension seiner Überlegungen. Letztlich führen sie zu den Themen des durch die Jahrhunderte andauernden 'Bilderstreites' mit seiner zentralen Fragestellung, ob und wie das Göttliche (und damit natürlich auch das Gegenkonzept des Bösen) abgebildet werden können und welche Anthropologie sich darin spiegelt und gleichzeitig daraus ergibt. Matthias Wörther, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Daniel Arasse zeichnet in diesem dichten und verweisreichen Essay die Veränderungen nach, denen die Darstellung des Bösen in der Kunst unterliegt. Die Bilder der Teufel, Dämonen, Hexen und Höllenbewohner, die ursprünglich rein theologische Figuren waren und eine mnemonische Funktion erfüllten, entwickelten sich im Laufe der Jahrhunderte und der Epochen immer mehr zu Bildern des »Teufels mit menschlichem Antlitz«. Dieser radikalen Umformung im christlichen 15. und 16. Jahrhundert, ihren Gründen, Wegen und Abwegen geht Arasse nach. Er zieht dabei eine Linie über Cesare Lombrosos Verbrecherstudien hin zur polizeilichen Anthropometrie und verweist damit auf das Wiederauftauchen des Teufels in der modernen Sozialmoral. |
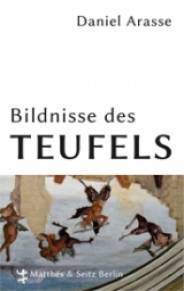
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen