|
|
|
Umschlagtext
Können Kinder wirklich selbstständig lernen?
Falko Peschel hat vier Jahre eine Klasse durch die Grundschulzeit geführt, ohne zu „unterrichten". Dabei haben die hohen Leistungen der Kinder nicht nur ihn, sondern auch viele Besucher immer wieder verblüfft. Warum ist ein auf die Selbststeuerung der Kinder setzender Offener Unterricht so effektiv - und wie kann er konkret aussehen? Im vorliegenden Band entwickelt Falko Peschel aktuelle Unterrichtsformen wie Freie Arbeit, Wochenplan-, Stations-, Werkstatt- und Projektunterrichtzu einem radikalen Verständnis von „Offenem Unterricht" weiter. Er sichtet seine Erfahrungen und ordnet sie in übergreifende Konzepte ein, bevor im Folgeband die tagtägliche Unterrichtspraxis in Sprache, Mathematik, Sachunterricht usw. ganz konkret und mit vielen Praxisbeispielen und Unterrichtshilfen vorgestellt wird. Ein Buch basierend auf praktischer Schulerfahrung, das zugleich ein - längst überfälliges - theoretisches Fundament für Offenen Unterricht grundlegt. Der Autor Falko Peschel ist Grundschullehrer im Rhein-Sieg-Kreis, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Siegen und Lehrbeauftragter an der Universität zu Köln. Seine Suche nach der „verlorenen Offenheit" hat ihn seit dem Studium an viele Alternativ-und Regelschulen im Inland und Ausland geführt. Diese Erfahrungen und die Erprobung eines herausfordernden Konzeptes Offenen Unterrichts prägen seine Veröffentlichungen. Rezension
Offener Unterricht ist eine Organisationsform des Unterrichts oder ein Unterrichtsprinzip, das offenes Lernen ermöglicht - und steht damit dem Begriff des Frontalunterrichts gegenüber. Zugelich verändert sich die Rolle des Leherers vom Wissensvermittler zum Lernbegleiter. Offener Unterricht unterscheidet sich von anderen Unterrichtsformen durch die individuellen Lerninteressen der Kinder, die das Lerngeschehen,das soziale Geschehen und die über die Lerngruppe hinausgehenden Interaktionen bestimmen. Kernelement des offenen Unterrichts sind die Individuen in der Lerngruppe, dabei ist die Einteilung des Unterrichts nach Fächern nicht üblich. - Im Teil I entwickelt Falko Peschel aktuelle Unterrichtsformen wie Freie Arbeit, Wochenplan-, Stations-, Werkstatt- und Projektunterricht zu einem radikalen Verständnis von Offenem Unterricht weiter. Im Teil II konkretisiert Falko Peschel nun auf der fachdidaktischen Ebene. Offener Sprach-, Mathematik- und Sachunterricht wird nicht nur theoretisch fundiert, sondern vor allem unterrichtspraktisch aufbereitet. - Fazit: Diese Bände vermitteln umfassend, was Offener Unterricht bedeutet.
Oliver Neumann, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Können Kinder wirklich selbstständig lernen? Falko Peschel hat vier Jahre eine Klasse durch die Grundschulzeit geführt, ohne zu unterrichten. Dabei haben die hohen Leistungen der Kinder nicht nur ihn, sondern auch viele Besucher immer wieder verblüfft. Warum ist ein auf die Selbststeuerung der Kinder setzender Offener Unterricht so effektiv - und wie kann er konkret aussehen? Im Teil I entwickelt Falko Peschel aktuelle Unterrichtsformen wie Freie Arbeit, Wochenplan-, Stations-, Werkstatt- und Projektunterricht zu einem radikalen Verständnis von Offenem Unterricht weiter. Er sichtet seine Erfahrungen und ordnet sie in übergreifende Konzepte ein, bevor im Folgeband die tagtägliche Unterrichtspraxis in Sprache, Mathematik, Sachunterricht usw. ganz konkret und mit vielen Praxisbeispielen und Unterrichtshilfen vorgestellt wird. Im Teil II konkretisiert Falko Peschel nun auf der fachdidaktischen Ebene. Offener Sprach-, Mathematik- und Sachunterricht wird nicht nur theoretisch fundiert, sondern vor allem unterrichtspraktisch aufbereitet – einschließlich des zur Durchführung notwendigen Hintergrundwissens. Die reflektierte Darstellung einer Palette sinnvoller Werkzeuge und Arbeitsimpulse gibt zusätzlich konkrete Hilfe bei der Öffnung des eigenen Unterrichts. Bücher aus der Praxis, die zugleich ein - längst überfälliges -theoretisches Fundament für Offenen Unterricht grundlegen! Inhaltsverzeichnis
Teil I: Allgemeindidaktische Überlegungen
Vorwort des Herausgebers der Reihe VII Einleitung 1 1 Realität offenen Unterrichts 8 1.1 Gängige Konzepte offenen Unterrichts: vom lehrer- zum materialzentrierten Unterricht 8 1.1.1 Wochenplanunterricht und Freie Arbeit 11 1.1.2 Projektunterricht 22 1.1.3 Werkstattunterricht und Stationslernen 27 1.1.4 Zusammenfassende Übersicht 37 1.2 Exkurs: Didaktisch-methodische Prinzipien und offener Unterricht 40 1.2.1 Lebensbedeutsamkeit, Anwendungs- und Situationsorientierung 40 1.2.2 Handlungsorientierung, Selbsttätigkeit und Produktorientierung 42 1.2.3 Ganzheitlichkeit, „Lernen mit allen Sinnen" und fächerübergreifendes Prinzip 43 1.2.4 Elementarisierung und Kindorientierung 46 1.3 Wie müssten Formen „offenen Unterrichts" eigentlich aussehen? 48 1.3.1 Wochenplanunterricht, Freie Arbeit und Projektunterricht 50 1.3.2 Werkstattunterricht und Stationslernen 61 1.3.3 Von offenen Unterrichtsformen zum Offenen Unterricht 65 2 Was ist überhaupt offener Unterricht? - Das Problem eines wissenschaftlichen Zugangs 67 2.1 Wurzeln, Vorläufer und Legitimationen offenen Unterrichts 68 2.2 Das Problem: Definition und Messbarkeit offenen Unterrichts 70 2.2.1 Die Bandbreite der Interpretationsmöglichkeiten und der Motive für offenen Unterricht 71 2.2.2 Sollte es eine Definition für offenen Unterricht geben - oder nicht? 73 2.3 Ein neuer Definitionsversuch und seine Operationalisierung 76 2.3.1 Dimensionen „offenen Unterrichts" 76 2.3.2 Stufen der Öffnung des Unterrichts 78 2.3.3 Bestimmung des Öffnungsgrades einzelner Unterrichtssequenzen 83 2.3.4 Ein „Stufenmodell" für Offenen Unterricht 86 3 Aktuelle herausfordernde Konzepte Offenen Unterrichts 91 3.1 Offenheit trotz Gleichschritt: „Didaktik der Kernideen - Reisetagebücher-Unterricht" 93 3.1.1 Ein Tag in der Schweiz 94 3.1.2 Methodische Offenheit: Kernideen und Reisetagebücher 100 3.1.3 Kernideen und Reisetagebücher - Hilfen zur Umsetzung 103 3.1.4 Kernideen und Reisetagebücher - Grenzen und Fragen 107 3.2 Offenheit trotz Autorität: „Didaktik des weißen Blatts" 111 3.2.1 Ein Tag in Köln 111 3.2.2 Methodisch-inhaltliche Offenheit: Überholte Strukturen und „prozessuale" Ordnung 117 3.2.3 Unterricht mit weißen Blättern" - Hilfen zur Umsetzung 121 3.2.4 Unterricht mit weißen Blättern" - Grenzen und Fragen 124 3.3 Offenheit trotz Grenzen: Didaktik der sozialen Integration" 128 3.3.1 Ein Tag inTroisdorf 128 3.3.2 Methodisch-inhaltlich-soziale Offenheit: Soziale Integration - von unten, nicht von oben 139 3.3.3 Soziale Integration als Vermeidung von Segregation - Hilfen zur Umsetzung 143 3.3.4 Soziale Integration - Grenzen und Fragen 147 3.4 Kurzer Blick auf die Unterschiede der drei Konzepte 150 4 Methodisch-didaktische Grundsätze des Offenen Unterrichts 154 4.1 Die neue Rolle der Theorie - von der Vorschrift zur Absicherung 158 4.2 Die neue Rolle des Stoffs - von der „Norm" zur „Lupe" 160 4.2.1 Individuelle und umfassende Sicht auf Person, Lernentwicklung und Lernziele 161 4.2.2 Verzicht auf Lehrplannormen und Lehrplandeckelung 162 4.3 Die neue Rolle der Sozialerziehung - von der Harmonisierung zur Selbstregierung 163 4.3.1 Ehrliche und umfassende Mitbestimmung 164 4.3.2 Individualisierung als Voraussetzung für echte Gemeinschaft 165 4.4 Die neue Schülerrolle - vom Aberledigen zum Erfinden 167 4.4.1 Eigener Lern weg, eigene Fehler und eigene Zeit 168 4.4.2 Eigene Ziele, eigene Leistungen und eigene Leistungsbewertung 170 4.5 Die neue Lehrerrolle - vom Belehrenden zum Lernbegleiter 172 4.5.1 Ansprechpartner, Materiallieferant und „Lernförderer" 173 4.5.2 Verzicht auf Lehrgangskrücken und Unterrichtstraditionen 176 4.6 Die neue Rolle der Arbeitsmittel - vom Lehrgang zum Werkzeug 177 4.6.1 Verzicht auf den Konsum von Lehrgängen, Arbeitsmitteln und Lernspielen 177 4.6.2 Herausforderung durch Werkzeuge, Alltagsmaterialien und Informationsmöglichkeiten 179 4.7 Die neue Rolle der Leistungsmessung - von der Kontrolle von oben zur Begleitung von unten 180 4.7.1 Bewertung von Können, Arbeitsverhalten oder Anpassungsbereitschaft? 181 4.7.2 Leistungsbewertung als Einforderung des Lehrers oder des Schülers? 183 4.7.3 Leistungsbewertung als gemeinsamer Prozess „von unten" statt als Vorgabe „von oben" 185 4.8 Die neue Elternrolle - vom Kontrolleur zum Impulsgeber 187 4.8.1 Information und Transparenz als vorbeugende Maßnahme 189 4.8.2 Stützen und Herausfordern statt Nachhilfe geben 191 5 Planung und Bewertung Offenen Unterrichts 193 5.1 Unterrichtsplanung im Offenen Unterricht 193 5.1.1 Unterrichtsplanung - Anspruch und Wirklichkeit 194 5.1.2 Unterrichtsplanung in offenen und in geschlossenen Lernsituationen 196 5.1.3 Warum aber wird auch in offenen Unterrichtsformen auf das alte Planungsmodell bestanden? 206 5.1.4 Eine andere Art der Planung: Flexible Alltagsplanung statt starrem Fünfjahresplan 208 5.2 Reflexion und Bewertung offenen Unterrichts 209 6 Evaluation und Implementation offenen Unterrichts 215 6.1 Die Evaluationsproblematik des offenen Unterrichts 216 6.1.1 Die meisten Untersuchungen zum offenen Unterricht untersuchen gar keinen (durchgängig praktizierten) „offenen Unterricht" 216 6.1.2 Es lassen sich gar keine ausreichenden Stichproben für (durchgängig praktizierten) offenen Unterricht finden 218 6.1.3 Schulleistungstests als Messinstrumente 219 6.1.4 Effektstudien 220 6.1.5 Schülerbefragungen 223 6.1.6 Neue Wege gehen - Lebensentwicklungen statt Lernstand 224 6.1.7 Qualitative Forschung als Basis für quantitative Erhebungen 226 6.2 Aus- und Fortbildung zum offenen Unterricht 227 6.2.1 Reflexion der eigenen schulischen Sozialisation 228 6.2.2 Biographisch-genetisches Lernen anhand von Eigenproduktionen 229 6.2.3 Verknüpfung von Wissenschaft und Praxis 230 6.2.4 Aus- und Fortbildungsschulen 231 6.2.5 Methodische Offenheit als Grundforderung jeglichen Unterrichts 233 7 Kurzer Rückblick - und Ausblick auf den zweiten Teil 235 8 Literatur 237 Teil II: Fachdidaktische Überlegungen Vorwort des Herausgebers der Reihe IX Einleitung 1 1 Fächer, Fachdidaktiken, einseitige Vorstellungen vom Lernen und der Bildungsauftrag der Schule 4 1.1 Der Wandel des Bildungsbegriffes - der Wandel der Fächer 5 1.2 Exkurs: „Selbst" ist nicht gleich „selbst" - Missverständnisse, Irreführungen und falsche Folgerungen in Bezug auf „Lernen" 9 1.2.1 Selbstgesteuertes und selbstreguliertes Lernen - Innen- oder Außensteuerung? 11 1.2.2 Selbststeuerung und Selbstregulierung - durch Fremdsteuerung und Fremdregulierung? 14 1.2.3 Selbstgesteuertes und selbstreguliertes Lernen - intrinsische, extrinsische oder interessengeleitete Motivation? 15 1.2.4 Selbstgesteuertes und selbstreguliertes Lernen - bewusstes, unbewusstes oder intuitives Ausbilden von Kompetenzen? 18 1.2.5 Selbstgesteuertes und selbstreguliertes Lernen - bewusstes Trainieren oder prozessuales Ausbilden von Strategien? 22 1.2.6 Selbstgesteuertes und selbstreguliertes Lernen - implizites, explizites oder inzidentelles Lernen? 23 1.2.7 Selbstgesteuertes und selbstreguliertes Lernen - Einüben von Lehrstoff oder integriertes Ausüben von Lerninteressen? 26 1.2.8 Selbstgesteuertes und selbstreguliertes Lernen - Kompetenzerwerb statt trägem Wissen? 28 1.3 Der Beitrag der Fächer zur schulischen Bildung 30 1.4 Offener Unterricht ist fachliche und überfachliche Bildung 33 2 Überfachliche Grundsätze der Unterrichtsgestaltung 36 2.1 Organisatorische Offenheit: Öffnung von Raum, Zeit und Sozialformen 39 2.1.1 Öffnung des Raumes 39 2.1.2 Öffnung der Zeit und der Sozialformen 41 2.2 Methodische, inhaltliche und soziale Öffnung: Öffnung der Arbeitsmethoden, Arbeitsmaterialien und Institutionen des Unterrichts 43 2.2.1 Vom Arbeitsmittel zur Eigenproduktion 43 2.2.2 Vom Strategietraining zum methodischen Ideenpool 44 2.2.3 Der Sitzkreis: Demokratie, Gemeinschaft und "Lernen hochhalten" 47 2.3 Und weiter zur Fachdidaktik 49 3 Sprachunterricht 51 3.1 Ausgangsbedingungen für die Schreib- und Leseentwicklung 52 3.2 Anfangsunterricht 55 3.2.1 Anfangswerkzeug Buchstabentabelle 56 3.2.2 Exkurs: Kriterien zur Erstellung eigener Buchstabentabellen 59 3.2.3 Schreiben mit der Buchstabentabelle 63 3.2.4 Buchstaben schreibt man so wie man möchte 65 3.2.5 Eine eigene Handschrift entwickelt man selbst 66 3.3 Frei Schreiben tarrn muss man von Anfang an 69 3.4 Exkurs: Freies Schreiben und Schreibkonferenzen 74 3.5 Feste Kriterien für die Aufsatzerziehung? 77 3.6 Rechtschreiben sicher lernen 80 3.6.1 Rechtschreiben sicher lernen - durch Fehler 81 3.6.2 Rechtschreiben sicher lernen - durch intuitives Schreiben ohne Störungen von außen 85 3.6.3 Rechtschreiben sicher lernen - ohne Grundwortschatz und Sprachbuchregeln 87 3.6.4 Rechtschreiben sicher lernen - Eigenaktivität herausfordern anstatt Teilleistungen zu üben 90 3.6.5 Rechtschreiben sicher lernen - „Sprachforscher"-Werkzeuge statt Sprachbüchern und Rechtschreibkarteien 92 3.6.6 Ein Modell für einen integrierten Rechtschreibunterricht 96 3.6.7 Rechtschreibleistung sicher einschätzen 98 3.7 Lesen und Lesenlernen 104 3.8 Grammatikunterricht oder Sprache untersuchen? 109 3.9 Mündlicher Sprachgebrauch 112 3.10 Fazit für den Sprachunterricht 113 4 Mathematikunterricht 116 4.1 Ziele und Möglichkeiten des Mathematikunterrichts 118 4.1.1 Mathematikunterricht zwischen Anwendungs- und Strukturorientierung 118 4.1.2 Wie offen kann Mathematikunterricht sein? 121 4.2 Ausgangsbedingungen für die mathematische Entwicklung 126 4.3 Offener Mathematikunterricht - von der Mathefibel zur Eigenproduktion 131 4.3.1 Lehrwerke im Spannungsfeld zwischen Reform und Tradition 131 4.3.2 Offener Mathematikunterricht von Anfang an - mit Fehlern 133 4.4 Inhaltliche Überlegungen zum Mathematikunterricht 137 4.4.1 Kernideen und zentrale Inhalte der Mathematik 138 4.4.2 Veränderter Umgang mit dem Stellenwert der Rechenverfahren 142 4.5 Werkzeuge und Praxishilfen 147 4.5.1 Zahlenalbum, Roter Faden und Matheforscherbuch 147 4.5.2 Veranschaulichungsmittel 152 4.5.3 Üben, Übungsformate und Übungsmaterial im Mathematikunterricht 159 4.5.4 Übergänge vom halbschriftlichen zum schriftlichen Rechnen 163 4.6 Vom Geometrie-, Größen- und Sachrechenunterricht zur mathematischen „Anwendung" 169 4.6.1 Projekte als Basis für die zum Handeln anregende Auseinandersetzung mit Sachen und Größen 179 4.6.2 Sachtexte als Basis für die zum Stauen anregende Auseinandersetzung mit Sachen und Größen 181 4.6.3 Freie Rechengeschichten als Basis für die zum Forschen anregende Auseinandersetzung mit Sachen und Größen 181 4.6.4 Forscherfragen als Basis für die zum Problemlösen anregende Auseinandersetzung mit Sachen und Größen 183 4.7 Exkurs: Offener Mathematikunterricht - Rechenkonferenzen anderer Art 185 4.8 Leistungsmessung beim Rechnen durch Überforderung 189 5 Sachunterricht 194 5.1 Vom Sachunterricht zur Welterkundung 194 5.2 Veränderte Ausgangsbedingungen, Inhalte und Zielsetzungen im Sachunterricht 196 5.2.1 Sachunterricht zwischen Fach-und Verfahrensorientierung 197 5.2.2 Ausgangsbedingungen für die sachunterrichtliche Entwicklung 199 5.2.3 Inhalts-und Verfahrensorientierung vom Kinde aus 201 5.3 Für eine Didaktik der Handlungsbefähigung 204 5.3.1 Von der Handlungsorientierung zur Handlungsbefähigung 204 5.3.2 Von der Lernstandserhebung zur Fragekultur 205 5.3.3 Von der Lehrerdemonstration zum Freien Forschen 210 5.3.4 Von der Angebotsvorgabe zur offenen Projektkultur 212 5.3.5 Von der Arbeitsblattdidaktik zur medienkompetenten Vortragskultur 215 5.3.6 Vom Arbeitsmittellager zur eigenständigen Medienaufbereitung 218 5.3.7 Vom festen Stoffkanon zu den Zielen im Hinterkopf 220 5.4 Leistungsbewertung im Sachunterricht 222 6 Vom fächerübergreifenden Sachunterricht zum integrativen Offenen Unterricht 226 6.1 Erste Ideen zur Integration von Kunst und Musik in den Offenen Unterricht 228 6.2 Erste Ideen zur Integration von Sport, Religion und Begegnungssprachen 231 6.3 Medienerziehung und Computer 240 7 FAQ - Frequently Asked Questions zum Offenen Unterricht 246 7.1 Individualisiertes, selbstgesteuertes und interessegeleitetes Lernen 246 7.1.1 Wenn die Kinder in der Schule „machen können, was sie wollen", machen sie denn nicht immer dasselbe oder das, was sie schon längst können? 246 7.1.2 Woher bekommen die Kinder denn ohne Unterricht und Lehrgang ihre Arbeitsideen? 247 7.1.3 Gibt es nicht bestimmte Inhalte, mit denen die Kinder sich nur durch den Impuls des Lehrers auseinandersetzen? 248 7.1.4 Gibt es denn dann gar keinen herkömmlichen Unterricht mit Einführungen, Übungen usw. mehr? 248 7.1.5 Was ist denn mit Kindern, die dann in einem Fach überhaupt nichts machen? 249 7.1.6 Ist Offener Unterricht nicht nur etwas für starke Schüler - gehen schwache Schüler dort nicht unter? 250 7.1.7 MUSS es neben dem individualisierten Lernen nicht auch gemeinsame Phasen / Gemeinschaftserlebnisse geben? 252 7.2 Lehrersein im Offenen Unterricht 253 7.2.1 Wie behält der Lehrer den Überblick, wenn alle etwas Verschiedenes machen? 253 7.2.2 Wie kann man die Kinder beurteilen, wenn alle etwas anderes machen? 254 7.2.3 Ist denn der Offene Unterricht für den „normalen" Lehrer überhaupt leistbar? 255 7.3 Eltern und Kollegen 256 7.3.1 Wie soll ich meinen Offenen Unterricht gegenüber Eltern und Kollegen rechtfertigen? 256 7.4 Übergang 259 7.4.1 Wie kommen denn die Kinder auf der weiterführende Schule klar? 259 7.4.2 Ist der Übergang auf die weiterführenden Schule nicht ein Schock für die Kinder? 259 7.4.3 Können sich die Kinder in der weiterführenden Schule anpassen? 260 7.4.4 Fehlen den Kindern nicht in der weiterführenden Schule wichtige Inhalte? 261 8 Schlussbemerkung: Das Lernen hochhalten 262 9 Literatur 270 Weitere Titel aus der Reihe Basiswissen Grundschule |
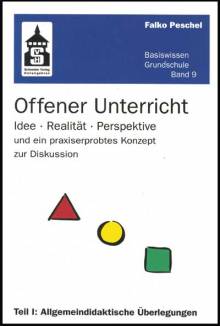
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen