|
|
|
Umschlagtext
Die vorliegende Einführung gehört zu den Standardlehrwerken der Deutschdidaktik. In der nun völlig neu bearbeiteten und erweiterten 5. Auflage wird die Teildisziplin der Literaturdidaktik auf dem neuesten Stand präsentiert.
Das Buch begründet die Aufgaben des Literaturunterrichts und stellt kritisch methodische Konzepte für den Umgang mit literarischen Texten dar. Die Autoren gehen von einem weiten Literaturbegriff aus und entwickeln damit ein kulturwissenschaftliches und medienintegratives Verständnis von Literaturdidaktik. Die Bandbreite der behandelten Unterrichtsgegenstände reicht vom literarischen „Kanon“ über Texte der Kinder-/Jugend- und Unterhaltungsliteratur, Hörstücke, performative Darbietungen und grafische Literatur bis zu Filmen und digitaler Literatur. Aktuelle Entwicklungen spiegeln sich u.a. in der Aufnahme eines eigenen Abschnitts über digitale Spiele sowie Überlegungen zum Umgang mit Künstlicher Intelligenz im Literaturunterricht. Auch unterrichtspraktische Fragen finden nach wie vor breite Antworten, z.B. mit Entscheidungshilfen für Unterrichtskonzepte oder Hinweisen zur Einschätzung und Bewertung von Schülerleistungen. Damit wendet sich diese Einführung an Studierende in allen Phasen des Lehramtsstudiums, an Referendarinnen und Referendare, aber auch an bereits praktizierende Lehrkräfte sowie Ausbilder/-innen. Rezension
Erstmals 2005 erschienen, gehört die vorliegende Einführung zu den Standardlehrwerken der Deutschdidaktik. Die Litarturdidaktik Deutsch ist ein Unterthema der Deutschdidaktik, die - nach Schularten gegliedert - mindestens aus Sprachdidaktik, Mediendidaktik und Literaturdidaktik besteht. Zur Literaturdidaktik gehören Themen wie: Literarische Texte lesen lernen, Lesesozialisation, Kinder- und Jugendliteratur, Epische Texte und ihre Didaktik, Lyrische Texte und ihre Didaktik, Dramendidaktik, Gebrauchstexte und ihre Didaktik etc. In dieser völlig neu bearbeiteten und ergänzten 5. Auflage 2025 wird die Teildisziplin der Literaturdidaktik auf dem neuesten Stand präsentiert und weiterführend diskutiert. Diese Einführung setzt dabei ein kulturwissenschaftliches und medienintegratives Verständnis von Literaturdidaktik voraus. Aktuelle Entwicklungen spiegeln sich z.B. in der Aufnahme eines eigenen Abschnitts über Comics und Graphic Novels.
Dieter Bach, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
GRUNDLAGEN DER GERMANISTIK Herausgegeben von Christine Lubkoll, Ulrich Schmitz, Martina Wagner-Egelhaaf und Klaus-Peter Wegera Band 42 Inhaltsverzeichnis
Einleitung 9
1. Literaturdidaktisches Fundament 11 1.1 Literaturdidaktik als eingreifende Kulturwissenschaft 11 1.2 Handlungsfeld Literatur: individuelle, soziale und kulturelle Bedeutsamkeit - das Grundmodell 19 1.2.1 Individuelle Bedeutsamkeit 20 1.2.2 Soziale Bedeutsamkeit 21 1.2.3 Kulturelle Bedeutsamkeit 23 1.2.4 Individuation, Sozialisation und Enkulturation im Handlungsfeld Literatur 25 1.3 Literatur im Kontext von Anthropologie und Mediengeschichte 27 1.4 Literatur(en) im Kontext der Literaturdidaktik 33 1.4.1 Literarische und nichtliterarische Texte 33 1.4.2 Poetizität und literarische Werturteile 35 1.4.3 Deutschsprachige und Weltliteratur 36 1.4.4 Übersetzte Literatur 39 1.4.5 Mediale Reichweite eines Literaturbegriffs für den Deutschunterricht 40 1.5 Literatur im Kontext von Inter- bzw. Transkulturalität und Inklusion 44 1.5.1 Inter-/transkultureller Literaturunterricht 44 1.5.2 Literarisches Lernen in inklusiven Lerngruppen 47 1.6 Grundbegriffe der Fachdiskurse im literarischen Feld: Gattungen, Epochen, Interpretationszugänge 50 1.6.1 Gattungen, Genres, Formate 50 1.6.2 Epochen 54 1.6.3 Erschließungs- und Interpretationsmethoden aus literaturdidaktischer Perspektive 59 1.6.4 Interpretation im Zeichen von Intertextualität und Mehrdeutigkeit 62 Zusammenfassung von Kapitel 1 65 2. Grundlegende Aufgaben des Literaturunterrichts 67 2.1 Unterstützung von Individuation, Sozialisation und Enkulturation 67 2.1.1 Zum Kompetenzbegriff 67 2.1.2 Literarästhetische Produktionskompetenz 74 2.1.3 Literarästhetische Rezeptionskompetenz 78 2.1.4 Spannungen zwischen individueller, sozialer und kultureller Teilhabe am Handlungsfeld Literatur 85 2.1.5 Medienkompetenz und literarische Kompetenz 89 2.2 Leseförderung 90 2.2.1 Sinn und Zweck von Leseförderung 90 2.2.2 Lesealtertheorie 94 2.2.3 Lesesozialisation und -förderung im Vorschulbereich 94 2.2.4 Konzepte der Leseförderung 96 2.2.5 Lesesozialisation und -förderung auf der Primarstufe 98 2.2.6 Lesesozialisation und -förderung auf den Sekundarstufen 101 2.2.7 Leseförderung jenseits der Schulbildung 104 2.3 Literarisches Lernen und Literarische Bildung 104 2.3.1 Literarische Bildung und die Kanonfrage 105 2.3.2 Literarisches Lernen 109 2.3.3 Anschlusskommunikation als Basiskompetenz für literarisches Lernen und literarische Bildung 115 2.4 Sprach- und Medienreflexion 116 Zusammenfassung von Kapitel 2 121 3. Konzepte für den Literaturunterricht 123 3.1 Fächerintegrative Konzepte: Literatur in fächerübergreifenden Lehr-/Lernkontexten 123 3.2 Lernbereichsintegrative Konzepte: Literatur in einem „offenen" Deutschunterricht 126 3.2.1 Literarische Texte im Gesprächsunterricht und als Vorgaben für szenische Verfahren 127 3.2.2 Literatur im Schreibunterricht 130 3.2.3 Schreiben im Literaturunterricht 132 3.2.4 Literatur im Grammatikunterricht und zur Förderung von Sprachbewusstheit 133 3.3 Domänenspezifischer Kompetenzbereich „Mit Texten und anderen Medien umgehen" 135 3.4 Gegenstandsspezifische Konzepte: Subsysteme und Literatur(en) in unterschiedlicher Medialität 137 3.4.1 Konzepte zum Unterricht mit Kinder- und Jugendmedien 137 3.4.2 Konzepte zum Lyrikunterricht 144 3.4.3 Konzepte zur erzählenden Literatur im Unterricht 154 3.4.4 Konzepte zum Drama im Unterricht 158 3.4.5 Konzepte zur Hörliteratur im Unterricht 164 3.4.6 Konzepte zu (narrativen) Filmen im Unterricht 170 3.4.7 Konzepte zu Comics im Unterricht 185 3.4.8 Konzepte zu Inter(re)aktiver Digitalliteratur — Games 191 Zusammenfassung von Kapitel 3 198 4. Muster, Phasen und Verfahren des Literaturunterrichts 199 4.1 Inszenierungsmuster für Literaturunterricht: Einzelstunde, Sequenzbildung und Reihenplanung, Projektunterricht 199 4.1.1 Inszenierung von Literaturunterricht 199 4.1.2 Reichweiten von Inszenierungsmustern 201 4.1.3 Inszenierungsmuster in der Schule und kulturelle Praxis Literatur 202 4.2 Phasenmodelle für die Organisation von Literaturunterricht 205 4.2.1 Mikromodelle 206 4.2.2 Makromodelle 211 4.3 Verfahren der Texterschließung 211 4.3.1 Inhaltssichernde Verfahren 212 4.3.2 Textnahe Erschließungsverfahren 215 4.3.3 Szenische Verfahren 218 4.3.4 Diskursive Verfahren der Texterschließung 220 4.4 Verfahren der Interpretation 227 4.4.1 Nichtschriftliche Verfahren der Interpretation 228 4.4.2 Schriftliche Verfahren 232 4.5 Kontrastive Verfahren 237 4.6 Verfahren zur Förderung der Lesekultur 241 4.7 Verfahren der Lektüreauswahl und Literaturkritik 248 4.7.1 Lektüreauswahl als literarisches Lernen 248 4.7.2 Urteilsbildung in Bezug auf literarische Texte 249 4.7.3 Literarische Wertung in kulturwissenschaftlicher Sicht — operative und verbale Wertung 250 4.7.4 Lehr- und Lernbarkeit des Urteilens und Wertens im Literaturunterricht 252 4.8 Verfahren und Probleme der Leistungsbewertung 253 4.8.1 Vorbehalte gegen Bewertung und Benotung von Äußerungen im Literaturunterricht 253 4.8.2 Die Problematik von Bewertungskriterien 255 4.8.3 Beurteilung und Benotung als Teil eines Dialogs zwischen Lehrenden und Lernenden 256 4.9 Aufgabenkulturen im Literaturunterricht 257 Zusammenfassung von Kapitel 4 264 5. Empirische Forschungsmethoden der Literaturdidaktik 265 5.1 Vorbemerkung 265 5.2 Forschungsvorgehen 265 5.3 Quantitative Studien 266 5.3.1 Deskriptive Auswertung 269 5.3.2 Interferenzstatistische Auswertung 270 5.3.3 Testverfahren 272 5.4 Qualitative Studien 273 5.4.1 Qualitative Untersuchungsdesigns und Datenerhebung 274 5.4.2 Qualitative Auswertungsverfahren 279 5.5 Design (Based) Research 281 Zusammenfassung von Kapitel 5 284 6. Literaturverzeichnis 285 7. Stichwortverzeichnis 335 Weitere Titel aus der Reihe Grundlagen der Germanistik (GrG) |
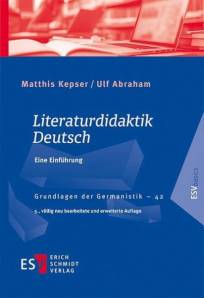
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen