|
|
|
Umschlagtext
Mit dem Ziel der Entwicklung einer inklusiven Schule sind vielfältige Herausforderungen verbunden.
Dieser Band stellt eine Reflexionsgrundlage sowohl für die Theorie als auch die Praxis schulischer Inklusion her und greift Fragen gesellschaftlicher, institutioneller und unterrichtlicher Gestaltungsmöglichkeiten einer inklusiven Schule auf. Die Beiträge reflektieren Inklusion aus unterschiedlichen erziehungswissenschaftlichen Blickwinkeln heraus, wie z.B. der Interkulturellen, der Gender- und der Behindertenpädagogik. Sie zeigen Perspektiven eines erziehungs- und bildungswissenschaftlichen Diskurses auf, der auf die Herausforderungen der Gestaltung einer inklusiven Schule reagiert und damit eine Folie für die zukünftige Diskussion eröffnet. Rezension
»Die ›Inklusive‹ Schule könnte eine Bedingung der Möglichkeit sein, die bei uns vorherrschenden Bilder von Schule, Unterricht und Kindern international anschlussfähig so zu verändern, dass wir bereit und in der Lage sind, allen Kindern im gesamten Heterogenitätsspektrum differenzierende Bedingungen für nächste, erfolgreiche Lernschritte auf dem Weg in eine erfolgreiche Bildungskarriere zu schaffen: Es ist der wertschätzende und unterstützende Umgang mit den individuellen Aneignungsaktivitäten auf jedem Entwicklungsniveau und unter allen Bedingungen ohne Deklassierung, Selektionsbedrohung und Chancenbeschneidung.« (Karl Dieter Schuck, Zwei-Säulen-Modell: Schritt in die falsche Richtung?, in: Hamburg macht Schule 4,2007, S.8-9: 9) Mit diesem Zitat wird von den Autor/inn/en dieses Bands zur inklusiven Schule nicht nur der Autor geehrt, sondern auch das Programm des Buches insgesamt umrissen. Insbesondere Wissenschaftler/-innen der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät der Universität Hamburg äußern sich in diesem Sammelband zu der Frage nach aktuellen Herausforderungen der Gestaltung einer inklusiven Schule.
Dieter Bach, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Schlagworte: Inklusion, Schulentwicklung, Heterogenität, Benachteiligung und Gesellschaft Adressaten: Erziehungs- und Bildungswissenschaft, Bildungssoziologie Joachim Schwohl ist Lehrkraft für besondere Aufgaben im Arbeitsbereich Behindertenpädagogik an der Fakultät Erziehungswissenschaften, Psychologie und Bewegungswissenschaften der Universität Hamburg. Seine Forschungs- und Lehrschwerpunkte sind Integrations- und Inklusionspädagogik und Diagnostik bei Kindern mit Lern- und Verhaltensproblemen. Tanja Sturm (Dr. phil.), Assistenzprofessorin für Schulentwicklung und qualitative Forschungsmethoden an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, ist derzeit Vertretungsprofessorin für Erziehungswissenschaft unter besonderer Berücksichtigung der Sonderpädagogik mit dem Schwerpunkt Lernen und inklusive Pädagogik an der Universität Hamburg. Ihre Forschungsschwerpunkte sind unterrichtliche Heterogenitäts- und Homogenitätskonstruktionen, inklusive Schulentwicklung und Umgang mit Differenzen im Bildungssystem. WWW: Sturm WWW: Schwohl Inhaltsverzeichnis
Vorwort | 9
Inklusion als Herausforderung schulischer Entwicklung. Eine Einführung Joachim Schwohl und Tanja Sturm | 13 1 INKLUSION ALS ERZIEHUNGS- UND BILDUNGSWISSENSCHAFTLICHES THEMA »Inclusive Education« – Desiderata in der deutschen Fachdiskussion Birgit Herz | 29 Eine Schule für alle – eine Gesellschaft für alle? Helmut Richter | 45 Inklusion – Hinweise zur Verortung des Begriffs im Rahmen der internationalen politischen und sozialwissenschaftlichen Debatte um Menschenrechte, Bildungschancen und soziale Ungleichheit Iris Beck und Sven Degenhardt | 55 2 INKLUSION UND SOZIALRÄUMLICHE DIFFERENZEN Heterogenität und Homogenität an Hamburger Schulen – Besichtigung der Normalität Norbert Maritzen und Tanja Sturm | 85 Eine Schule für alle in der deutschen Großstadt mit der schärfsten Polarisierung von Reichtum und Armut – Fakten, Probleme und Herausforderungen Wulf Rauer | 103 Die Schule für alle – überall? Rückfragen zum Hamburger Schulversuch »Integrative Grundschule im sozialen Brennpunkt« Joachim Schroeder | 119 3 INKLUSION UND HETEROGENITÄT Differenzskonstruktionen im Kontext unterrichtlicher Praktiken Tanja Sturm | 141 Eine Schule für alle – aber getrennte Bereiche für Mädchen und Jungen? Hannelore Faulstich-Wieland und Barbara Scholand | 159 Kooperative Bildung im Schulalltag – Zur Notwendigkeit von heterogenen Unterrichtsformen mit Schülerinnen und Schülern mit einer schwersten Behinderung Wolfgang Praschak | 179 Religionsunterricht für alle in einer Schule für alle. Inklusion statt Separation Wolfram Weiße | 193 Auf dem Weg zu einer neuen Sprachbildung für alle – Das Modellprogramm FÖRMIG Ingrid Gogolin | 211 Frühförderung im Kontext der sprachlichen Entwicklung des Kindes Alfons Welling | 229 4 INKLUSION UND SCHULENTWICKLUNG Schuleffektivität, Pluralität und soziale Gerechtigkeit. Spannungen und Widersprüche gegenwärtiger Qualitätsstrategien im Bildungssystem Mechtild Gomolla | 243 Inklusive Schulen entwickeln. Wie helfen Daten aus Lernstandserhebungen? Eva Arnold | 277 Inklusive Schule braucht Unterstützung(ssysteme) Waldtraut Rath und Christine Pluhar | 293 5 INKLUSION UND DER BLICK AUF ENTWICKLUNGEN Ansätze einer (behinderten-)pädagogischen Diagnostik in einer inklusiven Schule Gabriele Ricken | 315 Entwicklungsbewertung und Inklusion André F. Zimpel | 333 Die Autorinnen und Autoren | 355 Leseprobe: Inklusion als Herausforderung schulischer Entwicklung Eine Einführung Joachim Schwohl und Tanja Sturm Inklusion, so die leitende Grundannahme dieses Buches, fordert die Institution Schule heraus. Die Herausforderungen, so unsere Annahme weiter, sind grundsätzlicher Art, d.h., sie betreff en die gesamte Institution; gehen also über oberfl ächliche Veränderungen hinaus und laden dazu ein, die Schule in ihren Grundformen zu hinterfragen. Historisch gewachsene Strukturen und kulturell geprägte Vorstellung des deutschen Schulsystems werden durch die politisch formulierte und erziehungs- und bildungswissenschaftlich unterstützte Aufgabe, eine inklusive Schule zu gestalten, infrage gestellt. Davon sind alle Ebenen der Schule betroff en: die der schulischen Struktur, die der Einzelschule und die des Unterrichts. Für alle drei Ebenen sind unterschiedliche Zuständigkeiten und Kooperationen notwendig, um inklusive Veränderungen und Entwicklungen zu initiieren und zu etablieren, auf dem Weg der Annäherung an das Ziel, zu dem sich Deutschland und die Europäische Union durch die Ratifi zierung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen verpfl ichtet haben: eine Schule für alle zu schaff en und verantwortungsvoll zu gestalten (vgl. UN 2006; 2008). In der Konvention, die den rechtlichen Aufhänger des Ziels einer inklusiven Schule darstellt, heißt es im § 24, der die Fragen von Bildung und Schule bearbeitet: »Um dieses Recht ohne Diskriminierung und auf der Grundlage der Chancengleichheit zu verwirklichen, gewährleisten die Vertragsstaaten ein integratives Bildungssystem auf allen Ebenen und le14 JOACHIM SCHWOHL UND TANJA STURM benslanges Lernen […].« (§ 24) Die Behindertenrechtskonvention gilt, auch wenn ihr Name anderes vermuten lässt, für alle Menschen, d.h., sie stellt nicht partikulare Interessen heraus. Vielmehr beschreibt sie, als Teil der Allgemeinen Menschenrechte, diese aus der Perspektive und dem Erfahrungshintergrund von Menschen mit Behinderungen. Als solche stellt sie eine Gelegenheit dar und bietet die Möglichkeit zur Diff erenzierung und Ergänzung der universellen Menschenrechte (vgl. Bielefeldt 2010: 66). Bremen hat als erstes Bundesland die Entwicklung einer inklusiven Schule in sein Schulgesetz aufgenommen. Dort heißt es in der Fassung des Schulgesetzes vom Juni 2009 im § 3: »Bremische Schulen haben den Auftrag, sich zu inklusiven Schulen zu entwickeln. Sie sollen im Rahmen ihres Erziehungs- und Bildungsauftrages die Inklusion aller Schülerinnen und Schüler unabhängig von ihrer ethnischen Herkunft, ihrer Staatsbürgerschaft, Religion oder einer Beeinträchtigung in das gesellschaftliche Leben und die schulische Gemeinschaft befördern und Ausgrenzungen einzelner vermeiden.« (Bremen, 2009) In den Vorstellungen zum Aufbau einer inklusiven Schule im Bremer Schulgesetz fi ndet sich ein Diskurs wieder, der in den Erziehungs- und Bildungswissenschaften und in der Schulpädagogik – wenn bisher auch noch weniger aufeinander bezogen – geführt wird. Überlegungen zur Gestaltung einer inklusiven Pädagogik im Kontext einer inklusiven Schule sind bisher überwiegend in der Behinderten- und Integrationspädagogik geführt worden (vgl. Hinz 2009, Wocken 2009). Die seit den 1980er Jahren geführte Diskussion integrativer Beschulungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf scheint auf den ersten Blick der Vorläufer zur Entwicklung einer Schule für alle. Ein zentraler Unterschied zwischen dem integrativen und dem inklusiven Diskurs besteht jedoch darin, dass der um eine Schule für alle – so wird es auch im Bremer Schulgesetz formuliert – nicht ausschließlich eine im Schulsystem verankerte Trenn- und Exklusionslinie in den Blick nimmt. Mit einer derart einseitigen Betrachtung wäre das Risiko verbunden, »partikulare und gruppenkategorial ausgerichtete Anteile« (Hinz 2009: 173) in den Blick zu nehmen und andere, im Schulsystem sowie in der Gesellschaft (re-)produzierte Ungleichheiten, die entlang anderer sozialer Kategorien legitimiert werden, auszublenden. INKLUSION ALS HERAUSFORDERUNG SCHULISCHER ENTWICKLUNG 15 Gemeinsam ist in den unterschiedlichen erziehungs- und bildungswissenschaftlichen Diskursen, die sich mit Ausgrenzungsprozessen im Kontext von Schule und Unterricht auseinandersetzen, die Annahme, dass eine dichotome Zuschreibung von Diff erenzkategorien als zu überwinden angesehen wird (vgl. z.B. Faulstich-Wieland/Weber/Willems 2004, Gomolla 2005, Sturm 2010). Ziel ist die Überwindung solcher binären Zuschreibungsformen, bezogen auf sozial konstruierte Kategorien, die üblicherweise mit einer hierarchischen Relation der Ausformungen einhergehen und so mehr oder weniger off ensichtlich und legitimiert die Benachteiligung und/oder Diskriminierung einer der Gruppen zur Folge hat. Die Gemeinsamkeit der größtenteils entlang der jeweils betrachteten sozialen Kategorie geführten Diskurse liegt darin, die schulischen und unterrichtlichen Herstellungsformen der Kategorie in den Blick zu nehmen, sie zu erkennen und Perspektiven ihrer Überwindung aufzuwerfen. Mit anderen Worten, es werden behindernde und ermöglichende Formen und Prozesse der Teilhabe an unterrichtlichen und schulischen Bildungs- und Erziehungsprozessen betrachtet. Zudem werden darin die erziehungswissenschaftliche Disziplin und ihre Teildisziplinen herausgefordert, Gemeinsamkeiten ihrer Erkenntnisse herauszuarbeiten und Diff erenzen zu refl ektieren, indem die unterschiedlichen Dimensionen überwunden werden, ohne ein Plädoyer für die Abschaff ung spezifi schen Wissens halten zu wollen. Ein weiterer durch die Aufgabe der Inklusion herausgeforderter erziehungswissenschaftlicher Diskursstrang ist die Schulentwicklung. Als erziehungs- und bildungswissenschaftliche Teildisziplin setzt sie sich mit Fragen der Unterstützung und Gestaltung schulischer und unterrichtlicher Veränderungsprozesse auseinander. Ein zentrales Thema stellt ein veränderter Umgang mit der Heterogenität der Schülerschaft dar, der die Schulentwicklung herausfordert (vgl. Altrichter/Hauser 2007, Baumert 2002). Die Überlegungen schulischer Entwicklung sind durch die Gestaltungsaufgabe einer inklusiven Schule herausgefordert, einen konkreten Inhalt im Kontext ihrer Veränderungsstrategien mitzudenken. Die politisch gestellte Aufgabe ist die Gestaltung einer inklusiven Schule, in der es im Kern um eine Konzeption geht, die niemanden ausschließt, ja, einen Ausschluss gar nicht in Betracht ziehen kann, da sie sich an der Maxime orientiert, eine Schule zu gestalten, die inklusiv ist, und nicht nach Möglichkeiten sucht, Kinder und Jugendliche, in diese Schule zu inkludieren. Mit Karl Dieter Schuck (2001) kann und soll in diesem Band ge16 JOACHIM SCHWOHL UND TANJA STURM fragt werden, welche Vorstellungen von Bildung, Erziehung, Lernen und Entwicklung einer derartigen Schule für alle zugrunde liegen sollen. Die Schule in Deutschland, der im internationalen Vergleich eine hohe Selektivität bescheinigt wird, ist von der Illusion durchzogen, dass homogene Lerngruppen nach allen Regeln der fachlichen Kunst herzustellen sind. Dies zeigt sich auf der Ebene der Schulstruktur: eine mehrgliedrige Struktur – wenn auch durch strukturelle Veränderungen in einzelnen Bundesländern politisch infrage gestellt – stellt eines der Charakteristika der deutschen Schule dar. Veränderungen auf dieser Ebene sind wesentlich politischer Art und können, wie das Beispiel Hamburgs zeigt, zu einem Politikum genutzt werden. Es sind also Politik und Gesellschaft aufgefordert, die notwendigen Rahmenbedingungen für die Gestaltung einer inklusiven Schule herzustellen. Hierzu gehört es, all jene Aspekte zu refl ektieren und zu prüfen, die einer solchen Idee im Wege stehen. Hierzu gehören auch Formen der Leistungsmessung und Standardisierung, die Rankings ausschließlich im kognitiven Leistungszuwachs bemessen (vgl. Wedell 2005: 5). Auch die Einzelschule, die im Zentrum aktueller Schulentwicklungsüberlegungen steht, so auch jener, die sich explizit mit der Gestaltung einer inklusiven Schule auseinandersetzen (vgl. z.B. Ainscow 2007, Boban/Hinz 2004), ist herausgefordert, historisch gewachsene Gewohnheiten und Ordnungen zu hinterfragen und neue Modelle zu entwerfen. Hierzu gehört die Idee homogener Jahrgangsklassen ebenso wie die leistungshomogener Klassen, wie sie beispielsweise in Kooperativen Gesamtschulen anzutreff en sind. Der schulkulturelle Umgang mit sozialer Heterogenität und Diff erenzen insgesamt ist zu hinterfragen und auf ermöglichende und behindernde Bedingungen zu prüfen. Der Unterricht, häufi g als schulisches Kerngeschäft bezeichnet, also die Lehr-Lern-Interaktionen zwischen Lehrenden und Schülern/Schülerinnen, ist häufi g auf die Idee der homogenen Lerngruppe zugeschnitten, indem er als »7-G-Unterricht« gestaltet wird: »Die gleichen Schüler lösen beim gleichen Lehrer im gleichen Raum zur gleichen Zeit im gleichen Tempo die gleichen Aufgaben mit dem gleichen Ergebnis« (Scholz 2008: 2). Auch sind die Konzepte und Vorstellungen, die Lehrkräfte von Heterogenität und Homogenität sowie dem unterrichtlichen Umgang mit diesen haben, zu hinterfragen. Petriswskyj weist darauf hin, dass Vorstellungen von Schulreife und/oder zusätzliche fi nanzielle und personelle RessourINKLUSION ALS HERAUSFORDERUNG SCHULISCHER ENTWICKLUNG 17 cen für bestimmte Behinderungen einer inklusiven Unterrichtsgestaltung im Wege stehen (vgl. Petriwskyj 2010). Darauf, dass Lerngruppen, anders als im deutschen Schulsystem angenommen, nur vermeintlich homogen sind bzw. maximal hinsichtlich eines Kriteriums, verwiesen Klafki und Stöcker bereits 1976. Doch auch sie waren nicht die ersten, die auf diesen Zusammenhang hinwiesen: »Die Verschiedenheit der Köpfe ist das große Hindernis aller Schulbildung.« (Johann Friedrich Herbart, in: Rutt 1957: 176) Sie zu würdigen und als Ausgangspunkt der Gestaltung einer Schule für alle zu erkennen und anzuerkennen, ist eine Herausforderung für die gesellschaftliche Institution Schule. Dieses Buch möchte einen Beitrag dazu leisten, die Herausforderungen, die mit der Gestaltung einer inklusiven Schule verbunden sind, aus unterschiedlichen Blickwinkeln und Perspektiven zu betrachten. So wird die Schule in ihrer bisherigen Konzeption infrage gestellt. Gleichzeitig ist die erziehungs- und bildungswissenschaftliche Diskussion herausgefordert – auch hierzu möchte das Buch einen Anstoß geben – den Anspruch einer Pädagogik für alle zu formulieren. So soll jener fachwissenschaftliche Diskurs diff erenziert und gestärkt werden, der sich der Thematik gegenüber verantwortlich fühlt und gesellschaftlich verpfl ichtet ist. Die Buchbeiträge sind fünf unterschiedlichen Abschnitten zugeordnet, in denen jeweils ein Themenbereich im Zentrum steht. Gleichwohl wird deutlich, dass sich zahlreiche ineinandergreifende Aspekte und Anknüpfungspunkte in den jeweils anderen Kapiteln fi nden lassen. Im ersten Kapitel »Inklusion als erziehungs- bzw. bildungswissenschaftliches Thema« wird über die Schulpädagogik hinausgeblickt. Dabei werden zentrale Diskurslinien aufgezeigt. Birgit Herz analysiert aus bildungssoziologischer Perspektive den schulischen Inklusionsdiskurs. In diesem Kontext diff erenziert sie zwischen Inklusionsrhetorik und Inklusionsrealität und verweist auf entsprechende Konsequenzen der Exklusion für Schüler/-innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf in der kognitiven oder der emotionalen und sozialen Entwicklung. Helmut Richter vertritt in seinem Beitrag die These, dass eine Schule für alle nicht ohne eine Gesellschaft für alle zu denken ist. Er legt Widerstände dar, die sich aus der Konstitution einer Konkurrenzgesellschaft ergeben. Um eine Partizipation aller zu erreichen, bedarf es einer umfassenderen Bildungsoff ensive, die über die Betrachtung der Schule hinausgeht. Er schlägt vor, Formen der Ganztagsbildung und der außerschulische Bildung mit einzuschließen. Iris Beck und Sven 18 JOACHIM SCHWOHL UND TANJA STURM Degenhardt erörtern in ihrem Artikel den Inklusionsbegriff vor dem Hintergrund zweier Diskussionslinien. Zum einen wird die Verankerung des Begriff s in internationalen Vereinbarungen und Erklärungen beleuchtet. Zum anderen wird er als Leitbegriff der sozialen Ungleichheitsforschung herangezogen. Der Beitrag gibt Hinweise auf die Verbindung von Inklusion mit politisch-normativen Fragen der Menschenrechte und weltweiten Verteilungskonfl ikten sowie auf die diesbezüglichen sozialwissenschaftlichen Auseinandersetzungen. Gleichzeitig fordert er zu einer Diskussion und Transformation interkultureller und globaler Hintergründe auf, die die deutsche Debatte um Inklusion in Bildung und Erziehung in ihrer Ausrichtung und in der Frage der Umsetzung fruchtbar erweitern. Im zweiten Abschnitt des Buches – »Inklusion und sozialräumliche Diff erenzen« – wird gefragt, wie sich diese Diff erenzen auf die Gestaltung einer inklusiven Schule auswirken. Im ersten Beitrag dieses Abschnitts analysieren Norbert Maritzen und Tanja Sturm Ergebnisse des Hamburger Bildungsmonitorings. Sie schlussfolgern, dass auf den Ebenen von Schulsystem, Einzelschule und Unterricht Formen sozialer Heterogenität bestehen und gleichzeitig Tendenzen von Homogenisierungen zu erkennen sind. Eine Gruppe kann zugleich als homogen und als heterogen betrachtet werden. Dies hängt von der jeweiligen sozialen Kategorie bzw. der Einheit ab, die betrachtet wird. Ist es die milieuspezifi sche Zusammensetzung, die in den Fokus gerückt wird, lässt sich für einige Hamburger Stadtteile nachweisen, dass soziale Disparitäten sich in entsprechenden Leistungen niederschlagen, wodurch unterschiedliche Voraussetzungen für die Gestaltung einer inklusiven Schule in den verschiedenen Stadtteilen entstehen. Auch im Artikel Wulf Rauers bilden die Daten des Hamburger Bildungsmonitorings einen zentralen Bezugspunkt. Am Beispiel dieser deutschen Großstadt wird der Frage nachgegangen, ob eine Schule für alle tatsächlich nachhaltig zur Überwindung der Bildungsbenachteiligung beitragen kann. Angesichts der dramatisch wachsenden Polarisierung von Reichtum und Armut in deutschen Großstädten und des damit verbundenen Auseinanderdriftens der Stadtteile ergeben sich für Kinder und Jugendliche je nach Stadtteil unterschiedliche Aneignungsbedingungen. Pädagogische Maßnahmen innerhalb einer inklusiven Schule können jedoch nur begrenzt prekäre Aneignungsbedingungen kompensieren. Sozialpolitische Maßnahmen, Stadtentwicklungs-, Wohnbau- und Familienpolitik müssen die pädagogischen Maßnahmen begleiten, wenn diese nicht an ihren eigenen Zielen scheitern sollen, so der Autor. Dennoch hat die Pädagogik ihren INKLUSION ALS HERAUSFORDERUNG SCHULISCHER ENTWICKLUNG 19 Beitrag zu leisten. Sie muss sich aber ihrer begrenzten Möglichkeiten bewusst sein, damit sie nicht als illusionär diff amiert wird, so Rauer. Joachim Schroeders Artikel beleuchtet ebenfalls die sozialräumliche Entwicklung. Er legt den Fokus auf zwei Exklusionslinien: Behinderung und soziale Benachteiligung. Für Schroeder bildet der Hamburger Schulversuch »Integrative Grundschule im sozialen Brennpunkt« den Ausgangspunkt für die Erörterung. Er fragt, inwiefern eine Neugestaltung des Unterrichts diesen Dimensionen der schulischen Exklusion entgegenwirken kann. Dabei stellt er »inklusive« und »milieusensible« Konzepte einander gegenüber, die in dem (sonder-)pädagogischen Diskursfeld der Entwicklung von Strategien zur Vermeidung von Bildungsbenachteiligungen konkurrieren. Schroeder plädiert für eine schulische Bildung, die einerseits auf Basis einer Sozialraumanalyse entwickelt wird und andererseits die individuellen Lebenslagen der Schüler/-innen angemessen berücksichtigt. Das dritte Kapitel trägt den Titel »Inklusion und Heterogenität«. Die Ausdiff erenzierung in verschiedene Bereiche der Erziehungswissenschaft entlang sozialer Dimensionen hat einerseits wichtige Erkenntnisse hervorgebracht, andererseits trägt die Fixierung auf ein bestimmtes Merkmal auch zur Konstruktion von Unterschieden bei. Die in diesem Abschnitt subsumierten Beiträge beschäftigen sich mit dem Thema i.d.R. aus der Perspektive einer Heterogenitätsdimension, aber mit dem Ziel weniger das Unterschiedliche als vielmehr das Gemeinsame zu betonen. Der erste Beitrag thematisiert die Frage, wie Diff erenz konstruiert wird. Tanja Sturm stellt in ihrem Beitrag Ergebnisse einer von ihr durchgeführten Untersuchung vor. Gruppendiskussionen mit Lehrkräften hat sie mit dem Ziel geführt, Auskünfte darüber zu bekommen, mit welchen Kriterien Lehrkräfte Unterschiede ihrer Schüler/-innen konstruieren und in ihren praktischen Unterrichtshandlungen realisieren. Dabei kommt Sturm zu dem Schluss, dass Heterogenität häufi g als binäre Zuschreibung verwendet wird. In dem vorgestellten Fall wird Heterogenität von Lehrkräften vor allem in Bezug auf unterschiedliche Leistungsniveaus wahrgenommen, insbesondere dann, wenn diese Auswirkungen auf die eigene Unterrichtsgestaltung hat. Hannelore Faulstich-Wieland und Barbara Scholand beschreiben im anschließenden Artikel explizit eine zentrale Dimension, wenn es darum geht, soziale Unterschiede zu konstruieren. Die Autorinnen betrachten die Debatte um Inklusion aus der Perspektive der erziehungswissenschaftlichen Geschlechterforschung. Während die Idee der Inklusion, ausgehend vom Menschenrecht auf Bildung, eine Schule für alle Kinder fordert, ist 20 JOACHIM SCHWOHL UND TANJA STURM in der schulischen Geschlechterpolitik seit vielen Jahren ein gegenläufi - ger Trend zu beobachten: Unter dem Label der »Geschlechtergerechtigkeit « werden vor allem geschlechtsgetrennte Angebote durchgeführt. Der Aufsatz geht den theoretischen Begründungen für geschlechtsgetrennte Angebote nach und entwickelt eine Perspektive, in der Koedukation und Inklusion zusammen gedacht werden. Wolfgang Praschak setzt sich mit der Heterogenitätsdimension Behinderung auseinander. Er stellt Überlegungen an, welche Auswirkungen die Gestaltung eines inklusiven Schulsystems für die schulische Entwicklungsförderung von sogenannten schwer und mehrfach behinderten Schülern/Schülerinnen hat. Bisher wird – ausgehend von einer vermeintlichen primären Behinderung – versucht, die schulische Förderung der Betroff enen schädigungsspezifi sch zu homogenisieren, so der Autor. Dieser Ordnungsversuch hat jedoch zumeist eine willkürliche und intransparente Aussonderung der Schüler/-innen zur Folge, die die Gefahr mit sich bringt, dass eine Art »Restschule« entsteht. Prakschak vertritt die These, dass eine solche Restschule im Lichte der neueren Inklusionsbestrebungen nicht mehr zu legitimieren ist. Um dieser Gefahr entgegenzutreten, skizziert er ein zweistufi ges Modell, das zunächst die Aufhebung der Ausgrenzung innerhalb der Sonderschulen thematisiert. In einem zweiten Schritt sollen die Betroff enen dann in eine Schule für alle Kinder integriert werden. Für den Unterricht in dieser schlägt Praschak das Prinzip der Elementarisierung der Unterrichtsformen und ihre Flexibilisierung vor. Wolfram Weiße greift eine weitere Heterogenitätsdimension auf. Mit der Zugehörigkeit zu einer Kultur kann die Übernahme bestimmter Normen und Werte, die auch religiös beeinfl usst sind, verbunden sein. Vor dem Hintergrund der zunehmenden religiösen Pluralisierung europäischer Gesellschaften vertritt Weiße in seinem Text die These, dass Religionsunterricht in der Schulbildung einen wichtigen Beitrag zur interreligiösen Verständigung innerhalb von Lerngruppen sowie auch zur friedlichen Koexistenz verschiedener Gruppierungen in der Gesellschaft leisten kann. Anhand empirischer Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt REDCo (Religion in Education. Contribution to Dialogue or Factor of Confl ict in transforming societies of European Countries) zu den Einstellungen Jugendlicher aus acht europäischen Ländern zeigt Weiße eine große Aufgeschlossenheit der Teenager gegenüber religiöser Heterogenität auf. Dies bestätigt den hohen Stellenwert des Religionsunterrichts. Anhand des Hamburger Fallbeispiels »Religionsunterricht für alle« verdeutlicht er, dass insbesondere ein gemeinsam für alle Schüler/-innen INKLUSION ALS HERAUSFORDERUNG SCHULISCHER ENTWICKLUNG 21 erteilter Religionsunterricht ein im Kontext Europas zukunftsweisendes Einübungsfeld für interreligiösen Dialog und damit für eine inklusive Schule sein kann. Ingrid Gogolin attestiert den deutschen Schulen einen monolingualen Sprachhabitus. In nahezu allen deutschen Schulen wird vorausgesetzt, dass die Schüler/-innen in der Lage sind, dem Unterricht, der in den meisten Fächern in der deutschen Sprache abgehalten wird, zu folgen. Für Schüler/-innen mit Migrationshintergrund stellt sich hiermit eine besondere Herausforderung. Trotz verschiedener Bemühungen ist es noch nicht hinreichend gelungen, den Zusammenhang von kultureller Herkunft und Leistungsmöglichkeiten zu entkoppeln. Eine inklusive Schule muss sich auch daran messen lassen, wie es ihr gelingt, zu dieser Entkoppelung beizutragen. Einen Ansatz, wie dies im Rahmen pädagogischer Möglichkeiten gelingen kann, stellt Gogolin in ihrem Artikel anhand des FörMig-Projekts dar. Theoretische Grundlage ist die Erkenntnis, dass eine bildungsspezifi sche Sprache eng mit den Merkmalen der Schriftsprache verknüpft ist. Deswegen geht es weniger um die Entwicklung einer allgemeinen Kommunikationsfähigkeit, als um die Entwicklung einer Bildungssprache. Gogolin plädiert für ein bewusstes Verwenden und Vermitteln von Sprache als Medium von Lernen und Lehren. Sprachförderung muss, so die Autorin, deswegen Aufgabe jeden Unterrichts sein. Sie vertritt die These, dass es um die Entwicklung von Gesamtkonzepten sprachlicher Bildung geht. Zudem muss die sprachliche Bildung in Kooperation mit anderen vorangetrieben werden. Das FörMig-Projekt kann hierfür als ein gelungenes Beispiel angesehen werden. Ähnlich wie Gogolin, die betont, dass häufi g die Schnittstellen von einem Bildungsgang in den nächsten für Kinder mit Migrationshintergrund eine Schwierigkeit darstellen, verweist Alfons Welling auf den schwierigen Eintritt in die Grundschule bei Kindern mit sprachlichen Auff älligkeiten. Diesen Eintritt entsprechend zu gestalten, muss Aufgabe einer inklusiven Schule sein. Zwar können auch in einer inklusiven Schule die Schüler/-innen in ihrer sprachlichen Entwicklung gefördert werden, doch sollte eine Sprachförderung schon früher stattfi nden. Sprachentwicklung muss sich von Anfang an im Kontext mit der Umgebung gemeinsam entwickeln, so Welling. Die frühe Entwicklung des Kindes wird in diesem Beitrag also nicht im Sinne des Verständnisses einer funktionsorientierten, eindimensionalen Förderung des Kindes gesehen. Vielmehr wird betont, dass die Einbeziehung der Eltern des Kindes bzw. des Umfeldes bis hin zu seiner Förderung im Rahmen der Grundschule angestrebt werden muss. 22 JOACHIM SCHWOHL UND TANJA STURM Im vierten Kapitel des Buches – »Inklusion und Schulentwicklung« – werden Aspekte der Schulentwicklung beschrieben und analysiert, wie sie den Prozess zur Entwicklung einer inklusiven Schule befördern oder behindern können. Im Zentrum von Mechtild Gomollas Beitrag steht eine Analyse von Schuleff ektivität als spezifi schem curricularem und pädagogischem Diskurs, der ausgehend von den angelsächsischen Ländern im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts weltweit zunehmend Bedeutung erlangt hat. Dabei fragt sie nach der Angemessenheit dieses rational-technischen Ansatzes im Hinblick auf die Heterogenität von Bildungsvoraussetzungen, Identitäten und Lebenshintergründen von Schülern/Schülerinnen in einer zunehmend fragmentierten sozialen Welt. Sie erörtert, inwiefern und mit welchen Folgen für wen Aspekte der Diversität, Pluralität und sozialen Gerechtigkeit im Schuleff ektivitätsdenken inkorporiert, verzerrt oder ausgeschlossen werden. Vor diesem Hintergrund werden Perspektiven entwickelt, wie die Verbesserung der Qualität von Bildungs- und Erziehungsprozessen mit dem Bemühen um eine inklusive, partizipatorische und sozial gerechte Bildungspraxis verknüpft werden kann. Eva Arnold geht in ihrem Artikel der Frage nach, welchen Beitrag Lernstandserhebungen zur Schul- und Unterrichtsentwicklung leisten können, wenn es darum geht, dem Ziel der inklusiven Schule näherzukommen. Dabei stellt sie Chancen und Risiken dieses Vorgehens einander gegenüber. Grundlage für ihre Ausführungen sind ausgewählte Ergebnisse eines Bremer Schulentwicklungsprojekts, in dem Lernstandserhebungen als Impuls für Schul- und Unterrichtsentwicklung genutzt wurden. Aus den Resultaten der Studie schlussfolgert Arnold, dass die Arbeit mit Lernstandserhebungen im Sinne des Leitziels nützlich sein kann. Vor allem, wenn es gelingt, die Aufmerksamkeit von Lehrkräften und Schülern/Schülerinnen auf individuelle Lernvoraussetzungen und individuell angemessene Lernarrangements zu lenken. Einem anderen Schwerpunkt der Schulentwicklung widmen sich Waltraud Rath und Christine Pluhar. Um den Lernbedürfnissen aller Schüler/-innen in einer inklusiven Schule gerecht zu werden, bedarf es zusätzlicher Unterstützungssysteme, so die leitende These der Autorinnen. Anhand der Entstehungsgeschichte und der aktuellen Ausgestaltung des Landesförderzentrum Sehen in Schleswig ziehen sie Rückschlüsse für die Entwicklung anderer Unterstützungs- und Beratungssysteme. Sie vertreten die These, dass die in Schleswig-Holstein zugrunde gelegten Konzepte übertragen oder für Gruppen von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen anderer Art sinnvoll modifi ziert werden können. Zunächst ist INKLUSION ALS HERAUSFORDERUNG SCHULISCHER ENTWICKLUNG 23 dieses Modell als Verlegenheitslösung oder als Sparmodell betrachtet worden, doch nach mehr als 25 Jahren hat es sich zu einem leistungsfähigen großen Unterstützungs- und Beratungszentrum für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit Blindheit oder Sehbehinderung entwickelt. Der fünfte Abschnitt des Bandes »Inklusion und der Blick auf Entwicklungen « beschäftigt sich mit Fragen der Wahrnehmung und Bewertung von Entwicklungsprozessen in einem inklusiven Schulsystem. In diesem Kontext stellt Gabriele Ricken Aspekte aus dem Bereich der pädagogischen Diagnostik in den Fokus ihrer Betrachtung. Sie vertritt die These, dass sich in einer inklusiven Schule eine Kultur der Angebots-Entwicklungsprozess- Diagnostik entwickeln müsse, um die Lern- und Entwicklungsprozesse der Kinder und Jugendlichen beobachten und bewerten zu können. Ein Umdenken muss insofern stattfi nden, als dass Diagnostik insbesondere bei Schülerinnen und Schülern, die mit größerem Aufwand lernen, eine prozessbegleitende Tagesaufgabe sei. Der pädagogische Förderbedarf ist nicht, wie bisher im sonderpädagogischen Kontext üblich, auf das Kind oder den Jugendlichen und nicht auf einmalige Erhebungen zu begrenzen. Vielmehr muss ein pädagogisch und diagnostisch fl exibler Umgang mit entstandenen Problemlagen in dem jeweiligen Kontext entwickelt werden, so Rickens Plädoyer. André Zimpel stellt Überlegungen der Zuteilung von Schülern/Schülerinnen in entsprechende Schulformen an den Anfang seiner Ausführungen. Unserem jetzigen Schulsystem liegt die Annahme zugrunde, dass sich Kinder mithilfe entsprechender Strategien bestimmten Schulformen zuordnen lassen. Die Grundlage für Schullaufbahnentscheidungen bilden Entwicklungsbeurteilungen und -prognosen, die immer auf irgendeiner Annahme über eine menschliche Entwicklungslogik beruhen. Beurteilungen sind jedoch niemals unabhängig von den Urteilenden. Wird z.B. die Intelligenz einer Person beurteilt, stellt sich sofort die Frage: Wie intelligent ist das Urteil? Zimpel kritisiert damit die Strategien und die aktuelle Praxis der schulischen Selektion. Weil die Zuweisung in bestimmte Bildungsgänge aufgrund der unzureichenden diagnostischen Mittel fehlerhaft ist, fehlt auch die Legitimation für die Selektion. Ein Verzichten auf das Selektieren führt letztlich zu einer inklusiven Schule. Die kurze Vorstellung der Buchbeiträge verdeutlicht, welche Herausforderungen auf dem Weg zu einer inklusiven Schule zu bewältigen sind. Unser Anliegen war und ist es, die Diskurse, die in den unterschiedlichen Teildisziplinen der Erziehungs- und Bildungswissenschaft geführt werden, zusammenzuführen. Vor allem die Frage, wie Bildungsbenachteiligung 24 JOACHIM SCHWOHL UND TANJA STURM abgebaut werden kann, hat uns in der Zusammenstellung der Beiträge motiviert. Die einzelnen Beiträge dokumentieren aus unterschiedlichen Perspektiven Ansatzpunkte, wie Inklusion als Herausforderung schulischer Entwicklung angegangen werden kann. Die Stärke des Buches liegt u.E. nicht nur darin, dass verschiedene Diskurslinien zum Thema der Gestaltung einer inklusiven Schule zusammengeführt werden, sondern auch darin, Überschneidungen in den Diskursen off engelegt zu haben. Wir wünschen uns, dass es aufgrund der aufgezeigten Zusammenhänge zu verstärkten Kooperationen und einer damit verbundenen Weiterentwicklung der erziehungs- und bildungswissenschaftlichen Disziplin kommt. Wenn die Diskurse der jeweiligen Bereiche überhaupt zur Kenntnis genommen werden, dann kommt es im Falle von Überschneidungen und Gemeinsamkeiten, nur selten zu einer kooperativen Zusammenarbeit. So wird beispielsweise in der Behindertenpädagogik zwar zur Kenntnis genommen, wie Lernprobleme mit Mehrsprachigkeit zusammenhängen. Kooperationen zwischen Behindertenpädagogik und interkultureller Pädagogik sind jedoch eher die Ausnahme als die Regel. Eine breitere Kooperation zwischen den Teildisziplinen würde auch die Weiterentwicklung schulpädagogischer Konzepte befördern. Erste Ansätze, die zur Bewältigung der anstehenden Herausforderungen infolge der Ausgestaltung eines inklusiven Schulsystems nötig sind, können wir hier präsentieren. Zudem machen die Autorinnen und Autoren an vielen Stellen ihrer Beiträge deutlich, wie gesellschaftliche Bedingungen Ausgangslagen für schulisches Handeln beeinfl ussen und mit diesem verknüpft sind. Folglich wäre es eine Überforderung, das Gelingen schulischer Inklusion allein davon abhängig zu machen, wie es der Institution mittels pädagogischer Konzepte gelingt, zum Abbau von Bildungsbenachteiligung beizutragen. Wenn die Erziehungs- und Bildungswissenschaft für ein inklusives Schulsystem plädiert, kommt sie deswegen nicht umhin, gesellschaftliche Veränderungen einzufordern. Wir sind der Überzeugung, wichtige Ergebnisse und Überlegungen präsentieren zu können, die dazu beitragen, den Diskurs über die Gestaltung einer inklusiven Schule voranzubringen. INKLUSION ALS HERAUSFORDERUNG SCHULISCHER ENTWICKLUNG 25 LITERATUR Ainscow, Mel (2007): »Taking an Inclusive Turn«, in: Journal of Research in Special Educational Needs 7, S. 3-7. Altrichter, Herbert/Hauser, Bernhard (2007): »Umgang mit Heterogenität lernen«, in: Journal für LehrerInnenbildung 7, S. 4-11. Baumert, Jürgen (2002): »Umgang mit Heterogenität. Ein Gespräch mit Professor Jürgen Baumert«, in: Forum Schule H.1, S. 72-75. Bielefeldt, Heiner (2010): »Menschenrecht auf inklusive Bildung. Der Anspruch der UN-Behindertenrechtskonvention«, in: Vierteljahreszeitschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete 79, S. 66-69. Boban, Ines/Hinz, Andreas (2004): »Der Index für Inklusion – ein Katalysator für demokratische Entwicklung in der ›Schule für alle‹«, in: Heinzel, Friederike/Geiling, Ute (Hg.), Demokratische Perspektiven in der Pädagogik, Wiesbaden: VS Verlag, S. 37-48. Bremen, Freie Hansestadt (2009), Bremer Schulgesetze. URL: www. bildung.bremen.de/fastmedia/13/Fassung1.pdf( 27.03.2010). Faulstich-Wieland, Hannelore/Weber, Martina/Willems, Katharina (2004): Doing Gender im heutigen Schulalltag. Empirische Studien zur sozialen Konstruktion von Geschlecht in schulischen Interaktionen, Weinheim, München: Juventa Verlag. Gomolla, Mechtild (2005): Schulentwicklung in der Einwanderungsgesellschaft. Strategien gegen institutionelle Diskriminierung in England, Deutschland und in der Schweiz, Münster, New York, München, Berlin: Waxmann Verlag. Hinz, Andreas (2009): »Inklusive Pädagogik in der Schule – veränderter Orientierungsrahmen für die schulische Sonderpädagogik!? Oder doch deren Ende??«, in: Zeitschrift für Heilpädagogik 5, S. 171-179. Klafki, Wolfgang/Stöcker, Hermann (1976): »Innere Diff erenzierung des Unterrichts«, in: Zeitschrift für Pädagogik 22, S. 497-523. Petriwskyj, Anne (2010): »Diversity and Inlusion in the Early Years«, in: International Journal of Inclusive Education 14, S. 195-212. Scholz, Ingvelde (2008): »Es ist normal, verschieden zu sein. Unterrichten in heterogenen Klassen«, in: Der altsprachliche Unterricht Latein, Griechisch 51, S. 2-13. Schuck, Karl Dieter (2000): »Diagnostik«, in: Borchert, Johann (Hg.), Handbuch der Sonderpädagogischen Psychologie, Bern: Huber Verlag, S. 233-249. 26 JOACHIM SCHWOHL UND TANJA STURM Sturm, Tanja (2010): »Heterogenitätskonstruktionen durch Lehrende. Zur Bedeutung des Habituskonzepts für die Lehrerbildung«, in: Müller, Florian H./Eichenberger, Astrid/Lüders, Manfred/Mayr, Johannes (Hg.), Lehrerinnen und Lehrer lernen – Konzepte und Befunde zur Lehrerfortbildung, Münster: Waxmann Verlag, S. 89-105. UN, United Nations (2006; 2008): Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (dreisprachige Fassung im Bundesgesetzblatt Teil II Nr. 35 vom 31.12.2008) (Manuskriptdruck). URL:http://www2.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesan zeiger_BGBl&bk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5B@attr_ id=%27bgbl208s1419.pdf %27%5D( 27.03.2010). Wedell, Klaus (2005): »Dilemmas in the Quest for Inclusion«, in: British Journal of Special Education 32, S. 3-11. Wocken, Hans (2009): »Integration & Inklusion. Ein Versuch, die Integration vor der Abwertung und die Inklusion vor Träumereien zu bewahren «, in: Stein, Annedore/Krach, Stefanie/Niediek, Imke (Hg.), Integration und Inklusion auf dem Weg ins Gemeinwesen. Möglichkeitsräume und Perspektiven, Bad Heilbrunn: Klinkhardt Verlag, S. 204-235. Weitere Titel aus der Reihe Theorie Bilden |
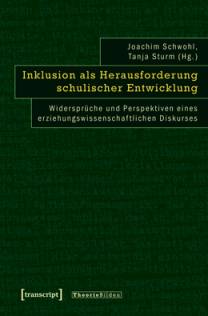
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen