|
|
|
Rezension
Friedrich Schiller steht nicht nur laufend auf den Spielplänen der Theater, er ist auch Standard in den Lehrplänen und schulische Pflichtlektüre. Schillers Biographie darf als tragisch gelten; 1805 stirbt er im Alter von nur 45 Jahren nach langer schwerer Krankheit. Schillers klassische Dramen wie »Die Räuber«, »Kabale und Liebe«, »Don Carlos«, »Maria Stuart« oder »Wilhelm Tell« gehören zur Standard-Lektüre in deutschen Schulen. Dieser Band aus der Reihe "EinFach Deutsch Unterrichtsmodell" ermöglicht eine umfangreiche, differenzierte, anregende inhaltliche Beschäftigung mit dem Drama "Die Räuber" von Friedrich Schiller, indem 5 Bausteine (vgl. Inhaltsverzeichnis) ausgearbeitet sind. - Friedrich Schiller gelang es mit den "Räubern", das Theater zu einem wichtigen gesellschaftlichen Medium zu machen, mit dem er seine Ideale vermitteln konnte. In "die Räuber" werden die Vorstellungen des "Sturm und Drang" mustergültig dargestellt: Die Hauptperson Karl Moor lehnt sich rebelliert gegen überholte Wertvorstellungen, Ordnungsprinzipien und Fremdbestimmung.
Dieter Bach, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Schulform Integrierte Gesamtschule, Gemeinschaftsschule, Stadtteilschule, Gymnasium, Sekundarstufe II, Fachoberschule/Berufsoberschule, Berufliches Gymnasium Schulfach Deutsch Klassenstufe 10. Schuljahr bis 13. Schuljahr Das praxiserprobte Programm der Reihe EinFach Deutsch enthält ein vielseitiges Serviceangebot für einen lebendigen Deutsch- und Literaturunterricht. Die effektive Vermittlung der Lektüre steht im Zentrum der Unterrichtsmodelle. Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer erhalten hier viele Anregungen für eine effiziente und abwechslungsreiche Unterrichtsgestaltung. Gerade in Verbindung mit den Textausgaben, auf deren Basis sie arbeiten, stellen die Unterrichtsmodelle die ideale Lösung für einen modernen, aber dennoch substanziellen Deutschunterricht dar. Die Pluspunkte der EinFach Deutsch-Unterrichtsmodelle auf einen Blick: das Bausteinprinzip: Die einzelnen Bausteine, thematische Schwerpunkte mit entsprechenden Untergliederungen, lassen sich austauschen und/oder variieren. So sind individuell zusammengestellte Unterrichtsreihen mit verschiedenartigen Themenakzenten problemlos möglich. In sehr übersichtlich gestalteter Form erhält der Benutzer/die Benutzerin zunächst eine Übersicht über die im Modell ausführlich behandelten Bausteine. Es folgen: Hinweise zu Handlungsträgern Eine Zusammenfassung des Inhalts und der Handlungsstruktur Vorüberlegungen zum Einsatz des Buches im Unterricht Hinweise zur Konzeption des Modells Eine ausführliche Darstellung der thematischen Bausteine Zusatzmaterialien die Praxisorientierung: Kopierfähige Arbeitsblätter, Vorschläge für Klassen- und Kursarbeiten, Tafelbilder, Arbeitsaufträge, Projektvorschläge etc. erleichtern die Unterrichtsvorbereitung. die Methodenvielfalt: Handlungsorientierte Methoden sind in gleicher Weise berücksichtigt wie eher traditionelle Verfahren der Texterschließung und -bearbeitung. So oder so wird den Bedürfnissen der Schulpraxis Rechnung getragen. die Benutzerfreundlichkeit: Die Einbindung der Textausgaben in die Unterrichtsmodelle liefert verlässliche Textstellenangaben. Randmarker gewährleisten eine schnelle Orientierung und einen gezielten, bequemen Informationszugriff. Bei vielen Bausteinen lässt das Layout Platz für persönliche Notizen, so dass wesentliche Unterrichtsdaten nicht verloren gehen und auch weiterhin nutzbar sind. die Materialauswahl: Aufschlussreiche Zusatzmaterialien wie themenbezogene Zeitungsartikel, Lexikon- oder Redeauszüge, aber auch Bilder und Illustrationen dienen zur Anreicherung und Untermauerung des Lehrstoffes. Die Unterrichtsmodelle beziehen sich und verweisen auf die Textausgaben der Reihe EinFach Deutsch oder auf gängige Taschenbuchausgaben anderer Verlage. Inhaltsverzeichnis
1. Personen 10
2. Inhalt 11 3. Vorüberlegungen zum Einsatz des Dramas im Unterricht 12 4. Konzeption des Unterrichtsmodells 15 5. Die thematischen Bausteine des Unterrichtsmodells 18 Baustein 1: Einführung in die Thematik und erste Leseeindrücke 18 1.1 Vorstellungen vom Räuber 18 1.2 Auseinandersetzung mit dem Personenregister 19 1.3 Der Dramenanfang – ein Leseversuch 19 1.4 Erarbeitung eines Regiebuches zur Briefszene 20 1.5 Analyse eines Filmausschnittes 20 1.6 Annäherung an die Exposition 21 1.7 Der Klappentext 23 1.8 Der Verlauf der Handlung. Die Dramenstruktur 24 Arbeitsblatt 1: Vorstellungen vom Räuber 25 Arbeitsblatt 2: Rollenbesetzung und Regiebuch für den Dramenbeginn 26 Arbeitsblatt 3: Das aristotelische Drama 27 Arbeitsblatt 4: Übersicht über den Ablauf der Handlung 29 Baustein 2: Die ungleichen Brüder 30 2.1 Fixierung innerer Bilder 30 2.2 Charakterisierung der Brüder auf textimmanenter Basis 31 2.3 Vertiefung des Textverständnisses: Karl kennzeichnet Franz 36 2.4 Charakterisierung der Brüder in Schillers „Unterdrückte(r) Vorrede“ 36 2.5 Franz’ Machtanspruch vor dem Hintergrund einer rationalistisch-materialistischen Weltsicht 38 2.6 Franz’ Nihilismus 41 2.7 Das Scheitern Franz von Moors 47 Arbeitsblatt 5: Analyse und Erörterung eines Sachtextes: „Franz: Unterdrückung der Natur und Wiederkehr des Verdrängten“ 50 Baustein 3: Der schwache Vater 52 3.1 Charakterisierung auf textimmanenter Basis 53 3.2 „Der gebrochene Vater – die gestörte Ordnung“. Textexterne Deutung mithilfe eines Sekundärtextes 55 3.3 Textvergleich zwischen Schillers Drama und der Parabel vom verlorenen Sohn, Lukas 15 56 3.4 Vertiefung und Aktualisierung der Thematik: Vergleich der Väter bei Schiller und Lindgren 58 Arbeitsblatt 6: Analyse eines Sachtextes: „Der gebrochene Vater – die gestörte Ordnung“ 60 Arbeitsblatt 7: Lukas 15, 11 – 32: Vom verlorenen Sohn 62 Baustein 4: Der Räuberhauptmann und seine Anhänger 63 4.1 Karls Weg zum Räuberhauptmann 63 4.2 Auseinandersetzung mit der Position Dieter Liewerscheidts 64 4.3 Das Verhältnis der Räuber zu ihrem Hauptmann 65 4.4 Spiegelbergs Sonderstellung 67 4.5 Der Pater als Vertreter der Obrigkeit und als Prüfstein für die Treue der Räuberbande 69 4.6 Die Schwurszene 71 4.7 Der Räuberhauptmann Karl, seine Verzweifl ung und sein Stolz 72 4.8 Vergleich des Räuberhauptmanns Karl mit Rinaldo Rinaldini 77 Arbeitsblatt 8: Geld oder Leben – Ein Räuberbild 80 Arbeitsblatt 9: Vorbereitung und Durchführung eines Standbildes zur Schwurszene 81 Arbeitsblatt 10: Ein Vergleich zwischen der Heimkehr Karl von Moors und der des Sohnes in Kafkas Parabel „Heimkehr“ 82 Baustein 5: Liebe und Tod als zentrale Themen des Dramas 83 5.1 Möglichkeiten der Annäherung an Amalia als einziger Frau des Dramas 84 5.2 Die Bedeutung Amalias für den Handlungszusammenhang 85 5.3 Amalias Lieder 88 5.4 Die Frage nach der Unausweichlichkeit von Amalias Ende und nach modernen Inszenierungen 90 5.5 Todesfälle im Drama und ihre Bedeutung für die Handlung 91 Arbeitsblatt 11: Todesfälle im Drama und ihre Bedeutung für die Handlung 94 Baustein 6: Das Räuberwesen zur Zeit Schillers. Der Schinderhannes 95 6.1 Die Entwicklung des Schinderhannes zum Räuber – Lebensweise, Räubereien und „Schelmereien“ 95 6.2 Vergleich des Räuberhauptmanns Schinderhannes mit Rinaldo Rinaldini und Karl v. Moor 97 Baustein 7: Vom Räuber Hotzenplotz und anderen Räubern 98 7.1 „Der Räuber Hotzenplotz“: Leseeindrücke und Analyse des ersten Kapitels 98 7.2 Der Räuberhauptmann Mattis und seine Räuberbande in A. Lindgrens Märchenroman „Ronja Räubertochter“ 100 7.3 Analyse zweier Filmausschnitte: Das Leben in der Burg. Ein Raubüberfall 104 7.4 Argumente für und gegen Räuberliteratur für Kinder 105 7.5 Vorstellung von Räuberliedern 106 7.6 Eigene Räubergeschichten 108 7.7 Reflexion der Reihenergebnisse und Konfrontation mit der heutigen Realität 109 6. Zusatzmaterial Z1: Ein Lesetagebuch zu Schillers Drama „Die Räuber“ 111 Z2: Lektüre-Test 112 Z3: Epochenüberblick 113 Z4: Übersicht über den Verlauf der Handlung 114 Z5: Karl Moor: Foto aus einer Inszenierung des Berliner Ensembles, 2004 118 Z6: Das Unterrichtsprotokoll 119 Z7: Ulf Miehe: Eine Sorte von Vätern 121 Z8: Rembrandt: Die Heimkehr des verlorenen Sohnes 122 Z9: Astrid Lindgren: Ronja Räubertochter – Glatzenpeer 123 Z10: „Die Räuber“ – „ein politisches Stück der Zeitgeschichte“ 125 Z11: Daniel Chodowiecki: Der Pater – Eine Illustration zu Schillers Drama „Die Räuber“ 126 Z12: Benno von Wiese: Der tragische Märtyrer 127 Z13: Rüdiger Safranski: Freiheit und Verantwortlichkeit 128 Z14: Eine neue Szene (Schüleraufsatz) 129 Z15: Der Tod 131 Z16: Astrid Lindgren: Ronja Räubertochter – Die Räuberbande 132 7. Literaturverzeichnis 133 Weitere Titel aus der Reihe EinFach Deutsch Unterrichtsmodell |
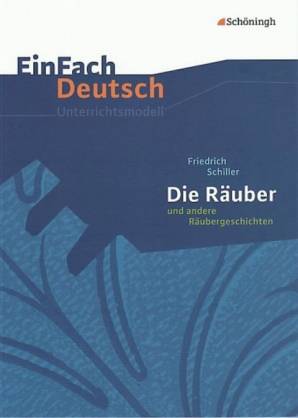
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen