|
|
|
Umschlagtext
Welche Erfahrungen machen Lehramtstudierende, wenn sie ihr erstes Praktikum absolvieren? Wie erleben sie sich selbst, die Schüler, die Lehrkräfte des Kollegiums, die Eltern, die Institution Schule und die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen? Was lernen sie in den ersten Praxiskontakten?
Es werden viele Versuche zur Verbesserung der Ausbildung von angehenden Pädagogen unternommen, ohne dass diese grundlegenden Fragen auch nur gestellt wurden. Doch damit Praxiskontakte einen Beitrag zur Professionalisierung von Lehramtstudierenden leisten können, muss bekannt sein, welche Faktoren die Studierenden in ihren Handlungen beeinflussen. Um die fehlenden Grundlagen zu erarbeiten, wurden in dieser Studie 320 Datensätze gesammelt, die bedeutsame Erlebnisse während des ersten Praxiskontaktes in den Blick nehmen. Mit der wissenschaftlichen Methode der „Grounded Theory“ wurde nicht nur erforscht, welches zentrale Phänomen all diese Erlebnisse verbindet, sondern es wurden zudem diverse interessante Zusammenhänge aufgedeckt. Auf diese Weise entstand eine Arbeit mit überraschenden Ergebnissen. Neben einer Interaktionstheorie, die mit vielen weiteren wissenschaftlichen Theorien verknüpft ist, werden in diesem Buch auch eine Typologie von Interaktionsstilen und der so genannte „OK-Korridor“ vorgestellt, der die Handlungen von Studierenden in ihrer Umwelt wesentlich determiniert. Als praktische Implikation der Studie werden zudem konkrete Vorschläge zur Verbesserung der ersten Phase der Lehrerbildung formuliert. Dabei werden auf der Grundlage der Forschungsergebnisse Ideen vorgestellt, wie Praktika systematisch zur Erhöhung der Professionalität von Lehramtstudenten genutzt werden könnten. Zur Autorin: Barbara E. Meyer besitzt seit ihrem Studium zahlreiche Lehraufträge an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Nach ihrer Ausbildung zur Bankkauffrau und ihrem Abschluss als Magister in den Sprechwissenschaften (Psycholinguistik), der Pädagogik und Psychologie an der Ludwig-Maximilians-Universität promovierte sie mit der vorliegenden Arbeit bei Professor Dr. Ewald Kiel am Lehrstuhl für Schulpädagogik. Seit einigen Jahren setzt sie sich zusammen mit dem Team „Sprachraum" (www.sprachraum.lmu.de) im Rahmen von Fortbildungen und Coachings für die Verbesserung der Hochschullehre ein. Weitere Informationen zur Autorin finden Sie unter www.barbara-e-meyer.de. Schneider Verlag Hohengehren GmbH Rezension
Die Studiengänge der Lehramtsausbildung stehen unter nicht unerheblichem Reformdruck nach den ernüchternden Ergebnissen der (inter-)nationalen Schulleistungsvergelichsstudien wie PISA etc. Manchmal sieht das alles nach mehr oder minder (politisch motiviertem) Aktionismus aus nach dem Motto: Hauptsache es wird etwas reformiert ... In diesen Reform-Aktionismus gerät auch das Schulpraktikum. Die Autorin dieser Münchner Dissertation fordert aber zu Recht: Damit Praxiskontakte einen Beitrag zur Professionalisierung von Lehramtstudierenden leisten können, muss bekannt sein, welche Faktoren die Studierenden in ihren Handlungen beeinflussen. Es werden viele Versuche zur Verbesserung der Ausbildung von angehenden Pädagogen unternommen, ohne dass grundlegende Fragen auch nur gestellt wurden: Welche Erfahrungen machen Lehramtstudierende, wenn sie ihr erstes Praktikum absolvieren? Wie erleben sie sich selbst, die Schüler, die Lehrkräfte des Kollegiums, die Eltern, die Institution Schule und die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen? Was lernen sie in den ersten Praxiskontakten? Empirisch erarbeitet die Verfasserin Antworten auf diese Fragestellungen.
Dieter Bach, lehrerbibliothek.de Inhaltsverzeichnis
Vorwort der Herausgeber XV
A) Einleitung 1 1 Das Dilemma der Schulpraktischen Studien 4 2 Ideen zur Lösung des Dilemmas 8 3 Zielsetzung und Vorgehen 12 3.1 Zielsetzung 12 3.2 Methodenauswahl 14 3.3 Eingrenzungen 15 4 Anmerkung zum Vorgehen 17 4.1 Formulierungen und Darstellung 17 4.2 Überblick 18 B) Methode 20 1 Das Konzept der „Grounded Theory“ (GT) 20 1.1 Der Begriff und die Ziele der GT 21 1.2 Die GT in der wissenschaftlichen Forschung 21 1.3 Ein kurzer Einblick in die Geschichte der GT 22 1.4 Idealtypischer Ablauf einer GT-Forschung 25 1.5 Zentrale Methoden der GT 27 2 Gewährleistung von Forschungsqualität 34 2.1 Berücksichtigung spezieller Qualitätsstandards für GTs 34 2.2 Erhöhung von Intersubjektivität und Validität 35 2.3 Beachtung unterschiedlicher Forschungslogiken 37 2.4 Explikation des Umgangs mit theoretischem Vorwissen 41 3 Vorstrukturierung der Datenerhebung 44 3.1 Art und Größe der Datenerhebung 45 3.2 Fragebogen mit qualitativen und quantitativen Aspekten 46 3.3 Rückbindung an die Praxis 47 3.4 Einbindung von Qualitätskriterien der GT 47 4 Durchführung der Datenerhebungen („Sampling“) 50 4.1 „Initiales Sampling“ 51 4.2 Erster Online-Fragebogen 57 4.3 Befragungen zu vorläufigen Ergebnissen 77 4.4 Zweiter Online-Fragebogen 79 C) Ergebnisse 83 0 Advance Organizer 84 0.1 Die Kernkategorie „Selbstbild-Spannung“ 84 0.2 Ablauf aller bedeutsamen Situationen 87 0.3 Verschiedene Maßnahmen und ihre Auswirkungen 92 0.4 Erfolgreiche Interaktionen 95 0.5 Hinweise zum Vorgehen im Ergebnisteil 96 1 Abgleich eines Vorfalls mit OK-Korridoren 100 1.2 Das Konzept des OK-Korridors 101 1.3 Die Konstituierung von OK-Korridoren durch Werte 106 1.4 Die Zonen des OK-Korridors 113 1.5 Drei Möglichkeiten des OK-Korridor-Abgleichs 123 1.6 Vielzahl der Abgleiche in einer Interaktion 143 1.7 Zusammenfassung des ersten Kapitels 151 2 Selbstbild-Spannung als Anlass für Maßnahmen 152 2.1 Das Selbstbild steht nicht unter Spannung 155 2.2 Selbstbild-Spannung als Kernkategorie 159 2.3 Selbstbildspannung bei eindeutiger Einordnung 163 2.4 Selbstbildspannung bei unklarer Einordnung 185 2.5 Typologie von Interaktionsstilen 194 2.6 Zusammenfassung des zweiten Kapitels 206 3 Vorbereitende Maßnahmen 208 3.1 Vorbemerkung zu allen Maßnahmen 208 3.2 Verhaltenshemmung ermöglichen 217 3.3 Informationen suchen und Zusammenhänge reflektieren 226 3.4 Weitere Maßnahmen auffinden 242 3.5 Durchführbarkeit von Maßnahmen überprüfen und verbessern 245 3.6 Effektivität von Maßnahmen überprüfen und verbessern 247 4 Extern verändernde Maßnahmen 259 4.1 Veränderung der Beziehungsqualität 260 4.2 Veränderung des Stellungsgefüges 273 4.3 Setzen neuer Interpunktionen 291 4.4 Zusammenfassung der Kapitel drei und vier 295 5 Intern ausgleichende Maßnahmen 296 5.1 durch Bewertung des Interaktionspartners 298 5.2 durch Relativierung des Ereignisses 299 5.3 durch Bewertung intervenierender Bedingungen 302 5.4 durch Veränderung von Werten 302 5.5 durch Veränderung des Selbstbilds 303 D) Schlussfolgerungen 312 1 Antwort auf die Forschungsfragen 312 2 Methodenkritik 315 2.1 Subjektiver Erfahrungsbericht zur GT 316 2.2 Kritische Auseinandersetzung mit dem Forschungsdesign 319 3 Beitrag zur Professionsdebatte 322 3.1 Forderungen an Lehrer im Rahmen der Professionsdebatte 323 3.2 Ungelöste Probleme 325 3.3 Lösungsbeitrag der gegenstandsverankerten Interaktionstheorie 331 4 Vorschläge zur Verbesserung der 1. Phase der Lehrerbildung 334 4.1 Auffinden und Auswählen funktionaler Maßnahmen 339 4.2 Umgang mit OK-Korridor-Differenzen 341 4.3 Affekte regulieren 343 4.4 Gewohnheiten aufdecken und hinterfragen 344 4.5 Umgang mit ungeklärten Selbstbild-Spannungen 345 4.6 Reflektieren und treffende Schlussfolgerungen ziehen 347 4.7 Aufbau fehlender Ressourcen und Kompetenzen 348 5 Überlegungen zur Übertragbarkeit und Ausblick 350 Glossar 354 Literaturverzeichnis 356 Anhang 371 Weitere Titel aus der Reihe Schul- und Unterrichtsforschung |
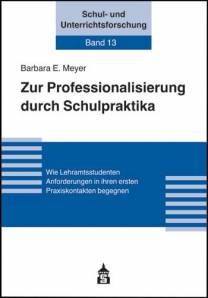
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen