|
|
|
Umschlagtext
Mit Ansätzen des interkulturellen Lernens soll im Geographieunterricht Rassismus entgegengewirkt werden. Der Geographiedidaktik fehlt allerdings bisher eine systematische Auseinandersetzung mit lebensweltlichen Zugehörigkeits- und Rassismuserfahrungen von Lernenden. Birte Schröder füllt diese Lücke und setzt sich in ihrer empirischen Untersuchung mit unterschiedlichen Zugehörigkeitsaushandlungen von Jugendlichen in der Migrationsgesellschaft auseinander. Dabei stehen Brüche, Irritationen und Widerstände im Umgang mit rassismusrelevanten Grenzziehungen und Deutungsmustern im Mittelpunkt. Darauf aufbauend schlägt sie Orientierungslinien für eine rassismuskritische geographische Bildung vor.
Birte Schröder hat mit einem Stipendium des Evangelischen Studienwerkes Villigst in der Abteilung Geographie an der Europa-Universität Flensburg promoviert. Ihre Forschungsschwerpunkte umfassen geographische Bildung, Migration und postkoloniale sowie feministische Theorien. Rezension
Auch der Geographieunterricht kann dem Rassismus entgegenwirken, z.B. mit Ansätzen des interkulturellen Lernens. Migrationsgesellschaftliches Zusammenleben wird im Geographieunterricht im interkulturellen Lernen bearbeitet. Dazu bedarf es allerdings Kenntnissen über lebensweltliche Zugehörigkeits- und Rassismuserfahrungen von Jugendlichen. Interkulturelles Lernen muß insofern weiterentwickelt werden; es gilt, die migrationsgesellschaftliche Heterogenität und marginalisierte Perspektiven migrationsanderer Schüler_innen in der Diskussion um interkulturelles Lernen stärker sichtbar zu machen. In einer Migrationsgesellschaft handeln Jugendliche Zugehörigkeiten und Nicht-Zugehörigkeiten differenziert aus mit unterschiedlichsten Grenzziehungen und Deutungsmustern. Diese Studie fragt, wie natio-ethno-kulturelle Ab- und Ausgrenzungen in der Migrationsgesellschaft in Bildungsprozessen hinterfragt und verschoben werden können. Das zentrale Anliegen der vorliegenden Studie ist es, Perspektiven für eine reflexiv-kritische und emanzipatorische geographische Bildung in der Migrationsgesellschaft auszuloten, die an Zugehörigkeitserfahrungen und -aushandlungen sowie Orientierungen zum Umgang mit migrationsgesellschaftlicher Differenz von Schüler_innen anknüpfen.
Oliver Neumann, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Schlagworte: Interkulturelles Lernen, Rassismus, Jugendliche, Kultur, Raum, Schule, Unterricht,Didaktik, Geographie, Bildung, Zugehörigkeit, Migrationsgesellschaft,Kulturgeographie, Bildungsforschung, Migratio Inhaltsverzeichnis
Prolog 11
I Einleitung und theoretisch-analytische Perspektiven 13 1. Einleitung und Einbettung 15 1.1 Verortung und Perspektiven der Studie 17 1.2 Aufbau der Untersuchung 19 1.3 Lesehilfen 21 1.4 Konturen des Forschungsfeldes: Kultur, Identität und Raum 22 1.4.1 Kultur als Ordnungsschema 23 1.4.2 Kritische Reflexion des Kulturbegriffs 28 2. Postkoloniale theoretisch-analytische Perspektiven 33 2.1 Postkoloniale Perspektiven auf Kultur, Identität und Raum 34 2.1.1 Postkoloniale Perspektiven 35 2.1.2 Identität, Zugehörigkeit, Othering 36 2.1.3 Hybridität 40 2.1.4 Dominanzbegriff 45 2.1.5 Raumtheoretische Implikationen 47 2.1.6 Imaginative Geographien 48 2.2 Rassismuskritik als Perspektive 53 2.3 Kritische Weissseinsforschung 63 II Didaktische Einbettung und empirische Wege 67 3. Interkulturelles Lernen in der geographiedidaktischen Diskussion 69 3.1 Themen und räumliche Ebenen in der Diskussion 70 3.1.1 Vermittlung von Kenntnissen über andere Räume 72 3.1.2 Entwicklungspolitischer Unterricht 78 3.1.3 Zusammenleben in der Migrationsgesellschaft 79 3.1.4 Interkulturelles Lernen als Teilbereich des Globalen Lernens 82 3.2 Eingrenzung des eigenen Erkenntnisinteresses 83 3.3 Theoretische Grundlagen in der Diskussion 86 3.4 Probleme von Ansätzen des interkulturellen Lernens 88 3.4.1 Ausblendung von Verschränkungen im interkulturellen Lernen 91 3.4.2 Tendenz zur Kulturalisierung im interkulturellen Lernen 91 3.4.3 Othering und Festschreibung migrationsgesellschaftlicher Differenz 92 3.4.4 Gefahr der Reproduktion und Verdeckung rassistischer Unterscheidungs- und Deutungsmuster 95 3.4.5 Konzeptualisierung interkulturellen Lernens als Lernen über „Andere“ 99 3.5 Vorschläge zur Weiterentwicklung des interkulturellen Lernens 103 3.5.1 Transkulturalität 103 3.5.2 Kultur als soziale Konstruktion 107 3.5.3 Postkoloniale Theorien als Leerstelle 109 3.5.4 Kritische Positionen zu Transkulturalität und konstruktivistischen Ansätzen 110 3.6 Entwicklung eigener Vorschläge 116 4. Methodologische und methodische Aspekte der Untersuchung 121 4.1 Methodologische Vorüberlegungen 121 4.1.1 Beobachtung zweiter Ordnung 122 4.1.2 Methodologische Reflexivität 124 4.1.3 Entwicklung des Forschungsdesigns 127 4.2 Strukturierung des Feldes und angewandte Methodik 135 4.2.1 Fallauswahl 135 4.2.2 Teilnehmende Beobachtung 139 4.2.3 Gruppendiskussionen mit Schüler_innen 142 4.2.4 Einführung des Filmimpulses 146 4.2.5 Transkription 148 4.2.6 Vorgehen bei der Auswertung 148 4.3 Kritische Reflexion des methodischen Vorgehens 156 III Auswertung und Ergebnisdiskussion 161 5. Gruppendiskussionen Klavier und E-Sports 163 5.1 Markierung von Differenz 168 5.1.1 Körper als Konstrukte naturalisierter visueller Evidenzen 169 5.1.2 Deutschland als originärer Raum der „Wir-Gruppe“ 175 5.1.3 Über „optisch“ nicht in Deutschland Zugehörige 176 5.1.4 „Ein-Mann-Kultur“ im „Ein-Mann-Land“ 180 5.1.5 Verkopplung von Körpern und Kultur 183 5.1.6 Naturalisierung von Differenz über die körperliche und räumliche „Auffindbarkeit“ der „Anderen“ 185 5.2 Bedeutungszuschreibungen: Makelbehaftung versus Mustergültigkeit 189 5.2.1 Integrationsbedürftigkeit und -unwillen 190 5.2.2 Sich über Deutschland beschwerende Migrationsandere 194 5.2.3 Verdorbene Migrationsandere, die die „Wir-Gruppe“ beleidigen 198 5.2.4 Die Fokussierungsmetapher vom „Checker Gangster“ 201 5.2.5 Parasitäres Dasein Migrationsanderer 203 5.2.6 Berlin Neukölln: Parasitäres Dasein verortet 206 5.2.7 Außerrechtsstaatliche Enklaven inmitten Deutschlands 209 5.2.8 Mustergültig assimilierte Migrationsandere 213 5.2.9 Migrationsandere als stetig hilfsbereite, bessere Freund_innen 218 5.2.10 Assoziationsketten – Zwischenfazit 222 5.3 Forderungen einer unerreichbaren Assimilation 223 5.3.1 „Wenn ich mir jetzt nen Land auswählen würde“ 223 5.3.2 Identifikation mit und Anpassung an das auserwählte „Land“ 230 5.4 De-Legitimationen, Verweigerungen und Disziplinierungen 237 5.4.1 Verweigerung von selbstbestimmter Identität 238 5.4.2 Der Ausländer_inbegriff als legitime begriffliche Verweisung? 245 5.5 Im Spiegelbild: Selbstbild und Dominanzposition der „Wir-Gruppe“ 259 5.5.1 Legitime Bestimmung, Kontrolle und Disziplinierung 259 5.5.2 Gruppe Klavier: Versicherung der Legitimität der eigenen Sichtweise 261 5.5.3 Gruppe E-Sports: Toleranzpräsentation versus Berechtigung offener Herabwertung 264 5.5.4 Gruppe E-Sports: Identifikation mit einem (un)beschädigten nationalen Selbstbild 281 5.5.5 Komponenten der Dominanzposition 287 5.6 Irritationen des Selbst- und Weltbildes 292 5.6.1 Mannheim als Heimat aber nicht Deutschland 292 5.6.2 Irritationen des Selbst- und Weltbildes kitten 301 5.7 Orientierungen zum Umgang mit migrationsgesellschaftlicher Differenz 314 6. Gruppendiskussion Schuluniform 319 6.1 Selbstpositionierungen und die Aushandlung von Zugehörigkeiten 322 6.1.1 Warum wir nicht sagen wir seien Deutsche 322 6.1.2 Zugehörigkeitsaushandlungen im Spiegel von Othering und Nicht-Akzeptanz 329 6.1.3 Hybride Identifikationen Migrationsanderer 335 6.1.4 Widerstand gegen eine zugeschriebene Haltung der „Deutschenfeindlichkeit“ 338 6.2 Othering- und Rassismuserfahrungen 343 6.2.1 Wirkmächtigkeit von Othering- und Ausgrenzungserfahrungen 344 6.2.2 Ernste Ausgrenzung versus Spaßpraxis in der In-Group 346 6.2.3 Erfahrungen mit Othering und Verweisungen aus dem Hier 350 6.2.4 Erfahrungen mit Bedeutungszuschreibungen und Diskreditierungen 356 6.2.5 Rassismusrelevante Bedeutungszuschreibungen 363 6.2.6 „Muslim Moments“: Erfahrungen mit antimuslimischem Rassismus 373 6.3 Kollektive Orientierungen zum Umgang mit Othering- und Rassismuserfahrungen 390 6.3.1 Grundsätzliche Orientierungen zum Umgang mit Ausgrenzung und Diskriminierung 391 6.3.2 Orientierungen zum Umgang mit Othering- und Rassimuserfahrungen 407 6.4 Orientierungen zum Umgang mit migrationsgesellschaftlicher Differenz 438 7. Bildungsbezogene Relektüre der Ergebnisse: Reflexiv-transformative Potenziale für Bildungsprozesse 443 7.1 Reflexion natio-ethno-kultureller Grenzziehungen und Otheringerfahrungen 445 7.1.1 Wirkmächtigkeit hegemonialer Zugehörigkeitsordnungen anerkennen 447 7.1.2 Biologistische Differenzmarkierungen und die Imagination des Eigenen als relevante Foki für Dekonstruktionsarbeit 448 7.1.3 Fragilität der Imagination des „Eigenen“ als homogen 452 7.1.4 Widersprüche zwischen Exklusivität und Assimilation 454 7.1.5 Von der Assimilationslogik zur transnationalen Inkorporation 456 7.1.6 Definitionsmacht 457 7.1.7 Selbst- und Fremdbezeichnungen 460 7.1.8 Relationalität von Zugehörigkeitsaushandlungen 461 7.1.9 Hybridität 470 7.2 Produktive Irritationen? 473 7.2.1 Irritation und Re-Stabilisierung des eigenen Welt- und Selbstbildes 474 7.2.2 Hürden und Möglichkeiten für die Reflexion von Othering und Rassismus in Bildungsprozessen 479 7.2.3 Hinweise für die Ermöglichung von reflexiven Bildungsprozessen 483 7.3 Produktive Widerstände? 493 7.3.1 Emanzipatorisch-widerständige Haltungen wahrnehmen, stärken und erweitern 494 7.3.2 Dramatisierung, Ent-Dramatisierung und Nicht-Dramatisierung 501 8. Ergebnisdiskussion 509 8.1 Ergebnisse der analytischen Auswertung 509 8.2 Ergebnisse der bildungsbezogenen Relektüre 513 8.3 Ergebnisdiskussion im Spiegel der geographiedidaktischen Diskussion um interkulturelles Lernen 518 8.3.1 Transkulturalität in der geographiedidaktischen Diskussion 521 8.3.2 Machtverständnis in der geographiedidaktischen Diskussion 532 8.3.3 Rassismus in der geographiedidaktischen Diskussion 536 Literaturverzeichnis 543 Danksagung 571 Weitere Titel aus der Reihe Kultur und soziale Praxis |
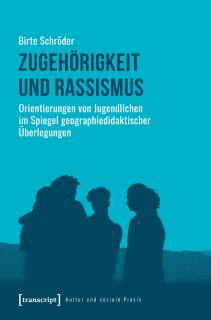
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen