|
|
|
Umschlagtext
„Ist der moderne Pluralismus ein epochales Unglück oder Inbegriff freiheitlicher Vernunft? Sollten wir noch in der auseinanderstrebenden Vielfalt die Vernunft als Prinzip ausmachen können, hätten wir es mit einem vernünftigen Pluralismus zu tun. Dann bestünde die realistische Chance, Einheit und Vielheit, Identität und Differenz, Individualismus und Gemeinschaftlichkeit mit guten Gründen ausbalancieren zu können.“
Rezension
Leidet die moderne Gesellschaft unter dem Pluralismus? Wodurch zeichnet sich ein vernünftiger Pluralismus – im Sinne des Philosophen John Rawls – aus? Sind politische Tugenden notwendig zu seiner Realisierung? Wie wurde das Spannungsverhältnis von Einheit und Vielheit, von Identität und Differenz in der Philosophiegeschichte gedacht? Lassen sich Individualismus und Gemeinschaftlichkeit ausbalancieren?
Fundierte Antworten auf diese Fragen der politischen Philosophie, der Sozialphilosophie und der Ontologie liefert Jürgen Goldstein (*1962) in seinem Essay „Vernünftiger Pluralismus. Die Zukunft unserer politischen Vergangenheit. Perspektiven der Moderne II“. Erschienen ist dieser als 235. Band der Reihe „Fröhliche Wissenschaft“ bei Matthes & Seitz Berlin. Der Professor für Philosophie an der Universität Koblenz-Landau erlangte Bekanntheit durch seine exzellente Monographie über seinen akademischen Lehrer „Hans Blumenberg. Ein philosophisches Portrait“(2020), durch sein preisgekröntes Buch „Georg Forster. Zwischen Freiheit und Naturgewalt“(2015) und seinen Essay „Blau. Eine Wunderkammer seiner Bedeutungen“(2017). In seinem neuen Essay identifiziert Goldstein den Pluralismus als Zumutung und Herausforderung für die moderne Gesellschaft. Er verteidigt diesen gegenüber autoritären und populistischen Strömungen. Dabei folgt er Rawls „vernünftigem Pluralismus“ und dessen Forderung nach Stützung eines solchen durch politische Tugenden wie „Vernünftigkeit, Sinn für Fairness, Kompromiss- und Kooperationsbereitschaft“(S. 183). Dieser Tugendkatalog ist Goldstein zufolge um die „Tugend der Friedfertigkeit“(S. 184) zu ergänzen. In seinem Essay beleuchtet er gekonnt anhand einer Reise durch die Geschichte der politischen Philosophie, wie Philosoph:innen das Verhältnis von Einheit und Vielfalt gedacht haben. Goldstein berücksichtigt in seinem Essay u.a. Platon, Wilhelm von Ockham, Nicoló Machiavelli, Johannes Reuchlin, Thomas Hobbes, Baruch de Spinoza, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant, Martin Heidegger, Hannah Arendt und Jürgen Habermas. Zurecht deckt er auf, dass Martin Heideggers nationalsozialistische Metapolitik in seiner Fundamentalontologie philosophisch verankert ist: „Nach Heidegger hatte es darum zu gehen, die Pluralität als Quelle der politischen Macht zu rehabilitieren.“(S. 118) Ausführlich würdigt Goldstein den Spätscholastiker William von Ockham, mit dessen politischer Philosophie er sich schon in seiner Dissertation „Nominalismus und Moderne. Zur Konstitution neuzeitlicher Subjektivität bei Hans Blumenberg und Wilhelm von Ockham“(1998) intensiv auseinandergesetzt hat. Der Theologe und Philosoph prägte die Formel, dass die Macht des Menschen zwar von Gott stamme, der Mensch diese aber selbst zu gestalten habe. Darin sieht Goldstein zurecht den Aufbruch in die politische Moderne. Besonders lobt er den deutschen Humanisten Johannes Reuchlin für dessen Gutachten „Ratschlag, ob man den Juden alle ihre Bücher nehmen, abtun und verbrennen soll“ aus dem Jahre 1510 als einen frühen Beleg für Toleranz. Lehrkräfte der Fächer Philosophie und Ethik werden durch das vorliegende Buch motiviert, sich in ihrem Fachunterricht mit dem Thema „Chancen und Probleme einer pluralistischen Gesellschaft“ philosophisch auseinanderzusetzen. Fazit: Jürgen Goldstein ist mit seinem gut lesbaren Essay ein überzeugendes Plädoyer für einen „vernünftigen Pluralismus“ gelungen, der in postfaktischen Zeiten zur Realisierung einer freiheitlichen Gesellschaft besondere Aktualität besitzt. Dr. Marcel Remme, für lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Ein Mediengewitter an Informationen, Fake News und »alternativen Fakten«, erodierende Weltbildhintergründe und Leitkulturfantasien, identitäre Selbstbehauptungen und populistische Vereinfachungen – all das sind Indikatoren für die Zumutungen eines Pluralismus, denen liberale und pluralistisch verfasste Gesellschaften ausgesetzt sind: Moderne Gesellschaften werden permanent einem Stresstest unterzogen. Jürgen Goldstein verteidigt in seinem tiefschürfenden philosophischen Essay den modernen Pluralismus und zeigt auf, warum er kein epochales Verhängnis darstellt, sondern vielmehr als Folge der modernen Freiheit verstanden werden kann – einer Freiheit, auf die auch die Gegner des Pluralen nicht verzichten wollen. In der auseinanderstrebenden Vielfalt macht er die Möglichkeit eines »vernünftigen Pluralismus« aus. Einheit und Vielfalt, Identität und Differenz, Individualismus und Gemeinschaftlichkeit: konkurrierende Ziele, die aber doch nicht unvereinbar sind, wie ein Blick in die politische Denkgeschichte zeigt, deren Ressourcen Goldstein freilegt. Inhaltsverzeichnis
1. Faktischer Pluralismus 7
2. Antike Vorspiele: Politische Einheit und Vielfalt 13 3. Der mittelalterliche Aufbruch in die Moderne und die Vielfalt möglicher Ordnungen 35 4. Die vielen Erfahrungen und die Rationalität der Macht 55 5. Konfessioneller Pluralismus und einende Staatsgewalt 62 6. Individuelle Freiheit und soziale Ungleichheit 80 7. Die Einheit des Fortschritts und die Pluralität des Ungleichzeitigen 94 8. Eine romantische Metapolitik des Volkes 102 9. Die Pluralität der Menschen als Quelle politischer Macht 119 10. Die eine Wahrheit und der neue Pluralismus im Raum der Gründe 134 11. Vernünftiger Pluralismus 157 12. Versöhnung mit der Moderne 174 Nachbemerkung: Die politische Tugend der Friedfertigkeit 183 Anmerkungen 185 Weitere Titel aus der Reihe Fröhliche Wissenschaft |
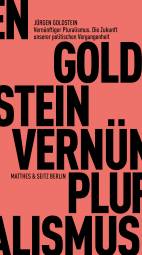
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen