|
|
|
Umschlagtext
Gute Bildung für alle
Unterrichtsplanung gehört zum Kerngeschäft aller Lehrkräfte in Sonder- und Regelschulen. Fundiert und praxisorientiert zeigt dieses Buch, welche Schritte für einen systematisch geplanten und strukturierten Unterricht zu beachten sind und wie eine Didaktik für Lerngruppen mit Schüler:innen mit geistiger Behinderung konkret umgesetzt werden kann. Am Beispiel eines Unterrichtsprojekts werden die wichtigsten didaktischen Schritte dargestellt: die Auswahl von Inhalten, Zielformulierung, methodische und mediale Vermittlung, Kommunikation im Klassenzimmer sowie die Analyse von Unterrichtsverläufen. Bereits in vierter, überarbeiteter Auflage! Karin Terfloth, Prof. Dr. päd., lehrt Pädagogik bei schwerer und mehrfacher Behinderung und Inklusionspädagogik an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Sören Bauersfeld ist Sonderschullehrer und Lehrbeauftragter am Seminar für Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte Heidelberg. Rezension
In bereits 4. überarbeiteter Auflage liegt dieses Buch zum Unterricht von Schülern mit geistiger Behinderung vor. Didaktik und Unterrichtsplanung sollte jede Lehrkraft beherrschen, - unabhängig davon, ob an Förder- oder Regelschule unterrichtet wird. Es gilt dann für eine Didaktik für Lerngruppen mit SchülerInnen mit geistiger Behinderung lediglich die entsprechenden Besonderheiten zu berücksichtigen. Am Beispiel eines Unterrichtsprojekts werden die wichtigsten didaktischen Schritte für Schüler mit geistiger Behinderung hier dargestellt: Die Auswahl von Inhalten, Zielformulierung, methodische und mediale Vermittlung, Kommunikation im Klassenzimmer sowie die Analyse von Unterrichtsverläufen. Ganz konkrete spezifische Unterrichtsgestaltungsmerkmale werden anhand von Beispielen und Unterrichtsentwürfen anschaulich dargestellt. Angesichts inklusiver Beschulung bietet das Buch Differenzierungsmöglichkeiten. Die Gestaltung von Unterricht für Kinder mit Beeinträchtigung ist nicht mehr alleinige Aufgabe von Förderschullehrkräften; dieses Buch zeigt, wie gemeinsamer inklusiver Unterricht funktionieren kann.
Oliver Neumann, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Zielgruppe: Studierende des Lehramts an Sonder- und Regelschulen, v.a. der Pädagogik im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung Inhaltsverzeichnis
Einleitung 9
1 Unterricht planen 15 1.1 Zur Notwendigkeit von Unterrichtsplanung 15 1.2 Unterrichtsplanung als zielorientierter Prozess 17 1.2.1 Zielrichtungen des Unterrichts 18 1.2.2 Unterrichtsplanung kritisch-konstruktiv 19 1.2.3 Planungsraster21 1.2.4 Zeitliche Planungsebenen 26 2 Spannungsfeld: Bildung und (komplexe) kognitive Beeinträchtigung 29 2.1 Internationale Sicht auf Behinderung (ICF) 31 2.2 Spezielle oder allgemeine Didaktik? 34 2.2.1 Von der ,Anstalt für Schwachsinnige‘ zum ,sonderpädagogischen Schwerpunkt geistige Entwicklung‘ 34 2.2.2 KMK-Empfehlungen 36 2.2.3 Entwicklung der Inklusionspädagogik 40 2.2.4 Gemeinsamer Untericht und sonderpädagogische Spezifikation 43 2.2.5 Unterrichtsplanung im gemeinsamen Unterricht 47 2.3 Bildung und Lernen 50 2.3.1 Lernen als Tätigkeit 52 2.3.2 Lebensfelder und Unterrichtsfächer 55 2.3.3 Schulalltag mit komplexer Behinderung 58 2.3.4 Bildung mit ForMat 61 3 Bildungsinhalte begründen und elementarisieren 63 3.1 Fachdidaktik 66 3.2 Begründung und Auswahl des Inhaltes 70 3.2.1 Bildungsplanbezug 71 3.2.2 Gegenwarts-, Zukunfts- und exemplarische Bedeutung anhand des Unterrichtsbeispiels 72 3.3 Fachwissenschaftliche Sachstruktur 75 3.4 Elementarisierung 84 3.4.1 Elementarisierungsrichtungen 84 3.4.2 Was ist elementar und fundamental? 88 3.5 Fundamentum und Additum im gemeinsamen Unterricht 93 4 Aneignungsmöglichkeiten und Lernvoraussetzungen einschätzen 99 4.1 Methoden zur Einschätzung der Lernvoraussetzungen 100 4.2 Entwicklungsbezogene Lernvoraussetzungen 104 4.2.1 Kognition und Aneignungsmöglichkeiten 104 4.2.2 Emotion, Sozialität, Kommunikation, Motorik 116 4.3 Lebensweltbezogene Lernvoraussetzungen, Lernstrategien 122 4.4 Exkurs: Schriftsprachliche und mathematische Kompetenzen 128 4.5 Präsentationsmöglichkeiten 132 4.6 Diversität der Lerngruppe im gemeinsamen Unterricht 134 5 Differenzierte Lernchancen formulieren 136 5.1 Problemaufriss Lernchancen 137 5.1.1 Unterrichtsqualität 137 5.1.2 Herleitung von Lernchancen 138 5.1.3 Kompetenzorientierung 140 5.1.4 Input-, Prozess- und Outputorientierung: Lernchancen 143 5.2 Lernchancen für eine Unterrichtsreihe 148 5.3 Individualisierte Lernchancen für einzelne Unterrichtsstunden 151 5.4 Leistungserwartungen 157 5.4.1 Bezugsnormen und Formen der Leistungsbegleitung und -bewertung 157 5.4.2 Leistungsbewertung im gemeinsamen Unterricht 159 6 Methodische Entscheidungen treffen 161 6.1 Methodische Analysen vornehmen 165 6.2 Werkstattarbeit als (eine) Unterrichtsform 166 6.2.1 Eigenaktiv entdeckendes und forschendes Lernen 167 6.2.2 Gestaltete Lernumgebung 172 6.2.3 Schüler:innenautonomie und Begleitung durch die Lehrperson 173 6.2.4 Fächerübergreifende Lernangebote 174 6.2.5 Wechsel von Sozialformen 177 6.3 Ablauf des Unterrichtsprojektes Energie178 6.3.1 Unterrichtsskizzen zum Energieprojekt180 6.3.2 Methodisches Vorgehen 193 6.3.3 Formen der Ergebnissicherung196 6.3.4 Hilfsmittel, Positionierung und Lernmaterialien 201 6.3.5 Rhythmisierung und Rituale 204 6.4 Unterrichtsprinzipien anwenden 208 6.4.1 Lebenspraxis und Lebensnähe 208 6.4.2 Handlungsorientierung 209 6.4.3 Differenzierung 219 6.4.4 Kleine Schritte und / oder Sinnzusammenhang? 221 6.4.5 Ganzheitlichkeit 221 6.5 Das Theorem gemeinsamer Lernsituationen 223 7 Im Unterricht kommunizieren und kooperieren 227 7.1 Interaktion als Grundlage des Unterrichts 228 7.1.1 Interaktionssystem Unterricht 229 7.1.2 Belastungen der Interaktion232 7.1.3 Konsequenzen für den Unterricht 233 7.2 Unterstützte Kommunikation (UK) 234 7.2.1 Multimodales Kommunikationssystem 235 7.2.2 Besonderheiten der Gesprächsführung 239 7.2.3 UK in der Unterrichtsplanung 241 7.3 Zusammenarbeit im Team 243 8 Unterricht analysieren und bewerten 249 8.1 Formen der Unterrichtsanalyse 250 8.2 Planung der Unterrichtsanalyse und -bewertung 251 8.3 Analyse- und Bewertungskriterien 253 Literatur 257 Sachwortregister 266 Weitere Titel aus der Reihe UTB |
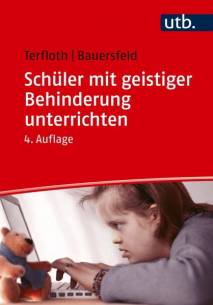
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen