|
|
|
Umschlagtext
Die kindbezogenen Aspekte des Scheidungsprozesses stehen im Vordergrund dieser neuartigen Darstellung. Sie basiert auf den Erkenntnissen der Familienpsychologie und Entwicklungspsychologie, vor allem aber auf der täglichen Praxis der Autoren als Therapeuten und Gutachter. Sie betrachten den Elternkonflikt vor und nach der Scheidung - und die typischen Reaktionen der Kinder auf diese Erfahrung. Wie können Eltern in der Situation rund um die faktische Trennung ihren Kindern begegnen und helfen? Welche therapeutischen Möglichkeiten gibt es? Meistens stellen sich auch sehr schnell Fragen nach der Kindeszuteilung, nach scheidungsbezogener emotionaler, vielleicht sogar sexueller Ausbeutung der Kinder. Spezielle Probleme werden diskutiert, z.B. bei bikulturellen Elternpaaren und psychisch kranken Elternteilen. Die Autoren berichten zudem über erste Erfahrungen mit dem Einbezug der Kinder in den Scheidungsprozess, z. B. wenn es um die strittige Zuteilung der Kinder geht. Die Darstellung der Nachscheidungsproblematik - z.B. Besuchsrechtsprobleme oder Entfremdung zwischen Kindern und Elternteilen - leitet über zu den Entwicklungsbedingungen der Kinder in den neu zusammengesetzten Familien.
Rezension
Jede dritte Ehe in der Bundesrepublik Deutschland wird geschieden, Scheidungskinder galten lange Zeit als besonders belastet oder als Problemkinder, Scheidung wurde als stark schädigend begriffen, während die vollständige Familie eine weit positivere Entwicklungsmöglichkeit für Kinder bot ... Dieses einseitige Bild hat sich heute gewandelt zugunsten einer differenzierteren Auffassung, nachdem Scheidungskinder kein Ausnahmephänomen mehr darstellen und uneheliche Kinder nicht mehr stigmatisiert werden. Auch die sog. Normalfamilien werden heute kritischer und differenzierter wahrgenommen. Nachdem die Kindszuteilung heute nicht mehr rigide zum Vater aus wirtschaftlichen(wie zu Beginn des 20.Jhdts.) oder zur Mutter aus entwicklungspsychologischen Gründen (wie zu Mitte des 20.Jhdts.), sondern flexibel erfolgt, entstehen gleichwohl für viele Kinder enorme Belastungen, wenn die Eltern sich nicht einigen können.
Oliver Neumann, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Ist eine Scheidung für die Kinder notwendigerweise eine Katastrophe? Welche langfristigen Folgen kann eine Scheidung haben? Was weiß man über Entwicklungsbedingungen der Kinder in Folgefamilien? Inhaltsverzeichnis
Vorwort 5
Einleitung 11 1. Scheidungsforschung gestern und heute 13 Teil l Die Vorscheidungsfamilie 17 2. Die Familie an der Grenze zum schädlichen Stress 19 2.1 Auswirkungen von Elternkonflikten auf die Kinder 22 2.1.1 Auswirkungen auf den Säugling 24 2.1.2 Auswirkungen auf Kinder ab dem zweiten Lebensalter 25 2.1.3 Eigenschaften des Konfliktes 26 2.2 Ängste der Kinder vor der Scheidung der Eltern 29 Teil II Die Scheidungsfamilie 33 3. Die Situation geschiedener Elternpaare 35 4. Die Situation des Kindes 37 5. Scheidungsfolgen beim Kind 39 5.1 Positive Scheidungsfolgen 39 5.2 Negative Auswirkungen 40 5.3 Kurzfristige Auswirkungen 42 5.3.1 Einfluss des Alters 43 5.3.2 Einfluss des Geschlechts 45 5.4 Langfristige Auswirkungen 46 6. Prävention und Intervention 53 6.1 Mediation 53 6.2 Förderliches Elternverhalten 54 7.3 Begutachtung 72 7.3.1 Ablauf der Begutachtung 72 7.3.2 Kriterien der Kindszuteilung 79 7.3.3 Abfassung des Gutachtens 89 7.3.4 Kindszuteilungsgutachten und sexuelle Ausbeutung 91 Teil III Nach der Scheidung 93 8. Gemeinsame elterliche Sorge 95 8.1 Verschiedene Modelle 95 8.2 Bedeutung der sogenannten «elterlichen Sorge» 95 8.3 Minimalbedingungen für ein gemeinsames Sorgerecht 96 8.4 Herausforderungen an Eltern mit gemeinsamem Sorgerecht 97 9. Das Kind und der nicht sorgeberechtigte Elternteil 99 9.1 Regelmäßigen Kontakte aus der Elternperspektive 100 9.2 Regelmäßige Kontakte aus der Sicht des Kindes 102 10. Beziehung zum nicht sorgeberechtigten Vater 105 10.1 Einfluss von mentalen Repräsentationen 107 10.2 Einfluss der Persönlichkeit der Mutter 108 10.3 Einfluss der Persönlichkeit des Vaters 109 10.4 Einfluss der Vater-Kind-Beziehung vor der Scheidung 110 10.5 Einfluss der Häufigkeit und Regelmäßigkeit der Kontakte 112 11. Umgangsrecht/Besuchsrecht 115 11.1 Theorie und Praxis 115 11.2 Klinische Erfahrungen 117 11.3 Probleme bei der Ausübung des Besuchrechtes 119 11.4 Das Besuchsrechtsyndrom 120 11.4.1 Vergangenheitsbezogene Hindernisse auf der Elternebene 122 11.4.2 Gegenwartsbezogene Hindernisse auf der Elternebene 124 11.4.3 Hindernisse auf der Kinderseite. 125 11.5 Wenn Besuche schaden 128 11.5.1 Ausgleichende Faktoren 129 11.6 Besuchsrecht und die Meinung des Kindes 130 11.7 Besuchsrechl bei getreunten Geschwistern 132 11.8 Besuchsrecht und sexuelle Ausbeutung 133 12. Das Begleitete Umgangsrecht/Besuchsrecht 135 12.1 Begleitete Besuche in der Praxis 135 12.2 Idee der Begleiteten Besuche 136 12.3 Entwicklung der Begleiteten Besuchstage 137 12.4 Rechtliche Grundlagen 138 12.5 Gründe für Begleitetes Besuchsrecht 139 12.6 Das Spannungsfeld der Begleiteten Besuche 143 12.7 Richtlinien der für die Begleitung von Familien 144 12.8 Empirische Befunde 146 12.9 Klinische Erfahrung 147 13. Loyalitätskonflikte. 151 14. Ablehnung eines Elternteils und PAS (Parental Alienation Syndrome) 153 14.1 Gründe für die Ablehnung 153 14.2 Drei Komponenten des PAS 155 14.3 Schweregrade von PAS 155 14.4 Verhaltensmerkmale der manipulierten Kinder 157 14.5 Persönlichkeit des entfremdenden Elternteils 158 14.6 Verhaltensmerkmale des entfremdenden Elternteils 160 14.7 Merkmale des geschädigten Elternteils 161 14.8 Problematische Aspekte des PAS-Konzeptes 162 Teil IV Das Kind in der Folgefamilie 165 15. Einelternfamilie: Mutter und Kind(er) 167 16. Die Stieffamilie 169 16.1 Strukturelle Merkmale 169 16.2 Entwicklung der Stieffamilie 170 16.3 Der Stiefvater 172 16.4 Position und Rolle des Stiefvaters 172 16.5 Stile des Stiefvater-Verhaltens. 174 17 Die Stiefmutter 177 17.1 Stiefmütter ohne eigene Kinder 178 17.2 Mütter in Zweitehen mit Stiefkindern 179 18. Die Kinder in der Stieffamilie 181 19. Die leibliche Mutter 185 20. Der leibliche Vater 187 21. Die Partnerschaft in Stieffamilien 189 22. Auswirkungen der Wiederverheiratung der Mutter auf die Kinder 191 22.1 Familienklima 191 22.2 Allgemeine Anpassung 192 22.3 Geschlecht und Alter 193 22.4 Nähe und Distanz zum Stiefvater 194 22.5 Vergleich Stiefkinder-Einelternkinder 195 22.6 Diskussion der Ergebnisse 196 22.7 Aussichten 198 23. Bibliographie 201 23.1 Auswirkungen der Scheidung 201 23.2 Rechtliche und klinische Sicht des Sorge- und Besuchsrechts 204 23.3 Bedeutung des Kontakts mit dem anderen Elternteil 205 23.4 Begleitete Besuche zwischen Eltern und Kinder 207 23.5 Elterliche Nachscheidungsbeziehung und Kindeswohl 209 23.6 Elterlicher Konflikt und Gewalt in der Familie: Auswirkungen auf die Kinder 210 23.7 Loyalitätskonflikt und Parental Alienation Syndrome (PAS) 211 23.8 Intervention und Unterstützungssysteme 212 23.9 Stieffamilien 214 Weitere Titel aus der Reihe Klinische Praxis |
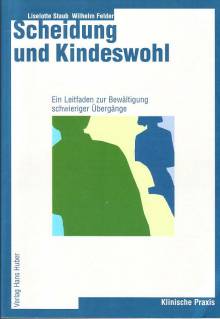
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen