|
|
|
Umschlagtext
Schulentwicklungsprozesse im Sinne der Entwicklung von Einzelschulen gelten als ein Instrumentarium, um ein friedvolles und gerechtes Miteinander an der Schule umsetzen zu können. Pluralisierungstendenzen fordern hier auch dazu heraus, sich mit der Frage nach Religion und religiöser Pluralität in der Schule auseinanderzusetzen. Die Autorin verknüpft den aktuellen Schulentwicklungsdiskurs mit theologischen und religionspädagogischen Perspektiven und legt eine systematische Analyse der Bedeutung von Religion und religiöser Pluralität in der Schulentwicklung vor. Ergänzend dazu wird mithilfe einer qualitativ-empirischen Studie aus Sicht katholischer ReligionslehrerInnen unter anderem dargelegt, wie Religion von ihnen an der Schule wahrgenommen und welche Bedeutung religiöser Pluralität in Schulentwicklungsprozessen zugeschrieben wird.
Dr.in Edda Strutzenberger-Reiter ist Hochschullehrende im Bereich Religionspädagogik und Humanwissenschaften an der Kirchlich Pädagogischen Hochschule in Wien sowie selbstständige Beraterin. Rezension
Schulentwicklung und Schulprofil sind in aller Munde, seitdem den Schulen von der Kultusbürokratie mehr Eigenverantwortung zugestanden und von ihnen erwartet wird. Entsprechend bringen sich die verschiedenen schulischen und außerschulischen Bereiche in Stellung: sportliche, sprachliche, musische, naturwissenschaftliche oder kulturell-ästhetische Profilbildung wird entwickelt ... Warum nicht auch Religion als Möglichkeit der Schulentwicklung nutzen?! In dieser Wiener Dissertation von 2012 verknüpft die Autorin den aktuellen Schulentwicklungsdiskurs mit theologischen und religionspädagogischen Perspektiven und legt eine systematische Analyse der Bedeutung von Religion und religiöser Pluralität in der Schulentwicklung vor.
Oliver Neumann, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Praktische Theologie heute Reihe herausgegeben von Altmeyer, Stefan / Bauer, Christian / Fechtner, Kristian / Gerhards, Albert / Klie, Thomas / Kohler-Spiegel, Helga / Noth, Isabelle / Wagner-Rau, Ulrike Die Reihe "Praktische Theologie heute", herausgegeben von namhaften Praktischen Theologen beider Konfessionen, wendet sich an Theologinnen in Ausbildung und Beruf. Untersuchungen, Monographien und Beiträgerbände zu den praktisch-theologischen Einzeldisziplinen wie auch zu neuen theologischen Handlungsfeldern und Deutungsmustern bilden ein breites Publikationsforum. Die Reihe stellt sich den veränderten Bedingungen christlich-kirchlichen Handelns und will der Vielfalt der Themen und Aufgaben Rechnung tragen. Gefragt ist nach einer Theologie, die sich als Theorie der gegenwärtigen und der zu erneuernden Praxis der Christen und Gemeinden versteht. Inhaltsverzeichnis
I. Einleitung 15
1. Gesellschaftliche Wahrnehmung von Religion 15 2. Zusammenhang zwischen Religion und Schulentwicklung 17 3. Wissenschaftliche Verortung 19 3.1. Schulentwicklungsforschung 19 3.2. Qualitative Sozialforschung 19 3.2.1. Grundlagen qualitativer Sozialforschung 19 3.2.2. Grundlagen rekonstruktiver Sozialforschung 21 3.3. Theologische und religionspädagogische Prämissen 22 3.3.1. Theologie des Subjekts nach Henning Luther 22 3.3.2. Theologische Dignität von Schule 23 3.3.3. Heil und Unheil als leitende theologische Perspektive 25 4. Aufbau und Überblick 28 II. Begründungszusammenhang: Zum Verhältnis von Schule und Religion 31 5. Begriffsverständnis von „Religion“ und „Religiosität“ 31 5.1. Einführung in den Diskurs nach Hans Zirker und Burkard Porzelt 31 5.2. Verständnis von Religion nach Hans-Günter Heimbrock 34 5.2.1. Materiale Dimension von Religion 36 5.2.2. Funktionale Dimension von Religion 37 5.2.3. Semiotische und phänomenologische Dimension von Religion 37 5.3. Religiosität als subjektive Dimension von Religion 38 5.4. Ein weiter Religionsbegriff als heuristischer Rahmen 40 5.5. Zusammenfassung 42 6. Schule und Religion 44 6.1. Religion im Schulleben 44 6.2. Religion aus Perspektive Jugendlicher 46 6.3. Religion als Teil von Bildungsprozessen 47 6.3.1. Erziehungswissenschaftlicher Bildungsbegriff 47 6.3.2. Theologischer Bildungsbegriff 49 6.3.3. Religionin Bildungsprozessen aus erziehungswissenschaftlicher Perspektive 51 6.3.4. Religion in Bildungsprozessen aus religionspädagogischer Perspektive 52 6.4. Zusammenfassung 54 III. Pluralität: Zentrales Kennzeichen postmoderner Gesellschaft 57 7. Gesellschaftliche Pluralisierungsprozesse 57 7.1. Differenzierung und Spezialisierung von Gesellschaft 57 7.2. Individualisierung von Lebensentwürfen 58 7.3. Religiöse Vielfalt in Pluralisierungsprozessen 59 7.3.1. Religiöse Pluralität auf Makro-, Meso- und Mikroebene 59 7.3.2. Religiöse Pluralität aus Perspektive Jugendlicher 60 7.4. Religionen im Umgang mit religiöser Pluralität 62 7.4.1. Wahrheitsfrage in einer religiös pluralen Welt 62 7.4.2. Religiöse Individualisierung 63 7.5. Zusammenfassung 64 8. Pädagogische Relevanz von Pluralität 65 8.1. Schulen im Dienst einer pluralen Gesellschaft 65 8.2. Pädagogik der Vielfalt nach Annedore Prengel 66 8.2.1. Wahrnehmung von Differenz 66 8.2.2. Intersubjektive Anerkennung 68 8.3. Religionspädagogische Perspektiven 70 8.3.1. Pluralität als Lernchance erkennen 71 8.3.2. Individualisierte Religiosität Jugendlicher wahrnehmen 72 8.4. Zusammenfassung 73 IV. Theoretische Fundierung: Schulentwicklung und Religionspädagogik 75 9. Grundlagen der Schultheorie 75 9.1. Kennzeichen von Schule 75 9.2. Aktuelle Herausforderungen für Schulen 76 9.3. Bezug zum Lehrplan 77 9.4. Funktionale Perspektive nach Helmut Fend 78 9.4.1. Erste Funktion: Enkulturation 80 9.4.2. Zweite Funktion: Qualifikation 80 9.4.3. Dritte Funktion: Allokation und Selektion 81 9.4.4. Vierte Funktion: Gesellschaftliche Integration 81 9.4.5. Individuelle Relevanz der vier Funktionen 83 9.4.6. Widersprüchlichkeiten der Funktionen 83 9.4.7. Handeln im System: Konzept der Rekontextualisierung 84 9.5. Schule als Gendered Institution 86 9.5.1. Konstruktion von Geschlecht 86 9.5.2. Merkmale von Schule als Gendered Institution 89 9.6. Religionspädagogische Perspektiven 90 9.6.1. Erschließen religiöser Symbolsysteme und Traditionen 91 9.6.2. Fördern von Interreligiosität 92 9.6.3. Entwickeln von Haltungen und Einstellungen 92 9.6.4. Herausforderung Leistungsbeurteilung 93 9.6.5. Option für Würde und Freiheit des Menschen 93 9.7. Zusammenfassung 94 10. Schule als Organisation 95 10.1. Soziologische Perspektive 95 10.2. Systemtheoretische Perspektive 97 10.3. Mikropolitische Perspektive 98 10.3.1. Interaktion als Mittel zum Machtgewinn 99 10.3.2. Verschränkung von Handlung und Struktur 100 10.4. Kennzeichen der Organisation Schule 102 10.5. Zusammenfassung 104 11. Ausgewählte Perspektiven der Schulentwicklungsforschung 106 11.1. Verständnis von Schulentwicklung 106 11.2. Organisations-, Unterrichts- und Personalentwicklung 107 11.3. Schulen als soziale Systeme 111 11.4. Organisationskultur 113 11.5. Lernende Schule 116 11.6. Prozessethik 118 11.7. Konkretisierung: Widerstände und Leitung 120 11.8. Zusammenfassung 122 12. Theologisches Verständnis von Schulentwicklung 124 12.1. Blick auf Gerechtigkeit und ein geglücktes Leben 124 12.2. Reich-Gottes-Gleichnisse: Kriterien für Schulentwicklung 125 12.2.1. Theologie des Reiches Gottes 125 12.2.2. Relevanz für Schulentwicklungsprozesse 127 12.3. Anthropologie der Würde 129 12.3.1. Freiheit und Geschlecht 129 12.3.2. Anerkennung von Religiosität und religiöser Pluralität 131 12.4. Zusammenfassung 132 13. Fazit: Religionspädagogische Konkretion 134 13.1. Allgemeine religionspädagogische Perspektiven 134 13.1.1. Religiöses Lernen als Beitrag zu einer guten Schule 134 13.1.2. Religion als Irritation in der losen Kopplung von Schule 134 13.1.3. Mikropolitik: Gerechte Ressourcenverteilung in der Schule 135 13.1.4. Menschen im Mittelpunkt von Schulentwicklung 135 13.1.5. Systemtheorie: Sich selbst kritisch anfragen lassen 136 13.1.6. Anerkennung religiöser Pluralität in Organisationskulturen 136 13.1.7. Zwischenmenschliche Begegnung im Zentrum der lernenden Schule 137 13.1.8. Prozessethik: Umgang mit religiöser Differenz als Kriterium 138 13.2. Beitrag des Religionsunterrichts zu Schulentwicklung 139 13.2.1. Spezifika des Religionsunterrichts 139 13.2.2. Religiöse Bildung als Ressource für Schulentwicklung 141 13.2.3. Umgang mit (religiöser) Pluralität lernen 143 13.3. Zusammenfassung 145 V. ReligionslehrerInnen als Forschungssubjekte und Beteiligte an Schulentwicklung 147 14. Biografie- und Kompetenzforschung 147 14.1. Berufsbiografische LehrerInnenforschung 148 14.2. Kompetenzforschung 149 14.2.1. Fach-, Sozial-, Methoden- und Personalkompetenz 150 14.2.2. Schulentwicklungskompetenzen 151 14.2.3. Religionspädagogische Kompetenzen 152 14.3. Grundlegende Haltung: Respekt 154 14.4. Zusammenfassung 155 15. Spezifika des Berufs ReligionslehrerIn 156 15.1. ReligionslehrerInnen unter Kritik 156 15.2. Zentrale Bedeutung der Person 157 15.3. Empirische Forschungsergebnisse 158 15.3.1. Zur Situation österreichischer ReligionslehrerInnen 158 15.3.2. Pädagogische Ziele von ReligionslehrerInnen 160 15.3.3. Religionsunterricht im Kontext von Multireligiosität 162 15.4. Zusammenfassung 163 16. Beteiligung von ReligionslehrerInnen an Schulentwicklung 165 16.1. Mitverantwortung als Handlungsgrundlage 165 16.2. Organisations- und Vermittlungskompetenz 167 16.3. Grenzen des Engagements 168 16.4. Zusammenfassung 169 VI. Methodologie und Methode der empirischen Erhebung 171 17. Dokumentarische Methode 171 17.1. Theoretische Grundlagen 171 17.2. Konjunktives und kommunikatives Wissen 173 17.3. Vom thematischen Gehalt zum Orientierungsrahmen 174 17.4. Problemzentriertes Interview und dokumentarische Methode 177 17.4.1. Gemeinsames und Unterscheidendes 177 17.4.2. Begründung für das Erhebungsinstrument 178 17.5. Zusammenfassung 179 18. Methodische Überlegungen und ihre Umsetzung 181 18.1. Leitende ethische Kriterien 181 18.2. Theologische Kriterien qualitativer Forschung 183 18.3. Das problemzentrierte Interview 185 18.3.1. Grundlagen 185 18.3.2. Problemzentrierung, Orientierung am Gegenstand und Prozessorientierung 186 18.3.3. Instrumente des Problemzentrierten Interviews 187 18.3.4. Gesprächsstrategien 187 18.4. Auswertungsschritte 188 18.5. Sample 191 18.6. Beschreibung des Leitfadens 193 18.7. Zusammenfassung 195 VII. Die Forschungsergebnisse: Diskursbeschreibung 197 19. Die InterviewpartnerInnen 198 20. Verständnis von Schulentwicklung 201 20.1. Erster Orientierungsrahmen: Hierarchie der Unterrichtsfächer 201 20.2. Zweiter Orientierungsrahmen: Als ReligionslehrerIn spezifische Themen repräsentieren 209 20.3. Dritter Orientierungsrahmen: Strukturelle Aspekte 212 20.4. Vierter Orientierungsrahmen: Abgrenzen gegenüber fremden Vorgaben 218 20.5. Fazit und Interpretation: Verständnis von Schulentwicklung 221 21. Professionsverständnis von ReligionslehrerInnen 223 21.1. Erster Orientierungsrahmen: Schulische Hierarchie als Basis der Selbstwahrnehmung im System 223 21.2. Zweiter Orientierungsrahmen: Spezifische Rahmenbedingungen für ReligionslehrerInnen 234 21.3. Fazit und Interpretation: Umstrittene Sonderrolle 236 22. Bedeutung des Glaubens für die Beteiligung an Schulentwicklung 239 22.1. Erster Orientierungsrahmen: Grenzen zwischen Persönlichem und Beruflichem 239 22.2. Zweiter Orientierungsrahmen: Verhältnis zur Kirche 243 22.3. Fazit und Interpretation: Glaube betrifft, motiviert und fordert heraus 247 23. Lernen im Schulentwicklungsprozess 249 23.1. Erster Orientierungsrahmen: Negative Erfahrungen mit (basis)demokratischen Prozessen 249 23.2. Zweiter Orientierungsrahmen: Einfluss externer Vorgaben auf Schulentwicklung 252 23.3. Dritter Orientierungsrahmen: Soziale Dimension des Lernens 253 23.4. Vierter Orientierungsrahmen: Lernen als negative emotionale Erfahrung 258 23.5. Fünfter Orientierungsrahmen: Persönlichkeitsentwicklung 261 23.6. Fazit und Interpretation: Lernen in unterschiedlichen Dimensionen 262 24. Religiöse Pluralität 264 24.1. Orientierungsrahmen: Religiöse Pluralität als Problem 264 24.2. Fazit und Interpretation: Herausforderungen aufgrund religiöser Pluralität 270 25. Vorstellungen einer guten Schule 271 25.1. Erster Orientierungsrahmen: Funktionen und Aufgaben von Schulen 271 25.2. Zweiter Orientierungsrahmen: Inner- und außerschulische Vorgaben 272 25.3. Dritter Orientierungsrahmen: Wohlergehen der SchülerInnen 278 25.4. Vierter Orientierungsrahmen: Soziale Dimensionen als Indikatoren für gute Schulkultur 281 25.5. Fazit und Interpretation: Gute Schule gemessen an der Realität 283 26. Zusammenfassung der Diskursbeschreibung 284 27. Religionspädagogische Perspektiven 287 27.1. Ein- und Mehrdimensionalität von Religion 287 27.2. Bedeutung von ReligionslehrerInnen in Schulentwicklung 288 27.2.1. Umstrittene Sonderstellung des Unterrichtsfaches Religion 288 27.2.2. ReligionslehrerInnen als RepräsentantInnen von Religion 289 27.2.3. Kompetenzen im Bereich Ethik und Krisenbegleitung 290 27.3. Schulentwicklung und Religion 291 27.3.1. Strukturelle Probleme mit Religionsunterricht 291 27.3.2. Demokratisierung und Gerechtigkeit 291 27.4. Herausforderungen aufgrund religiöser Pluralität 292 27.5. Wissenschaftlicher Ertrag der Arbeit 293 Bibliografie 295 Anhang 305 1. Leitfaden 305 2. Einwilligungserklärung 307 3. Transkriptionsregeln 308 4. Email 309 Weitere Titel aus der Reihe Praktische Theologie heute |
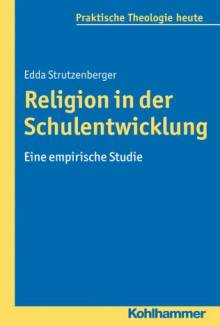
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen