|
|
|
Umschlagtext
Eines der auffälligsten Merkmale postmoderner Gesellschaften ist ihr Pluralismus, gerade auch im Bereich der Religion. Unterschiedliche, auch widersprüchliche Überzeugungen treffen aufeinander, Vertrautes wird oft absolut gesetzt, Fremdes ignoriert oder abgelehnt. Denk-Aporien und zwischenmenschliche Konflikte sind nicht selten die Folge. Am Beispiel der Gottesfrage zeigt Bornhauser Alternativen auf, die konstruktiv auf widersprüchliche Überzeugungen einzugehen erlauben. Auf der Grundlage eines Denkens in Komplementarität wird ein Konzept kirchlicher Erwachsenenbildung entwickelt, mit dem ein lebensförderlicher Umgang mit widersprüchlichen Sichtweisen und Meinungen eingeübt werden kann. So wird die Möglichkeit eröffnet, eines der drängendsten Probleme unserer Gegenwart, den Konflikt zwischen Vertrautem und Fremdem, einer Lösung näherzubringen.
Das Buch bietet neben der theoretischen Grundlegung des Konzepts auch zahlreiche didaktische Hilfestellungen zur Planung und Durchführung von Veranstaltungen sowie eine Reihe ausgeführter Praxisbeispiele zur Gottesfrage und zu anderen theologischen Themen. Dr. Thomas Bornhauser ist Studienleiter im reformierten Tagungszentrum Rügel (Kanton Aargau). Rezension
"Wer heute eine Erwachsenenbildungsveranstaltung durchführt, muss darauf gefasst sein, dass die Teilnehmenden ganz unterschiedliche Ansichten zum jeweiligen Thema mitbringen." (S. 13) Dies, so stellt der Autor mit Recht fest, gilt insbesondere für das Thema "Gott". Vielen Menschen ist das kirchlich-theologische Gottesbild fremd und es hat mit ihrem eigene Gottesbild wenig zu tun. Die Pluralität der Meinungen in unserer Gesellschaft korrespondiert mit einer Pluralität der Meinungen auch bei theologischen Themen.
Exemplarisch zeichnet der Autor 3 Gottesbilder, die er auch einem bestimmten Frömmigkeitsstil zuordnet: Aus traditioneller Bibelgläubigkeit folgt in seinem konkreten Beispiel ein Gottesbild vom großen, fernen jenseitigen Gott. Humanitäres Engagement führt zum Gott, der im Nächsten begegnet und schwach, klein und niedrig ist. Mystisches Erleben sieht in Gott das Ereignis der Harmonie, der beziehung, des Werdens und Vergehens. Aus den unterschiedlichen Gottesbildern und Frömmigkeitsstilen wiederum entstehen Gemeindegruppen, die nun wenig miteinander anfangen können, im schlimmsten Falle sich sogar gegenseitig den (r)echten Glauben absprechen, denn für sie gibt es nur ein Entweder - Oder. Für eine christliche Gemeinde jedoch ist das nicht der richtige Umgang mit Vielfalt. Zur Überwindung dieser Haltung schlägt der Autor als Lösung das Denken in Komplementarität vor. Vorbild dafür ist die Physik, die das Entweder-oder-Denken angesichts des Welle-Teilchen Problems beim Verständnis des Elektrons aufgegeben hat zugunsten eines Sowohl-als-auch Modells. Bornhauser entwickelt nun für das Thema "Gott" ein solches Konzept, theoretisch fundiert (Kapitel 7 und 8) und mit praktischen Beispielen für die Durchführung. (Kapitel 9) Wertvolle Ergänzungen bieten die Exkurse und die Ausweitung auf andere Themen der Erwachsenenbildung (10. Kapitel). Den Praktiker mag zunächst die viele Theorie etwas abschrecken, die Beschäftigung mit den verschiedenen Konzepten der Komplementarität in der Physik (Kapitel 2 und 3) und in der Pädagogik aber lohnt sich (Kapitel 4-6). Das Buch ist eine große Hilfe für den Umgang mit pluralen Meinungen in Bibel, Unterricht und Katechese. Peter Förg, www.lehrerbibliothek.de Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Vorwort 11 0. Einleitung 13 0.0. Vorbemerkungen 13 0.1. Zum religions soziologischen Hintergrund der Arbeit: Pluralismus als Zeiterscheinung und als Problem 13 0.2. Präzisienmg des Problems 15 0.2.1. Drei exemplarische Gottesbilder 15 0.2.2. Elementarisierung 17 0.3. Mein Lösungsvorschlag in Kürze 19 0.4. Zur Methodik der Arbeit 21 0.5. Zum Stil dieses Buches 22 0.6.-0.9. Exkurse im Anhang, 157-168 1. Kapitel: Die Wurzeln des Komplementaritätsprinzips in der Physik 23 1.0. Vorbemerkungen 23 1.1. Vorgeschichte der Quantentheorie 23 1.1.1. Die Physik an der Wende zum 20. Jahrhundert 23 1.1.2. Das Dualismusproblem 25 1.2. Das Komplementaritätsprinzip 26 1.2.1. Niels Bohr 26 1.2.2. Die Überwindung des Dualismusproblems 27 1.3. Eigentümlichkeiten des Komplementaritätsprinzips 28 1.3 .0. Vorbemerkung 28 1.3.1. Klassische Begriffe 29 1.3.2. Unschärfe 30 1.3.3. Ganzheit 31 1.3.4. Superposition 32 2. Kapitel: Anwendungen des Komplementaritätsprinzips außerhalb der Physik 35 2.0. Vorbemerkungen 35 2.1. Dualismus von Struktur und Funktion 35 2.2. Exogene und endogene Evolution 36 2.3. Schichten der Wirklichkeit 37 2.4. Verschiedene Zugänge zum Menschen 39 2.5. Erkenntnismodalitäten 40 2.6. Mathematisches 42 3. Kapitel: Anwendungen des Komplementaritätsprinzips in der Theologie 45 3 .0. Vorbemerkung 45 3.1. Niels Bohr 45 3.2. lan G. Barbour 47 3 .2.0; Vorbemerkungen 47 3.2.1. Das Modell 47 3.2.2. Komplementarität von Gottesmodellen 49 3.2.3. Kriterien des Glaubens 51 3.3. Ergänzende Stimmen weiterer Autoren 52 3.3 .0. Vorbemerkungen 52 3.3.1. William H. Austin 52 3.3.2. Christopher B. Kaiser 55 3.3.3. Richard Schlegel 59 3.3.4. K. Helmut Reich 62 3.3.5. Georg Kugler und Herbert Lindner 64 4. Kapitel: Vom Komplementaritätsprinzip zum Erwachsenenbildungskonzept 65 4.1. Elementare Konsequenzen des Komplementaritätsprinzips 65 4.1.0. Vorbemerkungen 65 4.1.1. Eine Taxonomie der verschiedenen Arten von Komplementarität 65 4.1.2. Konkretisierung im Blick auf das Thema ,Gott' 67 4.2.-4.4. Exkurse im Anhang, 169-181 4.5. Konsequenzen für die Konzeption kirchlicher Erwachsenenbildung 73 4.5 .0. Vorbemerkungen 73 4.5.1. Grundsätzliches 73 4.5.2. Methodisches 74 5. Kapitel: Neuere religiöse Bildungskonzepte 77 5 .0. Vorbemerkungen 77 5.1. Das Konzept von Gottftied Orth 77 5.1.1. Voraussetzungen 77 5.1.2. Durchführung 78 5.1.3. Diskussion 79 5.2. Das Konzept von Berthold Uphoff 81 5 .2.1. Voraussetzungen 81 5.2.2. Durchführung 82 5.2.3. Diskussion 84 5.3. Das Konzept von Martina Blasberg-Kuhnke 86 5.3 .1. Voraussetzungen 86 5.3.2. Durchführung 87 5.3.3. Diskussion 89 5.4. Das Konzept von Rudolf Englert 90 5 .4.1. Voraussetzungen 90 5.4.2. Durchführung 91 5.4.3. Diskussion 94 6. Kapitel: Hilfreiche Anregungen aus dem Konstruktivismus 97 6. 0. Vorbemerkungen 97 6.1. Grundzüge des Konstruktivismus 97 6.1.1. Einige zentrale Merkmale 97 6.1.2. Diskussion 100 6.2. Exkurs im Anhang, 182-183 6.3. Pädagogische Implikationen des Konstruktivismus 102 6.3.1. Einige zentrale Punkte 102 6.3.2. Diskussion 103 6.4. Konstruktivistische Erwachsenenbildung 105 6.4.0. Vorbemerkungen 105 6.4.1. Schwerpunkte 106 6.4.2. Diskussion 109 7. Kapitel: Komplementaristische Bildung im Kontext zeitgenössischer Bildungskonzepte 113 7.0. Vorbemerkungen 113 7.1. Erträge 113 7.1.0. Vorbemerkungen 113 7.1.1. Zur Pluralität 115 7.1.2. Zur Unbeliebigkeit 115 7.1.3. Offene Fragen 116 7.2. Rahmenbedingungen komplem~ntaristischer Bildung 117 7.2.1. Besonderheiten der Bildungsarbeit im kirchlichen Kontext 117 7.2.2. Bildungstheoretische Überlegungen 118 7.3. Exkurs im Anhang, 184-191 8. Kapitel: Konkretisierung des komplementaristischen Erwachsenenbildungskonzepts 121 8.0. Vorbemerkungen 121 8.1. Die Elemente komplementaristischer Erwachsenenbildung 121 8.1.0. Vorbemerkungen 121 8.1.1. Sammeln 122 8.1.2. Ordnen 123 8.1.3. Konstruieren 124 8.1.4. Kontextualisieren 125 8.2. Zur veranstaltungsleitenden Person 127 8.2.1. Zur Persönlichkeit 127 8.2.2. Die Vorbereitung auf eine Veranstaltung 128 8.2.3. Heikle Punkte bei der Gesprächsfiihrung 129 8.2.4. Bildungskompetenz erfordert Alltagskompetenz 130 8.3. Schlußbemerkungen 130 9. Kapitel: Beispiele aus der kirchlichen Erwachsenenbildungspraxis zum Thema "Gott" 133 9 .0. Vorbemerkungen ' 133 9.1. Zum Element ,Sammeln.' 133 9.2. Zum Element , Ordnen' 136 9.2.1. Verschiedene Ordnungsmöglichkeiten 136 9.2.2. Exkurs im Anhang, 192-194 9.2.3. Farbenkreis 138 9.2.4. Stufenmodell 138 9.3. Zum Element ,Konstruieren' 140 9.4. Zum Element ,Kontextualisieren' 142 10. Kapitel: Beispiele aus der kirchlichen Erwachsenenbildungspraxis zu weiteren Themen 145 10.0. Vorbemerkungen 145 10.1. Bibelverständnis 145 10.2. Taufe 146 10.3. Ekklesiologie 149 10.4. Evangelisation 150 10.5. Opfer 151 10.6. Christologie 152 10.7. Logik 152 Anhang: Exkurse 157 0.6. Exkurs: Spuren der Gottesmodelle 157 0.6.0. Vorbemerkungen 157 0.6.1. Spuren des ,blauen' Gottesmodells 157 0.6.2. Spuren des ,roten' Gottesmodells 159 0.6.3. Spuren des ,gelben' Gottesmodells 160 0.7. Exkurs: Terminologisches zu ,Widerspruch' und ,Gegensatz' 163 0.8. Exkurs: Zur klassischen Logik 164 0.9. Exkurs: Denken in Komplementarität in formalisierter Gestalt 167 4.2. Exkurs: Die Bibel als ,tertium comparationis'? 169 4.3. Exkurs: Fundamentaltheologisches 171 4.3.0. Vorbemerkungen 171 4.3.1. Erkenntnistheoretisches 171 4.3.2. ZUTIl Problem der, Wahrheit' 172 4.4. Exkurs: Gemeinsamkeiten mit systematisch-theologischen Positionen .. 174 4.4.0. Vorbemerkungen 174 4.4.1. Gemeinsamkeiten mit biblischen Autoren 174 4.4.2. Gemeinsamkeiten mit zeitgenössischen Positionen 178 6.2. Exkurs: Konstruktivismus und Logik 182 7.3. Exkurs: Die Freiburger Studien über Wesen und Entwicklung des Denkens in Komplementät 184 7.3.0. Vorbemerkungen 184 7.3.1. Niveaus des Denkens in Komplementarität 184 7.3.2. Beziehung Piagetstufen - Komplementaritätsniveaus 185 7.3.3. Komponenten des Denkens in Komplementarität 186 7.3.4. Kompetenz und Performanz 187 7.3.5. Diskussion 188 7.3.6. Kommentar im Blick auf die kirchliche Erwachsenenbildung 189 9.2.2. Exkurs: Zur beschränkten Verwendbarkeit des Trinitätsdogmas in der kirchlichen Erwachsenenbildung 192 Literaturverzeichnis 195 Namen- und Stichwortregister 201 Weitere Titel aus der Reihe Praktische Theologie heute |
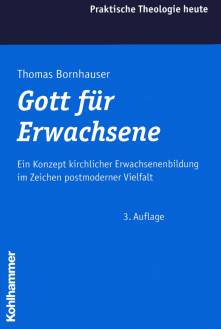
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen