|
|
|
Umschlagtext
Das Lehrbuch führt in die personzentrierte Persönlichkeitstheorie und in die allgemeine wie auch spezielle Störungstheorie ein. Dabei erweitert es die Ideen von Carl Rogers im Rahmen aktueller Psychotherapie(-forschung). Unterschiedliche Beziehungskonzepte werden als Basis einer differenzierten Therapietechnik beschrieben und mit Fallbeispielen häufiger Störungsformen (Angst-, depressive, somatoforme, Ess-, Persönlichkeitsstörungen) praxisnah veranschaulicht. So entsteht jeweils ein plastisches Bild von der "inneren Welt" der Klientinnen und Klienten. Schritt für Schritt wird die therapeutische Orientierung an "Schlüsselthemen" in Beispieldialogen erklärt. Die Arbeit mit existenziellen Fragen und Träumen sowie Focusing, Gruppen-, Paar- und Familientherapie runden das umfassende Lehrbuch ab. Wer in Beratung und Psychotherapie personzentriert arbeiten will, braucht dieses Buch!
Dr. med. Jobst Finke, Essen, Facharzt für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie sowie für Neurologie-Psychiatrie, ist in eigener Praxis, Supervision und als Ausbilder u.a. für Gesprächspsychotherapie (GwG, ÄGG) tätig. Rezension
Besonders gut eignet sich nach Auffassung des Autors zur Behandlung von Persönlichkeitsstörungen der Personzentrierte Ansatz nach Carl Rogers, der auf Wertschätzung und einfühlsamem Verstehen basiert. Deshalb werden in diesem Buch nicht nur in dem umfangreichen Kap. 9 die wesentlichen Störungsbilder thematisiert (S. 184-331), sondern eingangs wird die Personzentrierte Psychotherapie in ihren Kernmerkmalen, z.B. mit ihrem Ansatz des "Nicht-Direktiven" (vgl. Kap. 5) erläutert (Kap. 3-8), bevor abschließend Gruppen- und Paartherapie thematisiert werden (Kap. 11-12) und das Thema Traumverstehen (Kap. 13). Lehrer/innen haben es in ihrem alltäglichen Berufsleben mit Menschen zu tun und manche dieser Menschen (und auch manche Lehrer/innen) haben eine Persönlichkeitsstörung - und dann ist der Umgang mit diesen Menschen im Unterricht (oder auch im Lehrerzimmer) kompliziert. Deshlab ist es sinnvoll, dass Pädagog/inn/en ein Grundwissen hinsichtlich Persönlichkeitsstörungen haben. Dabei kann dieses Buch behilflich sein. Denn es beschreibt und umgreift den gesamten Bereich von Persönlichkeitsstörungen. Als Persönlichkeitsstörungen bezeichnet man in der Klinischen Psychologie diverse dauerhafte Verhaltensmuster mit Beginn in Kindheit und Jugend, die sich von einem situationsangemessenen („normalen“) Erleben und Verhalten je charakteristisch unterscheiden. Sie sind durch relativ starre mentale Reaktionen und Verhaltensformen gekennzeichnet, vor allem in Konfliktsituationen. Dabei ist die persönliche und soziale Funktions- und Leistungsfähigkeit ist meistens eingeschränkt.
Oliver Neumann, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Zielgruppe: PsychologInnen, Psychologische und Ärztliche PsychotherapeutInnen, (Sozial-)PädagogInnen und alle in der psychosozialen Beratung Tätigen in Ausbildung und Beruf Inhaltsverzeichnis
1 Zu den ideengeschichtlichen Voraussetzungen der Personzentrierten Psychotherapie 10
1.1 Intuition und Vielfalt gegen rationales Planen und klassifizierendes Ordnen 10 1.2 Das Menschenbild 15 1.2.1 Der „Organismus“ und die „Aktualisierungstendenz“ 15 1.2.2 Die „fully functioning person“ 18 2 Die personzentrierte Persönlichkeits- und Störungstheorie 19 2.1 Die Inkongruenz und ihre Folgen 19 2.1.1 Das organismische Erleben und seine Symbolisierung 19 2.1.2 Gefühle und Bedürfnisse als Aspekte des organismischen Erlebens 23 2.2 Das Selbstkonzept und das Beziehungskonzept 24 2.2.1 Die verschiedenen Aspekte des Selbstkonzeptes 25 2.2.2 Das Beziehungskonzept 29 2.2.3 Die Bindungstheorie 30 3 Die Kernmerkmale in der Personzentrierten Psychotherapie 33 3.1 Kernmerkmal Bedingungsfreie positive Beachtung 34 3.1.1 Die Schwierigkeiten des Bedingungsfreien positiven Beachtens 34 3.1.2 Die Funktionen des Bedingungsfreien positiven Beachtens 35 3.2 Kernmerkmal Einfühlendes Verstehen 36 3.2.1 Charakteristika des Einfühlenden Verstehens 36 3.2.2 Das Vorverständnis des Einfühlenden Verstehens 40 3.2.3 Das Verstehen des Unverständlichen 44 3.2.4 Die Funktionen des Einfühlenden Verstehens 46 3.3 Kernmerkmal Kongruenz/Echtheit 46 3.3.1 Charakteristika von Kongruenz/Echtheit 46 3.3.2 Funktionen von Kongruenz/Echtheit 48 4 Die Beziehungskonzepte in der Personzentrierten Psychotherapie 49 4.1 Die Alter-Ego-Beziehung 49 4.2 Die Dialog-Beziehung 50 4.3 Das Verhältnis von Beobachter- und Teilnehmer-Beziehung 51 5 Das Problem des „Nicht-Direktiven“ 55 5.1 „Lenkung“ in der personzentrierten Gesprächsführung 56 5.2 Die Verantwortlichkeit des Therapeuten/Beraters 57 5.3 Die therapeutische Beeinflussung des Klienten 58 6 Personzentrierte Praxis: Die therapiepraktische Vermittlung der Kernmerkmale 60 6.1 „Therapietechnik“ gegen die Unmittelbarkeit der Begegnung? 60 6.2 Die drei Ebenen: Kernmerkmale, Beziehungskonzepte, Handlungsmuster 64 6.3 Einfühlen und Verstehen 65 6.3.1 Formen und Stufen des Einfühlenden Verstehens 65 6.3.2 Anwendungshinweise für das Einfühlende Verstehen 75 6.4 Beziehungsklären 81 6.4.1 Konzept-Beschreibung 81 6.4.2 Anwendungspraxis 85 6.4.3 Indikation und Funktion des Beziehungsklärens 96 6.4.4 Die therapeutische Beziehung: Risiken und Chancen 98 6.5 Selbstöffnen 101 6.5.1 Konzept-Beschreibung und -Begründung 101 6.5.2 Anwendungspraxis 103 6.5.3 Indikation 114 6.5.4 Risiken 115 6.6 Abwehr-Bearbeitung 116 6.6.1 Konzept-Beschreibung und -Begründung 116 6.6.2 Formen der Widersprüchlichkeit und ihre Bearbeitung 118 7 Weiter- und Parallelentwicklungen zur Personzentrierten Psychotherapie 123 7.1 Focusing 123 Von Heinke Deloch 7.1.1 E. T. Gendlins Theorie der Persönlichkeitsentwicklung und therapeutischen Veränderung 123 7.1.2 Focusing: Der Weg der Veränderung 131 7.1.3 Focusing-orientierte Beratung und Therapie 135 7.1.4 Beispiele aus Therapie-Gesprächen 150 7.1.5 Weiterentwicklungen der Focusing-orientierten Psychotherapie 157 7.1.6 Fazit 158 7.2 Existenzielle Aspekte in der Personzentrierten Psychotherapie 159 Von Gerhard Stumm 7.2.1 Zur Entstehung von Inkongruenz aus existenzieller Sicht 160 7.2.2 Praxisperspektiven 162 7.2.3 Existenzielle Themen 164 7.2.4 Zur Integration existenzieller Aspekte in die personzentrierte Praxis: ein Resümee 170 8 Diagnostik, Indikation und Therapieziele 173 8.1 Die Diagnose in der Personzentrierten Psychotherapie 173 8.1.1 Das innere Bezugssystem und personzentrierte Diagnostik 174 8.1.2 Formen und Funktionen der Diagnostik 177 8.1.3 Kommunikation der Diagnose? 178 8.2 Indikation im Kontext der Wirksamkeitserwartung 179 8.2.1 Die Störungsform 179 8.2.2 Befindlichkeit und Persönlichkeitsstile 180 8.2.3 Ansprechbarkeit auf das Therapieangebot 180 8.3 Therapieziele 181 9 Personzentrierte Psychotherapie verschiedener Störungen 184 9.1 Die störungsbezogene Perspektive 184 9.2 Die Depression 187 9.2.1 Erscheinungsbild und Entstehungsbedingungen 187 9.2.2 Therapiepraxis 194 9.3 Angststörungen 211 9.3.1 Erscheinungsbild und Entstehungsbedingungen 211 9.3.2 Therapiepraxis 216 9.3.3 Besonderheiten des Störungsbildes und der therapeutischen Aufgabe 228 9.4 Somatoforme Schmerz-Störung 230 9.4.1 Erscheinungsbild und Entstehungsbedingungen 230 9.4.2 Therapiepraxis 235 9.5 Persönlichkeitsstörungen 243 9.5.1 Borderline-Persönlichkeitsstörung 246 9.5.2 Narzisstische Persönlichkeitsstörung 266 9.5.3 Abhängige (asthenische) Persönlichkeitsstörung 280 9.5.4 Paranoide Persönlichkeitsstörung 288 9.6 Paranoide Schizophrenie 296 9.6.1 Erscheinungsbild und Entstehungsbedingungen 296 9.6.2 Therapiepraxis 300 9.7 Alkoholabhängigkeit 307 9.7.1 Erscheinungsbild und Entstehungsbedingungen 307 9.7.2 Therapiepraxis 310 9.8 Essstörungen: Bulimie 321 9.8.1 Erscheinungsbild und Entstehungsbedingungen 321 9.8.2 Therapiepraxis 326 10 Gruppen-Psychotherapie 332 10.1 Grundmerkmale von Gruppenpsychotherapie 332 10.1.1 Historische Entwicklung 332 10.1.2 Personzentrierte Beiträge zu Forschung und Therapie 333 10.1.3 Therapie- versus Encounter-Gruppen 333 10.2 Stellung der personzentrierten Gruppenpsychotherapie innerhalb zentraler Gruppentherapie-Konzepte 335 10.2.1 Psychotherapie in der Gruppe 336 10.2.2 Psychotherapie durch die Gruppe 336 10.2.3 Psychotherapie der Gruppe 337 10.2.4 Die Perspektive verschiedener Therapiephasen 338 10.3 Therapiepraxis 339 10.3.1 Thema: Der Protagonist 340 10.3.2 Thema: Die Reaktion auf den Protagonisten 341 10.3.3 Thema: Die Reaktion des Protagonisten auf die anderen 342 10.3.4 Thema: Die Gruppe 343 10.4 Indikation der Gruppen-Psychotherapie 345 10.5 Gruppensetting: Ambulante und stationäre Gruppentherapie 347 11 Paar- und Familientherapie 349 11.1 Paartherapie 349 11.1.1 Ziele und Indikation der Paartherapie 349 11.1.2 Personzentrierte Beiträge zu Forschung und Therapie 350 11.1.3 Paarkonzept und Beziehungskonzept 351 11.1.4 Therapiepraxis 352 11.2 Familientherapie 357 11.2.1 Diagnostik und Indikation 357 11.2.2 Personzentrierte Beiträge zur Konzeptbeschreibung 358 11.2.3 Familienkonzept und Beziehungserleben 358 11.2.4 Therapiepraxis 359 12 Der Traum und das Traumverstehen 362 12.1 Der Traum in der Personzentrierten Psychotherapie 362 12.1.1 Personzentrierte Beiträge zur Arbeit mit Träumen 362 12.1.2 Die Funktionen des Träumens 364 12.1.3 Personzentrierte Verstehensmuster bei der Arbeit mit Träumen 367 12.2 Therapiepraxis 372 12.2.1 Die Imaginationsphase 373 12.2.2 Die Reflexionsphase 375 13 Personzentrierte Psychotherapie und Pharmakotherapie 379 13.1 Anwendungsbereiche und Art der Psychopharmaka 379 13.2 Kombinationstherapie: Pro und Kontra 381 13.3 Psychopharmakotherapie und die therapeutische Beziehung 383 Literatur 384 Nachwort 400 Sachregister 402 Weitere Titel aus der Reihe Personzentrierte Beratung & Therapie |
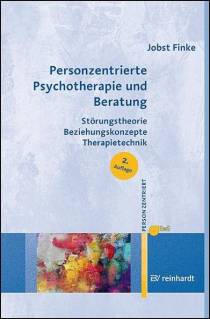
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen