|
|
|
Umschlagtext
Literarische Texte waren und sind zentraler Bestandteil religiösen Lernens. Zugleich ist der Einsatz von Literatur in religiösen Lernprozessen einem steten Wandel unterworfen. Diese Entwicklung wird in der vorliegenden Studie in den Blick genommen und analysiert. Untersuchungsbasis hierfür ist das Religionsbuch, das in den vierziger Jahren des 20. Jahrhunderts den Katechismus als Lehrbuch ablöste und wie kein anderes Medium die religionsdidaktische Entwicklung der letzten 70 Jahre widerspiegelt.
In den Schulbüchern präsente Literaten und ihre Werke, dazugehörige Wertungen und Interpretationsansätze sowie Aufgabenstellungen, die zur Erschließung der Texte auffordern, werden analysiert, um Grundtendenzen im religionsdidaktischen Umgang mit Literatur aufzuzeigen. Ausgehend hiervon werden abschließend unter Berücksichtigung gegenwärtiger soziokultureller Rahmenbedingungen und aktueller religionsdidaktischer Prinzipien Konturen eines literarisch sensiblen Religionsunterrichts entwickelt. Damit bietet die Studie Anregungen für einen hermeneutisch und didaktisch verantworteten Umgang mit Literatur. Rezension
Religion begegnet nicht nur in der Bibel ... und Religionsunterricht tut gut daran, Spuren (christlicher) Religion auch in der Literatur zu suchen. Im Kontext von Korrelationsdidaktik und Problemorientierung ist das in den vergangenen Jahrzehnten auch zunehmend geschehen. Einschlägig ausgewiesene Religionsdidaktiker wie Karl-Josef Kuschel oder Georg Langenhorst u.a. (vgl. S. 84ff) und zuvor schon Paul Tillich, Hubertus Halbfas und Dorothee Sölle (vgl. S.71ff haben erheblich zur Wahrnehmung und Verwendung von Literatur im Religionsunterricht beigetragen. Die vorliegende Arbeit, die im Wintersemester 2014/2015 von der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Augsburg als Dissertationsschrift angenommen wurde, untersucht literarische Texte in Religionsbüchern. Erst in den dreißiger und vierziger Jahren des 20. Jahrhunderts gewannen didaktisch-methodische Reflexionen darüber, wie mit literarischen Werken umzugehen ist, an Bedeutung. Hintergrund hierfür ist die Emanzipation der Literatur aus dem christlichen Binnenraum. Entsprechend setzt die Studie hier ein.
Thomas Bernhard, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Religionspädagogische Bildungsforschung, Band 3 Hrsg. Burkard Porzelt und Werner H. Ritter Inhaltsverzeichnis
Vorwort 11
Grundlegung: Fragestellung, Methode, Untersuchungszeitraum, geschichtliche Entwicklungen 1 Einleitung 15 1.1 Fragestellung und Zielperspektiven 15 1.2 Methodische Vorbemerkungen zur Religionsbuchanalyse 16 1.3 Eingrenzungen des Untersuchungsmaterials 20 a) Religionsbücher für die Schülerhand 20 b) Untersuchungszeitraum: 1945 bis 2013 20 c) Unterrichtswerke für den katholischen Religionsunterricht 20 d) Unterrichtswerke für die Jahrgangsstufen 9 bis 13 bzw. 12 21 e) Unterrichtswerke für Gymnasien 24 1.4 Analysekriterien und -verfahren 24 1.5 Struktur der Arbeit 28 2 Geschichtliche Entwicklungslinien: Religionsbücher im Wandel der Zeit – Wegmarken des Dialogs von Theologie und Literatur 31 2.1 Vom ,Führer und Wegweiser für die Erdenwanderschaft‘ zum ,Begleiter‘ durch das Schuljahr – Die Entwicklung des Religionsbuchs im Spiegel religionsdidaktischer Konzeptionen 31 a) 400 Jahre im Dienst der Weitergabe des Glaubens: der Katechismus 32 b) Im Zeichen der Verkündigung: Grüner Katechismus, Schulbibel und erste Religionsbücher 34 c) Religionsbücher im Wandel: Vom Lehr- zum Arbeitsbuch 41 d) Wachsende Öffnung zur Lebenswelt der Schüler: Textsammlungen für einen problemorientierten Unterricht 43 e) Zwischen Sach- und Schülerorientierung: Die Vielfalt der Unterrichtswerke für einen korrelativen Religionsunterricht 48 Themenorientierte Arbeitsbücher 51 Jahrgangsbezogene Arbeitsbücher 52 Einbändige Werke für die Sekundarstufe II 59 f) Die heutige Religionsbuchlandschaft – Ein abschließender Überblick 60 2.2 Theologie und Literatur – Geschichtliche Wegmarken der hermeneutischen und didaktischen Reflexion 62 a) Im Katholizismus verankerte Literaturdeutungen – Romano Guardini, Hans Urs von Balthasar und Theoderich Kampmann 63 Romano Guardini (1885–1968) 63 Hans Urs von Balthasar (1905–1988) 65 Theoderich Kampmann (1899–1983) 68 Zwischenfazit 70 b) Neue Weichenstellungen: Anerkennung der Autonomie von Literatur – Paul Tillich, Hubertus Halbfas und Dorothee Sölle 71 Paul Tillich (1886–1965) 72 Hubertus Halbfas (*1932) 73 Exkurs I: Werke für die religionspädagogische Praxis 75 Dorothee Sölle (1929–2003) 77 Zwischenfazit 79 c) Dem Korrelationsprinzip verpflichtet: Dietmar Mieth, Karl-Josef Kuschel und Georg Langenhorst 80 Dietmar Mieth (*1940) 82 Karl-Josef Kuschel (*1948) 84 Georg Langenhorst (*1962) 86 Exkurs II: Neue Werke für die religionspädagogische Praxis 89 Zwischenfazit 90 2.3 Zusammenschau und Begründung des weiteren Vorgehens: drei Phasen des Umgangs mit literarischen Werken im Religionsbuch 92 Hauptteil: Materiale Analysen 3 „Beim Pflücken der Rosen die Dornen vermeiden“ – Literarische Texte als Zeugnisse von Glauben und Unglauben 97 3.1 Über den Umgang mit Literatur: Von Rosen und Dornen 99 a) Von Rosen … 100 b) … und Dornen 102 c) Die wichtigsten Literaten im Überblick 103 Exkurs III: Vom Umgang mit Literatur im Deutschunterricht der Nachkriegszeit 104 d) Literatur als ,Glaubenshilfe‘ und ,Glaubensgefahr‘ 106 3.2 Lernfeld ,Gottesglaube und Gebet‘ 106 a) Literatur aus dem christlichen Kosmos 108 b) Ein Lobpreis auf den Schöpfergott aus der christlichen Tradition: der „Sonnengesang“ des Franziskus 109 c) Rezeption der ,katholischen‘ Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts 115 d) Ein zeitgenössischer Lobpreis auf den dreifaltigen Gott: Gertrud von le Forts „Te Deum“ 116 3.3 Lernfeld ,Leben mit der Kirche‘ 121 a) Literarische Texte zur ,Weckung und Vertiefung des Kirchenbewusstseins‘ 122 b) Gertrud von le Forts „Hymnen an die Kirche“ als Zeugnisse für eine recht verstandene Katholizität 124 c) Aufbrüche innerhalb des Lernfeldes ,Leben mit der Kirche‘ 129 3.4 Lernfeld ,Der Unglaube der Umwelt‘ 130 a) Nicht-christliche Weltanschauungen aus der Literaturgeschichte – Ein kurzer Abriss 131 b) Die Warnung vor Johann Wolfgang Goethes Vorstellung einer Gott-Natur 133 c) Die Kritik an Rainer Maria Rilkes ,pantheistischer Vergöttlichung der Welt‘ 139 3.5 Zwischenbilanz und Perspektiven 146 4 „Nicht unbedingt im Schatten der Kirchtürme zu Hause“ – Literarische Texte als Spiegel menschlicher Erfahrung und christlicher Glaubenshoffnung 149 4.1 Von der Vielfalt literarischer Texte 154 a) Die Tradition der christlichen Gebetslyrik 154 b) Autoren und Werke von weltliterarischem Rang bis 1900 155 c) Die Autorengeneration der literarischen Moderne 156 d) Die christliche Literatur der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 158 e) Die Autorengeneration der Gegenwartskultur der fünfziger, sechziger und siebziger Jahre 159 f ) Die Fortschreibung christlicher Literatur 162 g) Zwischenfazit: Literarische Texte als Ausdruck menschlicher Lebens- und Glaubenserfahrung 164 Exkurs IV: Die literaturdidaktischen Diskussionen der sechziger und frühen siebziger Jahre 165 4.2 Kulturgeschichtliches Lernfeld I: ,Gottesfrage und christlicher Glaube‘ 167 a) Umdenken und Neubesinnung – Einige Streifzüge 168 b) Warten auf eine Botschaft – Literatur als Ausdruck der Gottessehnsucht und -suche 169 c) Mit Gott ,tabula rasa‘ gemacht 173 d) Gott im Leid – schweigend, ohnmächtig, mitleidend? 174 e) Absagen an einen ,Lückenbüßergott‘ und falsche Götter 179 f ) Gottesglaube – Antrieb oder Bremse für menschliches Handeln? 181 g) Alte und neue Bekenntnisse 184 h) Literarisches Lernen zur Gottesfrage als Begegnung mit Gottessuchern, Zweiflern, Religionskritikern und Bekennern 186 4.3 Kulturgeschichtliches Lernfeld II: ,Kirchliches Leben‘ 187 a) Kontinuitäten: wenige Beispiele christlicher Literatur der ersten Jahrhunderthälfte 188 b) Wahrnehmung von Kritik aus den eigenen Reihen: Huub Oosterhuis, Wilhelm Willms und Christa Peikert-Flaspöhler 189 c) Weitere ,Stimmen der Kirche‘ 194 4.4 Anthropologisches Lernfeld I: ,Liebe, Partnerschaft und Sexualität‘ 194 a) Der Anspruch: Dichtung und Theologie im Gespräch 196 b) Literarische Texte als Illustrationen menschlicher Beziehungen 197 c) Was bedeutet ,Liebe‘? – Literarische Erklärungsversuche 198 d) Abgründe der Liebe 201 e) Sexualethische Fragen literarisch beleuchtet 203 f) Literarische Texte gegen einen einseitig apologetischen Unterricht 204 4.5 Anthropologisches Lernfeld II: ,Tod und Auferstehung‘ 206 a) Die zögerliche Öffnung zur Literatur 208 b) Literarische Reflexionen über Endlichkeit, Sterben und Tod 208 c) Hoffnung über den Tod hinaus? – Literarische Annäherungen 212 d) Literarische Texte als Impulse zur Auseinandersetzung mit Tod und christlicher Auferstehenshoffnung 217 4.6 Gesellschaftliches Lernfeld: ,Krieg und Frieden‘ 218 a) Im hermeneutischen Religionsunterricht: Meditationen und Gebete für den Frieden 219 b) Religionsunterricht und politisch-gesellschaftliches Bewusstsein 221 c) Von gefallenen Vätern, Heldentum und Disziplin – Lernen aus der Geschichte 222 d) Von Anfeindungen und Gewalt – Literarisches Lernen und Gesellschaftskritik 225 e) Literarische Appelle zur Wachsamkeit und zum politischen Engagement 228 f) Literarische Texte als Ermutigungen zu kritisch-engagiertem Handeln 232 4.7 Zwischenbilanz und Perspektiven 233 5 „Weiter sehen als der Blick von gestern und vorgestern“ – Literarische Texte als neue Sichtweisen auf die Tiefendimensionen von Wirklichkeit 237 5.1 Altbewährtes und neue religiöse Klänge 240 a) Autorinnen und Autoren der literarischen Vormoderne 240 b) Autorinnen und Autoren des frühen 20. Jahrhunderts 242 c) Die erste Generation nach der Shoah 242 d) Autorinnen und Autoren der achtziger und neunziger Jahre und des beginnenden 21. Jahrhunderts 244 e) Christliche Schriftstellerinnen und Schriftsteller 245 f ) Zwischenfazit: Einblicke in die Tiefendimension von Wirklichkeit 246 Exkurs V: Die literaturdidaktische Aufbruchzeit der siebziger Jahre unter dem Einfluss der Rezeptionsästhetik 248 5.2 Lernfeld ,Mensch und Welt‘ 250 a) Mensch-Sein und Ich-Werden – Anstöße aus Lyrik und Prosa 250 b) ,Tod und Auferstehung‘ – Literatur gegen eine Tabuisierung des Todes 258 c) Fragen verantwortlicher Lebensgestaltung – Wahrnehmungs- und Urteilsschulung durch ethisch-literarisches Lernen 264 5.3 Lernfeld ,Die Frage nach Gott‘ 275 a) Kontinuitäten: Literaten als Religionskritiker und Gottsucher – Eine kurze Skizze 276 b) Didaktisch-methodische Weiterentwicklungen: Dialog statt Konfrontation und Provokation 277 c) Kreative Erschließungsimpulse 279 d) Ein Einzelfall: Schriftsteller in einem fingierten Dialog 281 e) Neue Perspektiven: Mit Schriftstellern auf der Suche nach einer tragfähigen Sprache für die Rede von Gott 283 f) Erste Öffnungen zur Gegenwartsliteratur 289 5.4 Lernfeld ,Bibel und Tradition‘ 290 a) Aufbrechen, heimkehren, hoffen auf Zukunft – Biblische Stoffe aktualisiert 291 b) Prophetie damals und heute – Analoge Textmuster 294 c) Stammler und Narren – Biblische Figuren neu vorgestellt 297 d) Problematische Tendenzen im Umgang mit Texten zur Bibel 301 5.5 Lernfeld ,Jesus Christus‘ 303 a) Literarische Annäherungen an das Leben und Wirken Jesu 305 b) Literarische Aktualisierungen von Passion und Auferstehung 310 c) ,Jesus in der Literatur‘ als Unterrichtseinheit 315 5.6 Lernfeld ,Kirche‘ 321 a) Was ist Kirche? – Kirchenlieder als kulturgeschichtliche Zeugnisse 322 b) Wer ist Kirche? – Zeugnisse von exemplarischen Menschen der Kirche 325 c) Von Anspruch und Wirklichkeit der Kirche 327 d) Über Kirche(ngeschichte) aus Geschichten lernen 329 5.7 Lernfeld ,Religionen und Weltanschauungen‘ 335 a) Literarische Annäherungen an Religion von Wolfram von Eschenbach bis Bernhard Schlink 337 b) Judentum – Spiegelungen religiösen Brauchtums und der Geschichte des jüdischen Volkes 342 c) Buddhismus – Annäherungen von außen 347 5.8 Zwischenbilanz und Perspektiven 350 Perspektiven: Zum Umgang mit Literatur in höheren Gymnasialklassen 6 Literarische Texte als ,Denk-Male‘ – Konturen eines literarisch sensiblen Religionsunterrichts 357 6.1 Die sozioreligiöse Situation der Gegenwart und die Religiosität Jugendlicher heute 358 a) Die gewandelte Religiosität der Lernenden 360 b) Jugend und Kirche 361 c) Die Kommunikabilität von Religion und Religiosität 363 6.2 Wegweisendes im Umgang mit Literatur der letzten siebzig Jahre 364 a) Errungenschaften der ersten Phase 364 b) Errungenschaften der zweiten Phase 365 c) Errungenschaften der dritten Phase 366 d) Zwischenreflexion: Literarische Texte als ,Denk-Male‘ 366 6.3 Literarisch-religiöses Lernen im Horizont aktueller religionsdidaktischer Leitlinien und Prinzipien 367 a) Kompetenzorientierung als neue Sicht auf den Lehr-Lern-Prozess 368 b) Religionsunterricht in konstruktivistischer Perspektive 372 c) Ästhetisches Lernen 377 d) Performatives Lernen 380 6.4 Konturen eines literarisch sensiblen Religionsunterrichts 385 a) Erste Kontur: Beachtung der Autonomie literarischer Texte 386 b) Zweite Kontur: Verortung im (intertextuellen) religiösen Bezugsnetz 387 c) Dritte Kontur: Ermöglichung von Entdeckungen und Erfahrungen 388 d) Vierte Kontur: Einbringen theologisch-literarischen Expertenwissens 389 e) Fünfte Kontur: Ermöglichung individueller Sinnkonstruktionen 390 f) Sechste Kontur: Ermunterung zu eigenen Entdeckungen und Befähigung zum kritischen Urteil 392 g) Siebte Kontur: Bedenken der Unbegreiflichkeit Gottes 393 h) Ausblick 394 Literaturverzeichnis 399 1 Unterrichtswerke 399 a) Unterrichtswerke nach Erscheinungsjahr geordnet 399 b) Unterrichtswerke in alphabetischer Folge der Reihentitel 408 2 Lehrpläne, Richtlinien und kirchliche Verlautbarungen (nach Erscheinungsjahr geordnet) 416 3 Textnachweise 418 4 Forschungsliteratur 420 Weitere Titel aus der Reihe Religionspädagogische Bildungsforschung |
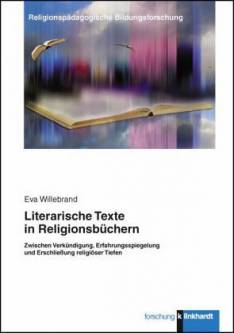
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen