|
|
|
Umschlagtext
Führt die Frage nach Gott und dem Leid zu einem Einbruch im jugendlichen Gottesglauben, oder ist sie im ohnehin säkularen Kontext nur noch eine religiöse Randerscheinung? Um dieser Frage nachzugehen, ließ die Autorin in einer qualitativ-empirischen Studie 265 Jugendliche zu Wort kommen. Sie entdeckte bei ihrem Erkundungsweg eine beeindruckende Vielfalt in der Deutung sowie im Umgang mit der Theodizeefrage: Unter den Jugendlichen tummeln sich Visionäre und Tabubrecher, Gottessympathisanten und -relativierer, Bekenner und Unparteiische, enttäuschte Deisten und sachliche Atheisten. Sie alle kommen von einer bestimmten religiösen Positionierung her und gehen mit einer spezifisch akzentuierten Gottesvorstellung auf das Theodizeeproblem zu: Der Umgang mit der Frage nach Gott und dem Leid ist also eine Sache des Typs!
Entlang einer sorgfältig aufbereiteten Analyse der Äußerungen Jugendlicher erfährt der Leser, wie mittels der Grounded Theory sieben Typen aus dem Datenmaterial gehoben werden, und erhält dabei immer wieder Einblicke in die Forschungswerkstatt und den Denkprozess der Autorin. Die Autorin Dr. theol. Eva Maria Stögbauer, geb. 1977, nach Lehramtsstudium der Germanistik und Katholischen Theologie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Religionspädagogik und Didaktik des Religionsunterrichts an der Universität Regensburg, derzeit Studienreferendarin für Gymnasien in Bayern. Rezension
Die Feststellung, dass Gott das Leid unschuldiger Menschen bestehen läßt und nichts dagegen unternimmt, gilt als eine der Hauptursachen für den Verlust des Gottesglaubens im Jugendalter. Aber trifft diese Annahme auch noch auf heutige Jugendliche zu? Und hat die Theodizeefrage als Kernfrage der jüdisch-christlichen Tradition damit noch Relevanz in der heutigen Religionspädagogik? Die Erkenntnisinteressen dieser empirischen Untersuchung sind deutlich: 1) Wie denken Jugendliche Gott - angesichts des Leids? 2) Welche Fragen und Herausforderungen ergeben sich daraus für Theologie und Religionspädagogik? 3) Welche Herausforderungen und Orientierungen lassen sich aus den empirischen Ergebnissen für schulische Lehr-Lern-Prozesse ziehen?
Oliver Neumann, lehrerbibliothek.de Inhaltsverzeichnis
Vorwort 11
Einführung 13 Teil I: Ausgangspunkt Die Gottesfrage bei Jugendlichen und ihre Zuspitzung angesichts des Leidens in der Welt 1 Gottesglaube, Gottesvorstellung und Gottesbedeutung Jugendlicher im Spiegel empirischer Studien: Eine kritische Bestandsaufnahme 20 1.1 ,Glaubst Du eigentlich noch an Gott?' - Zur Plausibilität der Existenz Gottes bei Jugendlichen 22 1.1.1 Gottesglaube im Jugendalter: Ein nummerisches Stimmungsbarometer 22 1.1.2 Kommentierung der Stimmungslage: Rückgang, Revival oder Remis? 28 1.2 ,Wie stellst Du Dir Gott überhaupt vor?' - Zur substanziellen Füllung des Gotteskonzepts bei Jugendlichen 30 1.2.1 Gott anthropomorph und symbolisch repräsentieren 31 1.2.2 Von einer christlich-traditionellen Signatur der Gottesvorstellung Abstand halten 34 1.2.3 Das Göttliche abstrakt, unfassbar und anonym denken 37 1.2.4 Das Göttliche in Mensch und Natur immanent erfahren 42 1.2.5 Von Gott in positiven Eigenschaften und Bildern sprechen 43 1.3 ,Nun sag, wie hältst Du es denn ansonsten mit Gott?' - Zum emotionalen und intentionalen Stellenwert Gottes 46 1.3.1 Bei der Bedeutsamkeit des Gottesglaubens ,den Ball flach halten' 46 1.3.2 Gott eher am Rand der eigenen Welt- und Sinndeutung verorten 49 1.3.3 Ab und an Erfahrungen mit Gott machen 52 1.3.4 Mitunter auch mit und über Gott in Kontakt treten 53 2 Die Frage nach Gott und dem Leid aus der Sicht Jugendlicher: Religionspädagogisch-empirische Einblicke 56 2.l Aufmerksamkeit für die Theodizeefrage: Gott und das Leid - eine Frage, die Jugendliche bewegt 56 2.2 Fokussierung der Theodizeefrage: Gott und das Leid in der Gedankenwelt Jugendlicher 59 2.2.1 Theodizee als Katalysator der Positionierung zum Gottesglauben 59 2.2.2 Theodizee als Barometer religiöser Entwicklung 61 2.2.3 Theodizee als Akt religiöser Sinngebung 64 2.3 Irritation bei der Theodizeefrage: Gott und das Leid - keine Frage mehr, die Jugendliche besonders bewegt 69 3 Die Frage nach Gott angesichts des Leidens in der Welt: Systematisch-theologische Vergewisserung 72 3.1 Theodizee - die Sache Gottes verfechten! Ein relativ moderner Blick auf ein altes Sachproblem 73 3.1.1 Erfahrungen von Übel und Leid als anthropologisches Grunddatum 74 3.1.2 Übel und Leid als Herausforderung einer Rechtfertigung Gottes 77 3.2 Theodizee - die Sache des Menschen verfechten! Biblische Sinnfiguren des Leidens 80 3.2.1 „Kannst du das Krokodil am Angelhaken ziehen?" (Ijob 40,25): Alttestamentliche Sinnfiguren der Leiddeutung 81 3.2.2 „Mein Gott, mein Gott, wozu hast du mich verlassen?" (Mk 15,34): Christozentrische Weiterführung der Leidensdeutungen im Neuen Testament 89 3.3 Stichhaltige Theodizeestrategien - die Plädoyers vor dem Gerichtshof der menschlichen Vernunft 91 3.3.1 Strategie der Depotenzierung von Übel und Leid 92 3.3.2 Strategie der begründeten Zulassung von Übel und Leid durch Gott 94 3.3.3 Strategie der Arbeit am Gottesverständnis zur Deutung von Übel und Leid 97 3.4 Theodizee vor Gericht - Einspruch gegen die Instrumentalisierung der Opfer 100 3.4.1 Bewertungsperspektiven 101 3.4.2 Kritische Begutachtung der Plädoyers vor dem Gerichtshof der menschlichen Vernunft 103 3.4.3 Scheitern aller Versuche in der Theodizee!? 106 4 Theoretische Sensibilisierung 108 4.1 Begründung und Transparenz von Interpretationen 108 4.2 Akzentuierung und Begrenzung der eigenen Studie 109 4.3 Zurückhaltung gegenüber theologischen Interpretationen 110 Teil II: Erkundungsweg Methodologische Annäherungen an den Untersuchungsgegenstand in religionspädagogisch-empirischem Interesse l Grundlegung: Leitlinien qualitativ-empirischer Forschung 113 1.1 Prinzipien qualitativer Forschung 113 1.1.1 Sichtweisen auf die Wirklichkeit: Im Mittelpunkt das Subjekt 114 1.1.2 Qualitative Forschungslogik: Vom empirischen Material über interpretative Verfahren zu Hypothesen und Theorien 115 1.1.3 Offenheit auf den Untersuchungsgegenstand hin 116 l .2 Gütekriterien qualitativer Forschung und ihre Bedeutung für den eigenen Forschungsprozess 117 1.2.1 Größtmögliche Transparenz des Forschungsprozesses: Intersubjektive Nachvollziehbarkeit als Kernkriterium 119 1.2.2 Verlässlichkeit des Forschungsweges und seiner Ergebnisse: Gültigkeit als zweites Kernkriterium 120 1.3 Konsequenzen für das vorliegende Untersuchungsdesign 121 2 Fragestellung: Wegweiser durch das Datenmaterial 124 3 Samplingstrategie: Schulklassen als religionspädagogische Zielgruppe 126 3.1 Theoretische Vorentscheidungen hinsichtlich des Samples 126 3.1.1 Bewusste und kriteriengeleitete Auswahlverfahren als Maßstab qualitativer Studien 127 3.1.2 Breite und Vielfalt als Ziel der Fallauswahl 128 3.1.3 Eingrenzung des Samples anhand soziodemographischer Merkmale 128 3.2 Das konkrete Sample der vorliegenden Untersuchung 130 3.3 Die Frage nach der Generalisierbarkeit qualitativ gewonnener Ergebnisse 131 4 Erhebungsdesign: Konstruktion von Daten in der offenen Form einer schriftlichen Befragung 134 4. l Die offene Form der schriftlichen Befragung als Erhebungsinstrument der vorliegenden Untersuchung 134 4.2 Zum Impuls der schriftlichen Befragung: „Ich stelle mir Gott vor" 137 4.3 Verfeinerung der Erhebungsmethode: Clustern als produktive Unterbrechung 138 4.4 Der geplante Erhebungsablauf in den einzelnen Schulklassen 140 4.5 Reflexive Anmerkungen zum Verlauf der Erhebung 143 5 Auswertungsdesign I: Grounded Theory als methodologisches Rahmenkonzept 146 5.1 Grounded Theory als Forschungsstil 146 5.1.1 Entstehung und forschungspolitischer Anspruch der Grounded Theory 147 5.1.2 Selbstverständnis des Ansatzes 148 5.2 Grounded Theory als Auswertungsmethode qualitativer Daten 150 5.2.1 Kategorien erarbeiten - Daten deuten, strukturieren und etikettieren (Offenes Kodieren) 152 5.2.2 Mit Kategorien arbeiten - Daten systematisch weiterentwickeln und zueinander in Beziehung setzen (Axiales Kodieren) 154 5.2.3 Kategorien integrieren - Daten in einer ,Grounded Theory' zusammenführen (Selektives Kodieren) 157 5.2.4 Kodierprozesse permanent begleitende und kontrollierende Verfahren 158 6 Auswertungsdesign II: Modifizierung der Grounded Theory im Kontext der eigenen Untersuchung 161 6.l Einpassung in die eigene Untersuchung: Chancen und Grenzen einer Arbeit mit der Grounded Theory 161 6.2 Kategorien erarbeiten - Daten deuten, strukturieren und etikettieren (Offenes Kodieren) 163 6.2.1 Zielperspektive des offenen Kodierens: Deutungen des Negativen im Kontext der Gottesvorstellung konzeptualisieren 164 6.2.2 Heuristiken zum kreativen Konzeptualisieren der Daten 164 6.2.3 Beispielanalyse aus der Phase des offenen Kodierens 167 6.2.4 Die ,Büchse der Pandora': Entwicklung von Konzepten und Kategorien 173 6.3 Mit Kategorien arbeiten - Daten systematisch weiterentwickeln und zueinander in Beziehung setzen (Axiales Kodieren) 175 6.3.1 Zielperspektive des axialen Kodierens: Strukturen und Konfigurationen der Frage nach Gott und dem Leid entdecken 175 6.3.2 In-Beziehung-Setzen von Konzepten und Kategorien mittels einer spezifizierten Kodierheuristik 176 6.3.3 Formale Ordnungskategorien als grundlegende Vergleichsmatrix 178 6.3.4 Konstruktion empirisch begründeter Typen als eine produktive Strategie des axialen Kodierens 180 6.3.5 Beispielanalyse aus der Phase des axialen Kodierens: Fallvergleich und Fallkontrastienmg 182 6.4 Kategorien integrieren - Daten in einer ,Grounded Theory' zusammenfuhren (Selektives Kodieren) 186 Teil III: Ergebnisse Wie aus der Datenfülle Bilder entstehen 1 Ergebnisse des Offenen Kodierens: Forschen ist schön, macht aber viel Arbeit 193 1.1 Einbruch ins Datenmaterial: Ein Werkstattbericht 193 1.2 Aufbruch im Datenmaterial: Vorläufige Kategorien 200 l.2.l Wissenschaftstheoretische Unsicherheit: Was ist überhaupt eine Kategorie? 200 1.2.2 Forschungspragmatische Konsequenz: Das kann eine Kategorie sein! 202 1.3 Durchbruch im Datenmaterial: Vorkommen und Relevanz der Frage nach Gott und der Faktizität des Negativen 209 2 Ergebnisse des Axialen Kodierens: Verschiedene Typen im Umgang mit der Frage nach Gott und dem Leid 222 2.1 Gottesbekenner: Theo-zentrische Unterstützung in schwierigen Situationen 223 2.1.1 Persönlich-erlebnisgeprägte Positionierung: Gott ist für mich 223 2.l.2 Personal-kommunikative Gotteskonzeption: Gott ist für mich ein universal präsenter, immer aufmerksamer und hilfsbereiter Gesprächspartner 227 2.1.3 Theodizee-Momente: Gefühlte Sicherheit - Gott ist für mich gerade in Problemsituationen da! 232 2.l.4 Zusammenführung: Der rote Faden in den Texten von Gottesbekennern 234 2.2 Gottessympathisanten: Das Negative und der sympathische Gott 235 2.2.1 Kollektiv-menschliche Positionierung: Gott ist für uns 235 2.2.2 Relational-protektive Gotteskonzeption: Gott ist für uns Menschen ein fürsorglicher Wächter, der immer da ist und sich für das Gute engagiert 238 2.2.3 Theodizee-Momente: Verblüffende Inkongruenz - Was macht ein sympathischer Gott bei menschlichen Leiderfahrungen? 242 2.2.4 Zusammenführung: Der rote Faden in den Texten von Gottessympathisanten 245 2.3 Gottesneutrale: Theodizee-Resistenz einer absoluten Macht 246 2.3.1 Distanziert-definitorische Positionierung: Gott ist 246 2.3.2 Autonom-transzendente Gotteskonzeption: Gott ist allmächtig, unfassbar, undefinierbar 249 2.3.3 Theodizee-Momente: Unspektakuläres Zusammentreffen - Was eine absolute Macht mit dem Negativen zu tun hat?! 252 2.3.4 Zusammenfuhrung: Der rote Faden in den Texten von Gottesneutralen 254 2.4 Gotteszweifler: Konfrontationen mit einem vermeintlich sympathischen Gott 255 2.4.1 Indigniert-anzweifelnde Positionierung: Bei Gott fragt man sich aber schon 256 2.4.2 Realistisch-korrigierte Gotteskonzeption: Wie eine eigentlich sympathische Vorstellung von Gott im Angesicht des Weltgeschehens zu berichtigen ist 259 2.4.3 Theodizee-Momente: Unglaubliches Ärgernis - Warum bleibt ein vermeintlich guter Gott im Angesicht des Leidens inaktiv? 261 2.4.4 Zusammenführung: Der rote Faden in den Texten von Gotteszweiflern 265 2.5 Gottesrelativerer: Trost einer metaphysischen Fiktion 266 2.5.1 Agnostisch-skeptische Positionierung: Gott könnte (nicht) sein 266 2.5.2 Entmaterialisiert-funktionale Gotteskonzeption: Gott ist etwas Übernatürliches, an das sich die Menschen in Krisen wenden 269 2.5.3 Theodizee-Momente: Pragmatische Handhabung - Wie der Glaube an Gott trotzdem trösten kann oder vielleicht auch nicht!? 271 2.5.4 Zusammenführung: Der rote Faden in den Texten von Gottesrelativierern 273 2.6 Gottesverneiner: Das rationale und sich emanzipierende Subjekt als ,Fels des Atheismus' 274 2.6.1 Persönlich-ablehnende Positionierung: Für mich ist Gott nicht 274 2.6.2 Rational-analysierte Gotteskonzeption: Gott ist eine Fiktion des Menschen zum Zwecke der Sinngebung, Welterklärung oder Kontrollausübung 277 2.6.3 Theodizee-Momente: Gemäßigte Aufregung - Unter anderem votiert auch die Faktizität des Leids gegen die Existenz Gottes 279 2.6.4 Zusammenführung: Der rote Faden in den Texten von Gottes verneinern 281 2.7 Gottespolemiker und Tabubrecher: Abrechnung mit Gott 282 2.7. l Herausfordernd-provokative Positionierung: Wie Gott eigentlich ist 282 2.7.2 Martialisch-demaskierende Gotteskonzeption: Gott ist eigentlich ein reaktionärer Zeitgenosse oder auch ein sadistischer Hedonist 284 2.7.3 Theodizee-Momente: Bitterböser Präzedenzfall - Wie das Leiden der Welt das eigentliche Wesen Gottes veranschaulicht!! 285 2.7.4 Zusammenfuhrung: Der rote Faden in den Texten von Gottespolemikern 286 3 Ergebnisse des Selektiven Kodierens: Gott zwischen Ideal und Wirklichkeit 287 3.1 Die Frage nach Gott und der Faktizität des Negativen — Eine Erzählung über das Datenmaterial aus Sicht der Forschenden 287 3.2 Eine Frage des Gefühls, des Idealen und Konkreten - Schlüsselkategorien einer Grounded Theory über die Theodizeefrage bei Jugendlichen 290 Teil IV: „Memos" Was es nun zu bedenken und zu besprechen gilt 1 Im Gespräch mit der (Systematischen) Theologie: Fragen 296 1.1 Wie soll man heute von Gott reden? 296 1.2 Wie von einer in Gott verbürgten Weltordnung sprechen? 299 1.3 Wie subjektbezogen darf Theologie sein? 300 2 Im Gespräch mit der religionspädagogisch-empirischen Forschung: Erträge 301 2.1 Gott als eine mögliche Vokabel der Diskursivierung des Leids 301 2.2 Diskussion des Geltungsbereichs vorgeprägter Kategorien 303 2.3 Transparenz und Reflexion religionspädagogischer Empirie 304 3 Und die abschließende Gretchenfrage: Was machst Du eigentlich mit Deinen Ergebnissen in der Praxis? 307 3.1 Empirische Ausbildung von Religionslehrer/innen forcieren 307 3.2 Lernen als Explorieren begreifen 309 3.3 Schlüsselkategorien fruchtbar machen 311 3.3.1 Zur Produktivität von Schlüsselkategorien 311 3.3.2 Mit Jugendlichen konkret Theologie betreiben 313 Für diejenigen, die den Weg einer Grounded Theory einschlagen möchten 317 Literaturverzeichnis 320 Abkürzungsverzeichnis 332 Weitere Titel aus der Reihe Religionspädagogische Bildungsforschung |
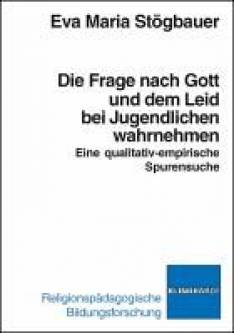
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen