|
|
|
Umschlagtext
Schulischer Alltag ist geprägt durch strukturierte Lehr- und Lernsituationen und den Umgang der Interaktionspartner untereinander. Dabei haben alle innerhalb eines komplizierten Leistungssystems unterschiedliche Erwartungen, Pflichten und Verantwortungen. Diese Unterschiede führen zu einer prinzipiellen Konfliktanfälligkeit des Lebens in Schule und Unterricht. Zusätzlich haben Schüler Defizite bei der Wahrung von Disziplin, bzw. müssen häufig erst lernen, sich adäquat zu verhalten. In einem ersten stärker theoretischen Teil wird darauf eingegangen, Begrifflichkeiten werden abgegrenzt und aktuelle Theorien zu Unterrichtsstörungen dargestellt.
Störsituationen des Unterrichts sind situationsabhängig und werden von Lehrern und Schüler subjektiv bewertet. Dabei ist davon auszugehen, dass aus oftmals kleineren Problemen durch eine falsche individuelle Interpretation größere Differenzen entstehen, die die Beziehung von Lehrern und Schülern dauerhaft belasten. Aus sogenannten primären Unterrichtsstörungen entstehen sekundäre. Diese Annahme wird in einem 2. Teil anhand zahlreicher Einzelsituationen untersucht. Im dritten Teil werden Anregungen zur präventiven Begegnung mit Unterrichtsstörungen in der Praxis gegeben. Hinweise sind keine Rezepte, sie bieten aber Handlungshilfen für und im Unterricht und fordern zur kritischen Auseinandersetzung heraus. Dem Praktiker bleibt die Erprobung im schulischen Alltag. Dazu dienen die Fallbeispiele und Arbeitsblätter. Der Fragebogen am Ende bezieht sich auf methodisch didaktische Gesichtspunkte, auf den Unterrichtsstil, auf Probleme im kommunikativen wie auch interaktiven Bereich, aber auch auf ganz individuelle Einstellungen. Er bietet auch besonders kritischen Unterrichtssituationen eine Reflexionshilfe, kann aber auch dazu verwendet werden, ganz allgemein das persönliche Lehrerverhalten zu analysieren. Zum Autor: Michael Pfitzner, geboren 1954, hat nach einem Studium in Bamberg und einem nachträglichen Zusatzstudium zum Qualifizierten Beratungslehrer viele Jahre lang als Lehrer, Be-treuungs- und Praktikumslehrer an Grund- und Hauptschulen sowie an einer Schule zur Erziehungshilfe gearbeitet. Nebenbei nahm er ein Promotionsstudium in Bayreuth in den Fächern Schulpädagogik, Psychologie und Didaktik der Biologie auf, das er 1998 erfolgreich abschloss und arbeitete 6 Jahre lang als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Schulpädagogik der Universität Bayreuth. Seit 2004 arbeitet er wieder an einer Haupt- und Ganztagsschule in Kulmbach. Rezension
Schulen sind keine Kuschelanstalten. Im Gegenteil! Konflikte und Unterrichtsstörungen gehören zum Schulalltag. Das bedeutet vor allem für Lehrerinnen und Lehrer nicht nur fehlende Lernzeit, sondern vor allem eine pädagogische Herausforderung. Sie müssen sich zunehmend Konfliktlösungskompetenzen aneignen, um mit Unterrichtsstörungen zufrieden stellend umgehen zu können. Im vorliegenden Band versucht Michael Pfitzner dem Thema der unterrichtlichen Störungen in dreifacher Weise auf den Grund zu gehen. Im ersten theoretischen Teil werden zunächst Begrifflichkeiten geklärt und neuere Theorien vorgestellt. Um Mittepunkt des zweiten Kapitels steht die Untersuchungsforschung, indem ein Untersuchungskonzept, die Entstehung von Fragebögen und die Auswertung anhand konkreter Beispiele beschrieben werden. Der letzte Teil des Buches bietet konkrete Hinweise und Tipps für die Praxis, wobei der Schwerpunkt auf der Prävention liegt. Noch ein letzter Hinweis zum Titel des Buches, den ich für unpassend halte: „Kevin tötet mir den letzten Nerv“. „Kevin ist kein Name, sondern eine Diagnose“ konnte man in letzter Zeit des öfteren über das Ergebnis einer Studie über Vornamen in Presseveröffentlichungen lesen. Leider trägt auch der Buchtitel eher zur Stigmatisierung von Personen mit einem bestimmten Namen bei. Leider war bei der Erstauflage (2000) diese Entwicklung noch nicht abzusehen.
Arthur Thömmes, lehrerbibliothek.de Inhaltsverzeichnis
Vorwort des Herausgeberteams der Reihe VII
Teill 1 Das Problem - Einführung 2 2 Klagen über den Unterricht - ein immer aktuelles Thema 8 Szene eines Schulalltags 14 3 Unterrichtsstörungen und Gewalt - Bestandsaufnahme und Abgrenzung 15 4 „Disziplin", „Disziplinierung" und „Freiheit" als pädagogisches Grundproblem 21 41 Die „Moralisierung" des jungen Menschen und die „Bildung der sittlichen Persönlichkeit" durch Schule und Unterricht 23 42 „Äußere" und „innere Disziplin" als Notwendigkeit und Ziel schulischen Arbeitens 27 Szene eines Schulalltags 37 5 Begriffliche Aspekte zum Phänomen „Störungen des Unterrichts" 39 51 Disziplinproblem und Disziplinschwierigkeit 41 52 Abweichendes Verhalten 46 Szene eines Schulalltags 61 6 Unterrichtsstörung 64 61 „Neue Theorie der Unterrichtsstörungen" (Rainer Winkel) 67 62 „Unterrichtssituation und Störungen" (Karlheinz Billcr) 73 63 „Unterrichtsbrüche" (Bernd Benikowski) 79 64 Zusammenfassung und Fragen 82 65 Ansätze einer Systematisierung von Unterrichtsstörungen 85 Szene eines Schulalltags 93 7 Unterrichtsstörung als situationsabhängige und subjektiv bewertete Interaktion 96 Szene eines Schulalltags 105 Teil II 8 Anlage der Untersuchung zur unterschiedlichen Sichtweise von Lehrern und Schülern 108 81 Notwendigkeit einer Sichtweise von Lehrern und Schülern 108 82 Die Hypothesen 115 83 Methodisches Vorgehen und Schwierigkeiten bei der Datenerhebung an Schulen 117 84 Untersuchungskonzept 121 Szene eines Schulalltags 124 9 Entstehung der Fragebögen 126 91 Vorüberlegungen 126 92 Problematik der Situationsbeschreibung durch Lehrer und Schüler 128 93 Festlegung der Reihenfolge der Störsituationen im Fragebogen und Skalierung 131 94 Erprobung und Revision der Fragebögen 133 95 Sozialstatistische Variablen im Fragebogen 137 Szene eines Schulalltags 139 10 Befragung 141 101 Stichprobendesign und Durchführung der Befragung 141 102 Fragebogenrücklauf 144 103 Aufbereitung der Daten 152 Szene eines Schulalltags 157 11 Auswertung 160 111 Hypothese 1: Lehrer und Schüler empfinden unterrichtliche Störsituationen verschieden 161 112 Hypothese 2: Lehrer wissen, dass sie Störsituationen des Unterrichts anders empfinden als Schüler 163 113 Hypothese 3: Schüler wissen, dass sie Störsituationen des Unter¬richts anders empfinden als Lehrer 166 114 Hypothese 4: Auch wenn sich Lehrer in die Lage der Schüler versetzen, gibt es Differenzen zu deren tatsächlichen Empfindungen 169 115 Hypothese 5: Auch wenn sich Schüler in die Lage der Lehrer versetzen, gibt es Differenzen zu deren tatsächlichen Empfindungen 171 Teil III 12 Unterrichtsstörungen - Missverständnisse und Teufelskreise 176 13 Unterrichtsstörungen - Präventionen 190 131 Der Unterricht 192 132 Die Differenzierung 193 133 Gruppenarbeit 195 134 Lehrer-Schüler-Verhältnis 200 135 Lehrerpersönlichkeit 204 14 Typische Unterrichtsstörungen - Anregungen und Fragen 208 15 Literatur 239 Weitere Titel aus der Reihe Grundlagen der Schulpädagogik |
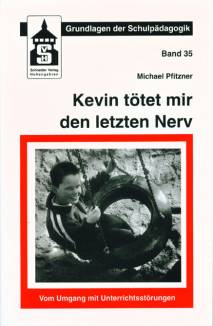
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen