|
|
|
Umschlagtext
„Die moderne Welt hat Gott verloren und sucht ihn“ (Alfred N. Whitehead). Doch auf diese grundlegende Erfahrung angemessen zu reagieren fällt der Theologie auch zu Beginn des 21. Jahrhunderts schwer. Mit der Reihe GlaubensWorte nehmen Hans-Joachim Sander und Hans-Joachim Höhn diese Herausforderung an. In ihr stellen sie eine neue Sprachform für die Rede von Gott vor. Ihre Grundeinsicht lautet: Hinter den Substantiven, mit denen die Theologie traditionell von und über Gott redet, sind Verben zu entdecken, welche Gott als Ereignis einer bestimmten Praxis buchstabieren. Kurt Marti hat daraus einmal den Wunsch formuliert, „daß Gott ein Tätigkeitswort werde“.
In sechs Essaybänden spüren Sander und Höhn diesen Tätigkeitsworten nach. Dabei orientieren sie sich an den zentralen Themen der Systematischen Theologie, die sie in ihrer Bedeutung für unser Leben erkennbar werden lassen: nicht verleugnen Die befremdende Ohnmacht Jesu zustimmen Der zwiespältige Grund des Daseins nicht ausweichen Die prekäre Lage der Kirche spüren Die ästhetische Kraft der Sakramente nicht verschweigen Die unscheinbare Präsenz Gottes versprechen Das fragwürdige Ende der Zeit Hans-Joachim Sander, Dr. theol., geb. 1959; Professor für Dogmatik an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Salzburg. Rezension
Gleich zu Beginn seines Buches interpretiert Sander den 11. September 2001 als einen Ausdruck der 'Gottesgewalt': "Sie ist zur neuen Darstellungsweise Gottes geworden und sie bedeutet eine Theologie, die so irrsinnig falsch ist, daß es einem Theologen schon den Atem verschlagen kann ... Es ist kein Zufall, daß dieser Anschlag im Namen Gottes geschah; denn gerade dieser Name kann zu massiver, sogar massivster Gewalt verwendet werden."
Deshalb ist es ihm darum zu tun, vier Zeichen der Zeit, in denen das Problem der Gottesgewalt greifbar wird, theologisch zu interpretieren: Den religiösen Pluralismus, den Überhang junger Menschen, die Verstädterung und die globale Präsenz der Medien. Der Gottesgewalt stellt er das Gottesverschweigen entgegen: "Dann stellt sich eine Verschwiegenheit ein, die der heilvollen Präsenz Gottes eigentümlich ist, und es wird eine Gegenmacht in Gottes Namen eingebaut, die der Gottesgewalt nicht verfällt." (19) Diese Gegenmacht ("die leisen Töne der Gottesgegenwart" (39)) belegt Sander biblisch und interpretiert im dritten Kapitel das Handeln Mose, die Opferung des Isaak und das Opfer Jesu in diesem Sinne: "Im Opfer Jesu wird der Macht der Gottesgewalt nachhaltig widerstanden, weil die Macht Gottes verschwiegen zum Vorschein kommt. Sie nutzt den gewaltsamen Tod, um dessen Macht zu überwinden." (73) Daß die Fehlinterpretation der Gottesgewalt gerade auch zum Christentum gehört, belegt die Geschichte seines gewalttätigen Monotheismus. Sander lässt keinen Zweifel daran, wie verheerend dessen Auswirkungen waren. Als Kritik daran erschließt er den ontologischen Gottesbeweis des Anselm von Canterbury als eine Bestimmung Gottes, die sich der Sprachlosigkeit des Menschen bewusst ist: "Man triumphiert nicht mit der Größe Gottes über andere Größen, sondern nutzt diese kleineren Größen, um auf Gottes Größe zu schließen." (92) In diesem Sinne der reflektierten Sprachlosigkeit liest Sander auch die Mystik: "Sie weiß um etwas Unsagbares, das offenbar geworden ist." Wer sich dieser selbst erfahrenen Schwäche stellt, nämlich der Unfähigkeit, Gott zu begreifen, stellt sich dann auch gegen die Schwäche eigener Gewalt (101). Theologie kann nur dann zur bedeutsamen Rede von Gott werden, wenn sie sich der Gottesgewalt stellt, sie jedoch nicht im Sinne von Herrschaft und Macht über andere instrumentalisiert. Es geht darum: "... die Gewalt, die vom Auftreten mit Gott ausgehen kann, nicht zu verschweigen und sie zugleich in der Rede von Gott verschwiegen aufzulösen." Damit stellt Sander einen theologischen Ansatz zur Verfügung, der gerade die Tatsache, dass über Gott zu schweigen ist, weil er unser Reden übersteigt, als das begreift, worüber man reden muss. Wittgensteins berühmtem "Wovon man nicht sprechen kann, darüber muß man schweigen" stellt er den Satz: "Wovon man nicht sprechen kann, darüber darf man nicht schweigen." (134) gegenüber: "Theologie ist ein sprachliches Projekt, das nicht verschweigt, wovon sie nicht sprechen kann, weil ein Verschweigen sich mit der Gewalt im Namen Gottes und mit der Übermacht der Not im Leben abfinden würde." (134) Fazit: Sanders Überlegungen müssten unter anderem Pflichtlektüre sein für alle, die mit der Widersprüchlichkeit Gottes kämpfen, die sich ihres eigenen Gewaltpotentials bewusst werden wollen, die glauben, in ihrer christlichen Praxis auf Begriffe verzichten zu können, die mit der Behauptung ihrer Sanftmut Gewalt über andere ausüben, die der Meinung sind, dass eigentlich alle an den gleichen Gott glauben und die an der Gewaltgeschichte des Christentums leiden. Ich halte Sander im Spektrum der (mir bekannten) neueren theologischen Literatur für ein ungewöhnlich lesbares, scharfsinniges und hoch aktuelles Buch zur Gottesfrage, das belegt, wie produktiv Theologie in die gegenwärtigen Diskussionen eingreifen kann, wenn sie a) ihren Minderwertigkeitskomplex ablegt, b) sich von ihrem gleichzeitigen Überlegenheits- und Größenwahn verabschiedet (der u.a. im 'vertrauten' Umgang mit dem Namen Gottes begründet ist) und c) ihre eigene Tradition ernst nimmt. Matthias Wörther Inhaltsverzeichnis
Jenseits von Gotteskrise und Gottesgewalt - auf Gottes verschwiegenen Spuren ... 11
1. Gottesverschweigen - die Gegenwart einer unscheinbaren Macht ... 19 2. Verschwebendes Schweigen - der religiöse Ursprung des nahen Gottes ... 36 3. Verschwiegene Auskunft - die biblische Preisgabe des einzigen Gottes 3.1. Die Sprachpolitik des Mose - mit der Leerstelle des Namens gegen die Gottesgewalt ... 44 3.2. Die Opferung des Isaak - mit der Bindung des Glaubens gegen die Gottesgewalt ... 60 3.3. Das Opfer Jesus - mit der Hingabe des Körpers gegen die Gottesgewalt ... 60 4. Ausschweigende Abklärung - der gewaltsame Beleg des größeren Gottes ... 76 5. Nichtende Verneinung - das mystische Licht des dunklen Gottes ... 95 6. Bezweifeltes Plädoyer - die kritische Behandlung des fragwürdigen Gottes ... 104 7. Unzeitige Todesanzeige - die kalte Verwesung des gemordeten Gottes ... 110 8. Ohnmächtige Anfrage - die sprachlose Tatsache des anonymen Gottes ... 118 9. Unscheinbarer Auftritt - das verschwiegene Tätigkeitswort Gott ... 127 Weitere Titel aus der Reihe GlaubensWorte |
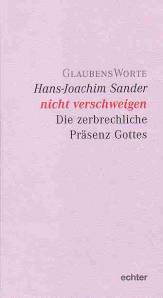
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen