|
|
|
Umschlagtext
„Die moderne Welt hat Gott verloren und sucht ihn“ (Alfred N. Whitehead). Doch auf diese grundlegende Erfahrung angemessen zu reagieren fällt der Theologie auch zu Beginn des 21. Jahrhunderts schwer. Mit der Reihe GlaubensWorte nehmen Hans-Joachim Sander und Hans-Joachim Höhn diese Herausforderung an. In ihr stellen sie eine neue Sprachform für die Rede von Gott vor. Ihre Grundeinsicht lautet: Hinter den Substantiven, mit denen die Theologie traditionell von und über Gott redet, sind Verben zu entdecken, welche Gott als Ereignis einer bestimmten Praxis buchstabieren. Kurt Marti hat daraus einmal den Wunsch formuliert, „daß Gott ein Tätigkeitswort werde“.
In sechs Essaybänden spüren Sander und Höhn diesen Tätigkeitsworten nach. Dabei orientieren sie sich an den zentralen Themen der Systematischen Theologie, die sie in ihrer Bedeutung für unser Leben erkennbar werden lassen: nicht verleugnen Die befremdende Ohnmacht Jesu zustimmen Der zwiespältige Grund des Daseins nicht ausweichen Die prekäre Lage der Kirche spüren Die ästhetische Kraft der Sakramente nicht verschweigen Die unscheinbare Präsenz Gottes versprechen Das fragwürdige Ende der Zeit Hans-Joachim Sander, Dr. theol., geb. 1959; Professor für Dogmatik an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Salzburg. Rezension
Wenn ein theologisches Buch mit dem Satz beginnt: "Derzeit spielt sich eine Entfremdung zwischen den Worten des Glaubens und den Welten des Lebens ab." (11), dann darf der Leser hoffen, auf Überlegungen zu stoßen, die tatsächlich etwas mit ihm selbst und seinen eigenen Erfahrungen zu tun haben. Sander will die gegenwärtige Ohnmachtserfahrung von Glaube, Theologie und Kirche als Chance begreifen und schlägt als Perspektive die Christologie vor, in der schon immer Macht und Ohnmacht, Göttliches und Menschliches, in der Person Jesu aufeinander zugeordnet sind. Die Macht Jesu und des Glaubens liegt in seiner Ohnmacht, das ist Sanders Grundthese.
Kapitel 1 zeigt diese Dialektik u.a. an der Geburt eines Königs in einem Stall: Ein Messias verweigert sich der ihm zugedachten Macht. Seine Geburt bleibt den Menschen im Machtkreis des Augustus fremd: "Der Beherrscher des Erdkreises, in dessen Bann sie existieren, muß Frieden mit Macht erzwingen; der Erlöser des Erdkreises, der ihnen fremd ist, schenkt diesen Frieden mit der Ohnmacht des Neugeborenen." (20) Ebenso quer zu den Erwartung steht die Predigt des Nazareners, die im zweiten Kapitel skizziert wird: "Das Reich Gottes ist von Jesus selbst nicht anders als eine Ohnmachtserfahrung beschrieben worden." (38) In ihm geht es nicht um irdische Macht, um eine 'ecclesia triumphans', sondern um ein Reich, das von einer anderen Größe lebt: "Wer auf das Reich Gottes setzt, zieht einen Wechsel auf die Zukunft. Es bleibt in einer prekären Weise ungewiß, ob und wie er eingelöst werden wird." (39) Diese Ohnmacht des kommenden Reiches kulminiert im Opfer Jesu: "Die Macht, die allein die Schuld vergeben kann, bleibt Gott; durch die Identifikation Jesu mit dieser Macht geschieht etwas Befremdliches mit Gott. Er wird nicht als Machtgestalt ins Feld geführt, der die Rachebedürfnisse der Opfer reinwaschen und die Heimsuchungsängste der Täter bestätigen kann. Er wird als jemand vorgestellt, der selbst das Ohmachtsproblem der Opfer kennt." (68) Der Tod Jesu ist Thema des dritten Kapitels: "Jesu Überantwortung an den Tod ist nicht die Verzweiflungstat eines Selbstmörders, dem nur noch die Gewalt übrig bleibt. Sie ist auch nicht die Widerstandstat eines Helden, der die Gewalt mit dem eigenen Leben stoppt. Sie ist vielmehr die totale Verweigerung der Gewalt." (78) Aus der 'gewollten' Ohnmacht erwächst die lebensstiftende Kraft dieses Todes: "Er meidet alles, was als Versuch einer Demonstration von Macht gewertet werden kann. Nichts, was er sagt, tut oder erduldet, taugt dazu, Herrschaft über andere auszuüben." (76/77) Und auch seine Auferstehung kann nicht als Machtdemonstration begriffen werden, wie das vierte Kapitel darlegt. Auferstehung ist nicht das hollywoodmäßige Happy-End, sondern eine erneute Befremdung und Irritation: Das leere Grab: "Das Zeichen, das damit gesetzt wird, ist nicht eine unabweisbare Macht, sondern ein Bilderverbot. Es beschreibt eben nicht die Auferstehung, sondern stellt mitten in die Auferstehungsgeschichte eine massive Leerstelle hinein." (85) Jesus enttäuscht auch die Naherwartung (Kapitel 5). Als die ersten Getauften sterben: "...war klar, daß entweder die Auferstehung keine verläßliche Sache war oder daß etwas mit der geäußerten Erwartung nicht stimmte." (95) Es war Paulus, der sich diesem Problem stellte, und es ist die Himmelfahrt, die jeder auf Macht setzenden Vereinnahmung Jesu entgegensteht: "Die Himmelfahrt ist das christliche Grundcharakteristikum in dieser Welt. Der, dessen Auferstehung die Macht des Todes überwunden hat, steht für kein Leben mehr zur Verfügung, das sich vom Tod knechten läßt." (97) Ebensowenig kann das Jüngste Gericht (Kapitel 6) als Machtdemonstration interpretiert werden, die dann doch noch und ganz zum Schluss den Christen eine machtvolle Rechthaberei erlauben würde: "Die Urteile, die Christus fällt, schließen die Geschichte nicht ab, sondern brechen sie auf." (105) Im letzten Kapitel beschreibt Sander die christologischen Dogmen (Nicäa) als diejenige Sprache der Differenz, die die Fremdheit Jesu in ihrer Dialektik von Macht und Ohnmacht für jede Zeit lebendig hält. Mit ihrer Hilfe wurde die Jesusgeschichte in den hellenistischen Kulturhorizont inkarniert: "Was dieses Dogma im hellenistischen Kontext entwickelt hat, ist signifikant für alle anderen Kontexte, in denen Evangelisierung stattfindet. An ihm sind die Regeln jeder Inkulturation des Evangeliums erkennbar." (115) Dieses Dogma führt nicht vom Evangelium weg, sondern in es hinein (117): es enthält sowohl ein Einheits- wie ein Differenzprinzip (123), die es erlauben, die Macht Gottes und die Ohnmacht des Menschen zusammenzusehen: "Die Differenz zwischen der Macht Gottes und der Ohnmacht der Menschen, die in Christus nicht gegeneinander ausgespielt werden, zeigen den befremdlichen Ort Christi im interkulturellen und interreligiösen Kontext." (125) Meiner Meinung nach wird die anfangs geäußerte Hoffnung auf weiter führende Gedanken durch das Buch Sanders in mehrfacher Hinsicht erfüllt: 1) zeigt Sander, dass das Lamento über die Ohnmacht des Glaubens in der Gegenwart weithin ein Lamento über den Verlust weltlicher Macht sein dürfte 2) bricht Sander alle Jesusbilder auf, die in Jesus letztlich doch eine Art göttlichen Terminator, Triumphator oder Weltherrscher sehen und seiner Ohnmacht ausweichen wollen, weil sie ein Eingeständnis eigener Ohnmacht erfordert 3) demonstriert Sander, dass Begriffe tatsächlich etwas erschließen und aussagen können. Deshalb ersetzt das Büchlein manchen dogmatischen oder fundamentaltheologischen Wälzer, weil es tatsächlich Gedanken enthält und voraussetzt, sich des eigenen Verstandes zu bedienen 4) die Virulenz dogmatischer Aussagen sichtbar macht und der im religionspädagogischen Horizont oft vorhandenen theologischen Theorieabstinenz und Abwehrhaltung gegenüber 'abstrakten und unverständlichen Dogmen' vor Augen führt, dass gegenwärtige Katechese ihren Ort und ihre Möglichkeiten nur begreifen kann, wenn sie tatsächlich über die christologischen Dogmen Bescheid weiß. Matthias Wörther Inhaltsverzeichnis
Christologie - eine Semiotik befremdlicher Menschwerdung ... 11
1. Jesus, Sohn Marias - der fremde Erlöser aus Nazareth ... 17 1.1. Das Kind, der Kaiser und der Kosmos - eine verkehrte Weltordnung ... 17 1.2. Maria und Gott - eine Liebesgeschichte mit bemerkenswerten Folgen ... 30 2. Der Gläubiger von Gottes Reich - die befremdliche Predigt des Nazareners ... 37 2.1. Das Opfer der Umkehr - der Eintrittspreis der Sünder ... 39 Exkurs: Die befremdliche Bedeutung des Opfers für die Religion ... 45 2.2. Die Umkehr des Opers - der Lobpreis der Sünde ... 61 3. Der Gekreuzigte seiner Zeit - der fremde König der Juden ... 69 3.1. Ein aktives Opfer und ratlose Täter - der Fluch der Gewalt ... 71 3.2. Ein Leben, das allen gehört - die Gewalt am Ende ... 75 4. Die Auferstehung - die befremdende Erscheinung eines leibhaftig Lebenden ... 81 4.1. Jenseits des Todes - jenseits der Religion ... 83 4.2. Diesseits der Gewißheit - diesseits des Kreuzes ... 90 5. Die Widerkunft - der entfremdende Zeitpunkt des Herrn 5.1. Die Sehnsucht nach einem Dieb in der Nacht ... 94 5.2. Die Gegenwart eines Entzogenen ... 96 6. Christi Gericht - die Fremdheit ewiger Gerechtigkeit ... 99 6.1. Gerechtigkeit ohne Recht ... 99 6.2. Urteil ja nach Ansehen der Person ... 101 7. Christi Dogmen - die fremde Person der zwei Naturen 7.1. Die Hellenisierung der Jesusgeschichte - die dogmatische Lösung einer Inkulturationsfrage ... 107 7.2. Die Absolutheit des Christusereignisses - die dogmatische Lösung eines Pluralismusproblems ... 117 Weitere Titel aus der Reihe GlaubensWorte |
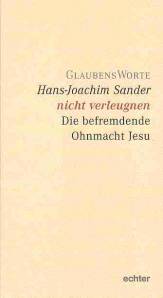
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen