|
|
|
Umschlagtext
„Die moderne Welt hat Gott verloren und sucht ihn“ (Alfred N. Whitehead). Doch auf diese grundlegende Erfahrung angemessen zu reagieren fällt der Theologie auch zu Beginn des 21. Jahrhunderts schwer. Mit der Reihe GlaubensWorte nehmen Hans-Joachim Sander und Hans-Joachim Höhn diese Herausforderung an. In ihr stellen sie eine neue Sprachform für die Rede von Gott vor. Ihre Grundeinsicht lautet: Hinter den Substantiven, mit denen die Theologie traditionell von und über Gott redet, sind Verben zu entdecken, welche Gott als Ereignis einer bestimmten Praxis buchstabieren. Kurt Marti hat daraus einmal den Wunsch formuliert, „daß Gott ein Tätigkeitswort werde“.
In sechs Essaybänden spüren Sander und Höhn diesen Tätigkeitsworten nach. Dabei orientieren sie sich an den zentralen Themen der Systematischen Theologie, die sie in ihrer Bedeutung für unser Leben erkennbar werden lassen: nicht verleugnen Die befremdende Ohnmacht Jesu zustimmen Der zwiespältige Grund des Daseins nicht ausweichen Die prekäre Lage der Kirche spüren Die ästhetische Kraft der Sakramente nicht verschweigen Die unscheinbare Präsenz Gottes versprechen Das fragwürdige Ende der Zeit Hans-Joachim Höhn, Dr. theol., geb. 1957; Professor für Systematische Theologie und Religionsphilosophie an der Philosophischen Fakultät der Universität zu Köln. Rezension
Höhns Buch ist der Versuch, eine Schöpfungstheologie zu entwerfen, die die Relevanz des Glaubens und seiner Ansätze im Blick auf den Sinn der Existenz auch 'Außenstehenden' interessant und einsichtig macht. Dafür die Form eines Essays zu wählen, der nicht den Preis 'einer sterilen Wissenschaftssprache' (14) zahlen will, ist lobenswert. Das Ergebnis scheint mir jedoch für Nicht-Theologen und Nicht-Philosophen, falls sie angesprochen werden sollten, immer noch zu sehr den entsprechenden Fachsprachen verhaftet. Oder anders: Dieser Versuch, Aspekte Gottes als Tätigkeitsworte zu formulieren, wird doch eher mit Substantiven verfolgt.
Unter den Stichworten 'Naturalisierung', 'Psychologisierung', 'Soziologisierung' und 'Historisierung' der menschlichen Subjektivität umreißt Höhn zunächst die moderne 'Depotenzierungs-Erfahrung' des Menschen: "...der Mensch sieht sich nicht als Krone der Schöpfung, sondern als deren Rohstoff." (23) Den (natur)-wissenschaftlichen Deutungsmodellen menschlicher Existenz stellt Höhn die Logik des Mythos gegenüber. Er will "andere erkenntnisvermittelnde Instanzen und Traditionen zulassen wie etwa den Mythos" (43). Auch wenn er dessen Hermeneutik und den entmythologisierenden Zugriff auf ihn in einem eigenen Kapitel (2.3.) darstellt, bleibt meines Erachtens undeutlich, warum sich ein Zeitgenosse (und vor allem ein 'Außenstehender') der Mythen und vor allem gerade des biblischen Schöpfungsmythos zur 'Ursprungsreflexion' und Existenzdeutung bedienen sollte. Ohne überzeugende Darlegung dieses Warum steht die folgende Ausdeutung der biblischen Texte (Kapitel 3) trotz ihrer Schlüssigkeit und anregenden Ansätze immer ein wenig unter zweifelndem Vorbehalt des Lesers. Höhn räumt allerdings auch ein, dass auch eine auf den biblischen Mythos bezogene 'Ursprungsreflexion' nur zu Teilantworten führen kann (109) und die Zustimmungsfähigkeit des menschlichen Daseins nicht generell begründet. Es behält seine Zwiespältigkeit, die auch mit verschiedenen Strategien (Funktionalisierung, Abschwächung, Moralisierung oder Ästhetisierung des Bösen, Kapitel 4) nicht aus der Welt zu schaffen ist. Die damit in den Blick kommende Theodizee-Frage beantwortet Höhn auf den konkreten Lebensvollzug bezogen: "Wenn es überhaupt eine Theodizee geben kann, dann ist sie nur als 'praktische' möglich: als Solidarität mit den Leidenden, als Bestreitung jedweden Versuches, den Skandal ihres Leidens zu relativieren. In einer 'praktischen' Theodizee kommt es zum tätigen Protest gegen die Belanglosigkeit der Leidenden." (139) Matthias Wörther Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1. Vergebliche Hoffnungen? Vom Vermissen und Bestreiten sinnvollen Daseins ... 15 1.1. Dasein unter Vorbehalt: Die Frage, was es mit dem Menschen letztlich auf sich hat ... 18 1.2. Dasein im Ungewissen: Die Frage, was man mit dem Leben anfangen kann ... 25 2. Zweifelhafte Anfänge? Zur Hermeneutik des Daseins ... 37 2.1. Der entzogene Anfang: Existenzvergewisserung als Orientierungssuche ... 39 2.2. Der Anfang, der niemals war und immer ist: Die Logik des Mythos ... 43 2.3. "Was als Anfang geschah": Zur Deutung von Schöpfungsmythen ... 45 3. Gute Gründe? Der Zwiespalt des Daseins und der Sinn der Schöpfung ... 52 3.1. "Als Anfang schuf Gott" (Gen 1,1): Daseinsermöglichende Unterschiede ... 53 3.2. Die Erde und das Wort: Die Herkunft des Menschen ... 58 3.2.1. Staube und Sprache: Dasein als "Im-Wort-Sein" ... 60 3.2.2. Dasein als Zusage: Die Sinnstruktur der Schöpfung ... 64 3.3. Bild Gottes: Die Bestimmung des Menschen ... 70 3.3.1. Entsprechungen: Gott - Schöpfung - Mensch ... 75 3.3.2. BIld des Unsichtbaren: Bilderverbot und Gottebenbildlichkeit ... 77 3.3.3. Mitgeschöpflichkeit: Die Verantwortung des Menschen ... 81 3.4. Der Rhythmus des Lebens: Die Zeit des Menschen ... 89 3.5. Der Riß in der Schöpfung: Die Verfehlung des Menschen ... 93 3.5.1. Mißverhältnisse: Von der Verkehrung wohltuender Unterschiede ... 95 3.5.2. Die Unheimlichkeit des Daseins: Der Hervorgang der Daseinsangst ... 102 3.5.3. Jenseits von Eden: Verlorenes Ansehen ... 104 4. Schlechte Aussichten? Aporien des Daseins - Aporien des Glaubens ... 109 4.1. Vom Guten des Schlechten: Philosophische Ansätze zur Akzeptanz des Negativen ... 111 4.1.1. "Aus Leiden klug werden": Die Funktionalisierung des Negativen ... 111 4.1.2. "Das macht doch nichts": Die Abschwächung des Negativen ... 113 4.1.3. "Wer weiß, wozu es gut ist": Die Moralisierung des Übels 4.1.4. "Widerlich - und doch faszinierend": Die Ästhetisierung des Übels 4.2. Gar nicht so übel? Der Preis für die Entsorgung des Schlechten 117 4.3. Bestmögliche Wirklichkeit? Theologische Ansätze zur Akzeptanz des Negativen 4.3.1. Der Unterschied von Sein und Nichts: Endlichkeit als Preis des Daseins? ... 125 4.3.2. Der Unterschied von Zeit und Nichts: Tod als Preis der Endlichkeit ... 132 4.3.3. Der Unterschied von Sinn und Nichts: Leiden und Schuld als Preis der Freiheit? ... 134 4.4. Gott und das Leiden - Jenseits aller Theodizee ... 136 Anmerkungen ... 141 Weitere Titel aus der Reihe GlaubensWorte |
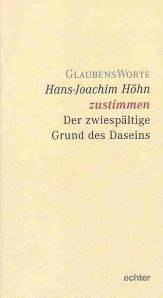
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen