|
|
|
Umschlagtext
Schlafstörungen im Kindes- und Jugendalter sind ein weit verbreitetes Problem. Vor allem Ein- und Durchschlafprobleme, Alpträume, Schlafwandeln und Nachtschreck treten in diesem Alter häufig auf. Das Manual beschreibt die einzelnen Sitzungen eines Therapieprogramms für Eltern mit Kindern und Jugendlichen im Alter von 4 bis 13 Jahren, die unter Insomnie- und/oder Parasomniebeschwerden leiden.
Nach einer Einführung in die Klassifikation, Diagnostik und Entstehung von Schlafstörungen im Kindes- und Jugendalter werden die sieben Therapiesitzungen beschrieben. Ziel des Behandlungsprogrammes ist es, den Eltern und ihren Kindern das notwenige Grundlagenwissen zum Schlaf zu vermitteln sowie die Bedeutung der Schlafhygiene und ihre Umsetzung aufzuzeigen. Strategien für den Umgang mit Konflikten, die im Rahmen der Schlafsituation auftauchen, und Interventionen zur Reduzierung von schlafbezogenen Ängsten werden anschaulich erörtert. Zudem werden spezifische Maßnahmen zur Behandlung von Ein- und Durchschlafproblemen, Albträumen, Schlafwandeln und Pavor nocturnus vermittelt. Sämtliche Informations- und Arbeitsmaterialien zur Durchführung des Behandlungsprogramms sind im Manual abgedruckt. Sie erleichtern eine problemlose Anwendung des Programms in der therapeutischen Praxis sowohl im Gruppen- als auch im Einzelsetting. Rezension
Nicht wenige Kinder (und deren Eltern) leiden unter kindlichen Schlafstörungen; Schlafstörungen im Kindes- und Jugendalter sind ein weit verbreitetes, aber wenig thematisiertes Problem. Vor allem Ein- und Durchschlafprobleme, Alpträume, Schlafwandeln und Nachtschreck treten in diesem Alter häufig auf. Dieses praktische Therapiemanual bietet vor den eigentlichen Therapiematerialien eine Einführung in die Klassifikation, Diagnostik und Entstehung von Schlafstörungen im Kindes- und Jugendalter. Das Manual beschreibt die einzelnen Sitzungen eines Therapieprogramms für Eltern mit Kindern und Jugendlichen im Alter von 4 bis 13 Jahren. Alle Sitzungen sind mit klaren Arbeitsanweisungen versehen. Weiterführende Literatur ist zahlreich genannt.
Jens Walter, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Dr. phil. Leonie Fricke, geb. 1973. 1993-1998 Studium der Psychologie in Köln. 1998-2002 Mitarbeiterin am Psychologischen Institut der Universität zu Köln. 2002 Promotion. 2003 Approbation zur Psychologischen Psychotherapeutin für Erwachsene und Gruppen sowie 2005 für Kinder und Jugendliche. Seit 2002 Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters der Universität zu Köln. Prof. Dr. med. Dipl.-Psych. Gerd Lehmkuhl, geb. 1948. 1967-1973 Studium der Medizin in Köln und Hamburg. 1973 Promotion. 1975-1980 Studium der Psychologie in Aachen. Arzt für Neurologie und Psychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie/Psychoanalyse. 1986 Habilitation. Seit 1988 Professor für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Direktor der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters zu Köln. Inhaltsverzeichnis
Vorwort 9
I. Theoretische Grundlagen Kapitel 1: Die Kunst zu Schlafen 13 Kapitel 2: Klinische Symptomatik und Epidemiologie 15 2.1 Klinische Symptomatik 15 2.2 Epidemiologie 16 Kapitel 3: Klassifikation und Diagnostik 19 3.1 Klassifikation 19 3.2 Diagnostik 25 Anhang: Explorationsschema 27 Kapitel 4: Pathogenese und aktuelle Behandlungskonzepte 33 4.1 Pathogenese 33 4.2 Aktuelle Behandlungskonzepte 34 Kapitel 5: Evaluation des Behandlungsprogramms 38 5.1 Durchführung in der Gruppe 38 5.2 Durchführung im Einzelsetting 42 5.3 Zusammenfassung 43 II. Therapiemanual Kapitel 6: Das Fledermaus-Programm 47 6.1 Formale Hinweise zum Behandlungsprogramm 47 6.2 Therapeutische Grundsätze bei der Behandlung 49 Anhang: Verlaufsprotokollbogen 51 Kapitel 7: Erste Sitzung – Informationen zum Schlaf und Austausch über die kindlichen Schlafprobleme 52 7.1 Einführung durch den Therapeuten 52 7.2 Darstellung des Behandlungskonzepts 53 7.3 Blitzlicht: Vorstellungsrunde der Teilnehmer 53 7.4 Information: Referat zum Thema „Der Schlaf“ 54 7.5 Realisierung: Feststellung des Ist-Zustandes des kindlichen Schlafverhaltens und Fokussierung der Stärken des Kindes 61 7.6 Hausaufgaben 61 Anhang: Materialien zur ersten Sitzung 62 Kapitel 8: Zweite Sitzung – Schlafrituale und Einschlafhilfen 92 8.1 Blitzlicht 92 8.2 Information: Referat zum Thema „Schlafhygiene“ 93 8.3 Realisierung 95 8.4 Hausaufgaben 97 Anhang: Materialien zur zweiten Sitzung 98 Kapitel 9: Dritte Sitzung – Wenn nicht nur der Schlaf Probleme bereitet: oppositionelles Verhalten und schlafbezogene Konflikte 110 9.1 Blitzlicht 110 9.2 Information: Referat zum Thema „Allgemeine Erziehungsstrategien, Teil 1: Oppositionelles Verhalten & Schlafen“ 111 9.3 Realisierung 111 9.4 Hausaufgaben 113 Anhang: Materialien zur dritten Sitzung 115 Kapitel 10: Vierte Sitzung – Ängste und Schlafen 133 10.1 Blitzlicht 133 10.2 Information: Referat zum Thema „Allgemeine Erziehungsstrategien, Teil 2: Ängste und Schlafen“ 134 10.3 Realisierung 135 10.4 Hausaufgaben 136 Anhang: Materialien zur vierten Sitzung 137 Kapitel 11: Fünfte Sitzung – Die verschiedenen Formen von Schlafstörungen und der Einsatz von Entspannungsübungen bei Ein- und Durchschlafproblemen 153 11.1 Blitzlicht 153 11.2 Information: Referat zum Thema „Ein- und Durchschlafprobleme“ 154 11.3 Realisierung 155 11.4 Hausaufgaben 156 Anhang: Materialien zur fünften Sitzung 157 Kapitel 12: Sechste Sitzung – Albträume, Nachtschreck und Schlafwandeln 173 12.1 Blitzlicht 173 12.2 Information: Albträume, Nachtschreck und Schlafwandeln 174 12.3 Realisierung 176 12.4 Hausaufgaben 176 Anhang: Materialien zur sechsten Sitzung 177 Kapitel 13: Siebte Sitzung – Wie geht es nach dem Behandlungsprogramm weiter: Stabilisierung und Umgang mit Rückfällen 191 13.1 Blitzlicht 191 13.2 Information: Vortrag zum Thema „Stabilisierung und Umgang mit Rückfällen“ 191 13.3 Realisierung 192 13.4 Rückblick auf die Zeit des Behandlungsprogramms 192 13.5 Verabschiedung der Gruppe/des Einzelpatienten 192 Anhang: Materialien zur siebten Sitzung 193 Literatur 198 Anhang 201 Adressen 203 Lesprobe: Vorwort Wenn man nachts nicht schlafen kann, hört man von den schiefergrauen Dächern junge Katzen miauen, und das hört sich schaurig an. Mascha Kaléko Der Schläfer gibt dem Wächter seinen Traum, und dieser hütet ihn, und beide sind zusammen erst ein Raum. Elias Canetti Schlafprobleme bei Kindern sind häufig und haben viele unterschiedliche Gründe. Kinder sowie Eltern leiden unter diesem Zustand, der sich nicht selten krisenhaft zuspitzt, wobei mit ganz unterschiedlichen Methoden versucht wird, den Schlaf herbeizuführen. Neben beeindruckenden Sortimenten chemischer Schlaf- und Beruhigungstabletten zählen Koch und Overath (2002) eine ganze Palette von bewährten Hausmitteln auf: Kräutertees, Kügelchen, Kuren, Sole- oder Schwefelbäder, körperliche Ermüdungsprogramme, „darunter vornehmlich Schwimmen und Laufen. Auch Yoga und autogenes Training dürfen nicht unerwähnt bleiben und nicht das warme oder kalte Bier mit oder ohne Ei schon am Nachmittag oder erst um Mitternacht. Schlafstrategien raten je nach Konstitution zu unterkühlten und überhitzten Zimmern mit oder ohne Zugluft, zur Hängematte oder der besonders harten oder besonders weichen Matratze.“ (S. 29). Leider gelingt es nicht immer, „so ruhig wie ein Baby“ zu schlafen und es braucht Unterstützung, Hilfe und Rituale, um die Bangigkeit vor dem Dunkeln und das Erwachen der Gespenster zu bewältigen. Dass es schwer sein kann, den Schlaf zu suchen und zu finden, verdeutlichen de Sivry und Meyer (1997) in ihrer Kulturgeschichte des Schlafes: „So wie im kommenden Jahrhundert unsere Nachkömmlinge diese Handbücher zur Kindererziehung vielleicht seltsam finden, so wie uns heute die von Jacqueline Pascal für die Mädchen von Port-Royal verfasste Schrift ,Die Vorschriften für Klosterkinder‘ entfernt erscheint, so wahr ist es auch, dass jede Epoche ihre eigenen Schlafriten erfindet; auch die heutigen sind dazu bestimmt, sich weiter zu entwickeln“ (S. 32). So regelt Jean-Baptiste de La Salle in seinem 1703 erschienenen Sittenhandbuch den Ablauf des Zubettgehens der Kinder: „Die Schlafensstunde ist auf ‚etwa zwei Stunden nach dem Abendmahl‘ festgesetzt, und ‚etwa sieben Stunden sind ausreichend, um den Körper auszuruhen, sofern man nicht außergewöhnlich schwer hat arbeiten müssen‘. Aber ‚man muss es sich selbst zum ehernen Gesetz machen, in aller Frühe aufzustehen und seine Kinder daran zu gewöhnen, sobald sie größer geworden sind und wenn sie keine Gebrechen haben, die dem entgegenstehen‘. Es ist auch ‚sehr unschicklich und wenig sittsam, im Bett zu plaudern, zu scherzen oder zu spielen‘, stellt La Salle klar, ‚nehmt Euch kein Beispiel an gewissen Personen, welche sich mit Lesen oder anderen Dingen beschäftigen … bleibt niemals im Bett, wenn Ihr nicht mehr schlaft, es wird Eurer Tugend sehr zugute kommen … Die schon im jüngsten Alter angenommene Angewohnheit der Trägheit wird sich im Laufe des ganzen weiteren Lebens auswirken‘ “ (zit. n. Dibie 1989, S. 158). Und knapp 100 Jahre später kommen von Jean Paul 14 unschädliche Imaginationsanregungen, sich in der Kunst des Einschlafens zu üben: „Sämtlich laufen sie in der Kunst zusammen, sich selber Langeweile zu machen, eine Kunst, die bei gedachten logischen Köpfen auf die unlogische Kunst nicht zu denken, hinauskommt.“ Und so entwickelt er einschläfernde, nicht enden wollende Bilderketten: „Der eine stellt sich auf einen Stern und wirft aus einem Korbe voll Blumen eine nach der anderen in den Weltabgrund, um ihn (hofft er) zu füllen; er entschläft aber vorher. Ein anderer stellt sich an eine Kirchentüre und zählt und sieht die Menge ohne Ende, die herauszieht. Ein Dritter, z. B. ich selber, reitet um die Erde, eigentlich auf der Wolkenbergstraße des Dunstkreises, auf der wahren, um uns hängenden Bergkette von Riesengebirgen, und reitet (indem er unaufhörlich selber das Ross bewegt) von Wolke zu Wolke und zu Pol-Scheinen und Nebelfeldern, und dann schwimmt er durch langes Blau und durch Äquator-Güsse, und endlich sprengt er zum anderen Pole wieder zu uns herauf. Ein vierter Schaulustiger sitzt irgendeinen Genius bis an den halben Leib in eine lichte Wolke und will ihn mit Rosen rundum legen und überdecken, die aber alle in die weiche Wolke untersinken; der Mann lässt indes nicht ab und umblümelt weiter – in die Runde – und immerfort – und die Blumen weichen – und der Genius ragt – wahrhaftig ich schliefe hier, hielt mich nicht das Schreiben munter, unter demselben selber ein“ (1987, S. 177). Diese Methoden mögen antiquiert erscheinen, belegen jedoch, dass Schlafprobleme schon immer Anlass waren, Techniken zu überlegen, die uns einen geruhsamen Schlaf ermöglichen. Mit dem vorliegenden Therapiemanual sollen zeitgemäße Praktiken vermittelt werden, wobei einzelne Bausteine entsprechend den Bedürfnissen aus dem Gesamtprogramm ausgewählt werden können. Das schrittweise edukative Vorgehen und die aktive Beteiligung der Eltern an der inhaltlichen Umsetzung und Gestaltung entspricht dem aktuellen Zeitgeist, der ressourcenorientiert eine aktive Mitgestaltung durch die Betroffenen als besonders hilfreich erlebt. Das Therapiemanual ist im Rahmen des größeren Schlafprojektes „Guter Schlaf für Kölner Kinder“ konzipiert und erprobt worden. Ohne die großzügige Unterstützung durch die Imhoff-Stiftung und die ermutigende Projektbegleitung hätte die Studie nicht realisiert werden können. Weiterhin danken wir allen Kindern und Eltern, die an der Studie teilgenommen haben, und somit zur Entstehung dieses Therapiekonzeptes beigetragen haben. Unser Dank gilt darüber hinaus den beteiligten Mitarbeitern, Frau Dr. S. von Widdern, Frau U. Breuer, Herrn A. Mitschke sowie Herrn Dr. A. Wiater. Durch ihre Mitarbeit und konstruktiven Diskussionsbeiträge können wir das Kölner Behandlungsprogramm für Kinder und Jugendliche mit Schlafstörungen in der jetzigen Form vorlegen und hoffen auf seine erfolgreiche Anwendung. Anmerkung: * Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde im gesamten Text auf die Nennung der femininen und maskulinen Form (Therapeutin/ Therapeut) verzichtet. Obwohl im Text das generische Maskulinum verwendet wird, sind immer beide Geschlechter gemeint. Köln, im Mai 2005 Leonie Fricke und Gerd Lehmkuhl Weitere Titel aus der Reihe Therapeutische Praxis |
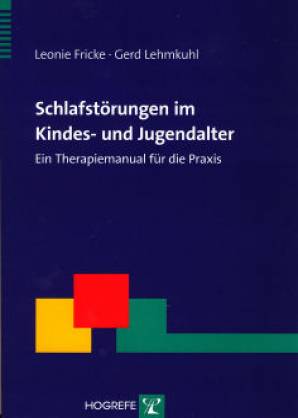
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen