|
|
|
Umschlagtext
Für wen ist dieses Buch geschrieben?
Logopäden, Sprachheilpädagogen, klinische Linguisten und Studierende dieser Fachrichtungen. Was möchte das Buch vermitteln? Patienten mit zentralen Sprachstörungen (Aphasien) leiden unter vielfältigen Störungen der expressiven und rezeptiven Wortverarbeitung. Eine durchschaubare Beziehung zwischen theoretischen Überlegungen und praktischen Anwendungen in Diagnostik und Therapie zu vermitteln, ist Ziel dieses Buches. Es unterscheidet sich darin von bisher erhältlichen Publikationen. Der Inhalt Um die Entstehung der Störungen des Wortabrufs zu erklären, wird zunächst der Aufbau des „Lexikons im Kopf" beschrieben. Anschließend wird anhand einfacher Modellausschnitte schrittweise gezeigt, welche Zugänge es zu diesem internen Lexikon gibt, welche Prozesse fehllaufen können und was für Fehler daraus resultieren. Auf diesem Hintergrund werden dann Untersuchungsmöglichkeiten und eine Vielzahl von Hilfestellungen und ihre Effekte dargestellt. Rezension
Aphasie ist eine erworbene Sprachstörung und bedeutet so viel wie “Verlust der Sprache”. Die Sprachstörung tritt in unterschiedlichen Schweregraden auf. Das vorliegende Fachbuch widmet sich einem besonderen Merkmal von Asphatien - den Wortfindungs- und Wortverarbeitungsstörungen. Sie können sich unterschiedlich darstellen (sprechen - verstehen - lesen - schreiben). Zu unterscheiden ist dabei, ob das sprachliche Wissen gestört ist oder ob der Zugriff auf das sprachliche Wissen nicht mehr gelingt. Im Mitelpunkt des Buches steht die Frage, wie gestörte bzw. ungestörte Prozesse der Wortverarbeitung analysiert werden können. Vor allem die ausführlich bschriebenen Fallbeispiele und die Übungsvorschläge machen das Thema anschaulich. Sehr hilfreich sind auch die im Glossar verständlich erläuterten Fachbegriffe.
Arthur Thömmes, lehrerbibliothek.de Inhaltsverzeichnis
Vorwort der Herausgeberinnen VII
Vorwort VIII Einleitung 1 Wortfindungsstörungen, Wortfindungsirrtümer und Versprecher bei Gesunden 1 Störungen der Wortverarbeitung bei Aphasien 1 Störungen der Wortfindung bei anderen zerebralen Erkrankungen 2 Beziehungen zwischen „normalen" Wortfindungsstörungen und Störungen bei Aphasie 2 Anmerkungen zum Aufbau des Buches 3 1 Das „Lexikon im Kopf" 4 1.1 Organisation des mentalen Lexikons: Ordnung oder Chaos? 4 1.2 Wie viele Wörter gibt es, und wie kann man diese Wörter zählen?___ 5 1.2.1 Das ständig wachsende Lexikon und seine Benutzer 6 1.3 Wort ist nicht gleich Wort - vom Unterschied der Wörter 7 1.4 Wie groß ist das individuelle mentale Lexikon? 8 1.5 Wie ist das mentale Lexikon geordnet? 8 1.5.1 Ordnung und Speicherung nach sprachlich-strukturellen Prinzipien 9 1.5.2 Beziehungen zwischen Lexikoneinträgen 10 1.5.2.1 Semantische Beziehungen 11 1.5.2.2 Morphologische Verwandtschaften 11 1.5.2.3 Phonologische Verwandtschaften 11 1.5.2.4 Ordnung nach syntaktischen Kriterien 12 1.6 Assoziative Beziehungen 12 2 Modelle von Verarbeitungsprozessen 14 2.1 Aktivierung des mentalen Lexikons in unterschiedlichen Modalitäten . 14 2.1.1 Benennen von Bildern und Gegenständen 15 2.1.2 Lesen von Wörtern und PseudoWörtern 18 2.1.3 Verstehen gesprochener Wörter / Erkennen von PseudoWörtern 21 2.1.4 Nachsprechen von Wörtern / Pseudowörtern 23 2.1.5 Schreiben von Wörtern 24 2.2 Ein multimodales „serielles" Modell der Wortverarbeitung 28 2.2.1 Fragen zum Modell 29 2.2.2 Ein alternatives Netzwerkmodell 30 2.3 Schlußbemerkungen 33 3 Interpretation von Fehlleistungen anhand des Modells 34 3.1 Fehlerklassifikation versus prozeßorientierte Fehlerinterpretation 34 3.2 Basisannahmen zur Fehlerentstehung 35 3.2.1 Probleme bei der Fehlerinterpretation 36 3.3 Unterschiedliche Störungsprozesse und ihre Auswirkungen bei der Wortverarbeitung 37 3.3.1 Exkurs über „Priming" 37 3.3.2 Exkurs: Unterschied von Weigls Sprachmodell und modernen Wortverarbeitungsmodellen 38 3.4 Störungen im Zugang zum auditiven Eingangslexikon 39 3.5 Störungen im Zugang zum orthographischen (visuellen) Eingangslexikon 39 3.5.1 Störungen im Zugang zum orthographischen Ausgangslexikon 40 3.6 Störungen im Zugang zum zentralen semantischen System 40 3.7 Störungen im Zugang zum phonologischen Ausgangslexikon 41 3.7.1 Teilweise Unterbrechung zwischen semantischem System und phono- logischem Ausgangslexikon 41 3.7.2 Extreme Erhöhung des Aktivierungslevels für einige oder viele Wörter 41 3.7.3 Aktivierung in Abhängigkeit der Gebrauchsfrequenz 41 3.7.4 „Response"-Blockaden 42 3.8 Störungen innerhalb des phonologischen Ausgangslexikons 42 3.8.1 Unzureichende Aktivierung von Wortformen 42 3.8.2 Störungen der Auswahl und Ordnung von Phonemen 44 3.8.3 Perseveration und Antizipation von Phonemen 45 3.9 Störungen innerhalb des semantischen Systems 45 3.10 Fehlleistungen bei der Verarbeitung flektierter, abgeleiteter und zusammengesetzter Wörter 46 4 Untersuchungsmöglichkeiten 49 4.1 Die Aufgaben des „PALPA" 50 4.1.1 Auditive Verarbeitung 50 4.1.2 Überprüfung der Semantik 51 4.1.3 Lesen und Schreiben von Wörtern 52 4.2 Die Aufgaben des LeMo 54 4.2.1 Aufgaben und Ziele der Aufgaben 54 4.2.1.1 Auditive Verarbeitung von Wörtern und PseudoWörtern 54 4.2.1.2 Visuelle Verarbeitung von Wörtern und PseudoWörtern 55 4.2.1.3 Lautes Lesen von Wörtern und Peudowörtern 57 4.2.1.4 Schreiben nach Diktat 59 4.2.1.5 Nachsprechen 60 4.2.1.6 Mündliches und schriftliches Benennen 61 4.2.1.7 Zur Auswertung 62 4.3 Die Freiburger Funktionenvergleichsprüfung 63 4.3.1 Exkurs zum Verhältnis „Sprechen" und „Schreiben" 63 4.3.2 Materialauswahl und Aufgaben 63 4.3.3 Aufgabenfolge der Freiburger Funktionenvergleichsprüfung 64 4.4 Materialien zur neurolinguistischen Aphasiediagnostik 64 4.4.1 Auditives Sprachverständnis: Wortbedeutungen 64 4.4.2 Visuelles Sprachverständnis: Wortbedeutungen 65 5 Exemplarische Fälle 66 5.1 Der Fall M. K 66 5.1.1 Aufgaben und Ergebnisse der Untersuchung 68 5.1.1.1 Leseverständnis 68 5.1.1.2 Lautes Lesen 70 5.1.1.3 Verstehen gesprochener Wörter 71 5.1.1.4 Nachsprechen und Diktatschreiben 72 5.1.1.5 Verzögertes Abschreiben 74 5.1.1.6 Mündliches und schriftliches Benennen 75 5.1.2 Interpretation der Ergebnisse 76 5.2 Produktion geschriebener und gesprochener Wörter: eine Gruppen- studie mit der Freiburger Funktionenvergleichsprüfung 80 5.2.1 Zusammenfassung der Ergebnisse 81 5.3 Phonologische Störungen 83 5.3.1 Aufgaben und Ergebnisse der Untersuchung 83 6 Therapiestudien bei Wortfindungsstörungen 86 6.1 Vorüberlegungen zur modellgeleiteten Therapie 86 6.2 Fehlervarianten und Effekte unterschiedlicher Cueing-Techniken 88 6.2.1 Langzeiteffekte phonematischer und semantischer Hilfen 92 6.3 Therapiestudien 93 6.3.1 Probleme früher Therapiestudien 94 6.3.2 „Semantische" Therapie bei Wortfindungsstörungen 95 6.4 Individuelle, modellgeleitete Therapieansätze 95 6.4.1 Fall 1 96 6.4.2 Fall 2 a/b 97 6.4.3 Fall 3 98 6.4.4 Fall 4 a/b 99 7 Übungsvorschläge 101 7.1 Überblick 102 7.2 Übungen zur Semantik (mit Bildmaterial) 104 7.2.1 Beziehungen erkennen 104 7.2.2 Semantisches Sortieren 105 7.2.3 Wort-Bild-Zuordnen 106 7.3 Übungen zur Semantik (ohne Bildmaterial) 108 7.3.1 Eliminieren eines unpassenden Elements 108 7.3.2 Zuordnen von Wörtern nach semantischen Kriterien 109 7.3.3 Reihen bilden 109 7.3.4 Synonyme/Antonyme erkennen 110 7.4 Übungen zur Semantik (Produktion) 110 7.4.1 Definieren vorgegebener Wörter 111 7.4.2 Wörter mit zwei Bedeutungen erklären 111 7.4.3 Unterschiede bedeutungsähnlicher Wörter erklären 111 7.4.4 Analogien herstellen 111 7.4.5 Implikationen finden 111 7.5 Übungen zur Phonologie 112 7.5.1 „Gleich - ungleich" bei PseudoWörtern und Wörtern 112 7.5.2 Lexikalisches Entscheiden 112 7.5.3 Verstehen von Minimalpaaren 113 7.5.4 Reimurteile 114 7.5.5 Ordnen von Phonemfolgen 114 7.6 Hilfestellungen beim Benennen 114 7.6.1 Kontexte 115 7.6.2 Semantische Hilfen in unterschiedlichen Modalitäten 115 7.6.3 Phonematische Hilfen 115 7.6.4 Aktivierung der Verbindung von semantischem System und phono- logischem Ausgangslexikon 116 Glossar 117 Literatur 122 Sachverzeichnis 127 Weitere Titel aus der Reihe Forum Logopädie |
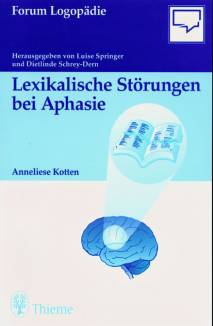
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen