|
|
|
Umschlagtext
Dieses Buch rekonstruiert die Frontstellungen und Abgrenzungen, denen ein populärer Text wie »Generation Golf« seinen Identifikationswert für die Leser verdankt. Wie produziert der Autor sein Ensemble alltäglicher Beobachtungen und Eindrücke so, dass beim Leser Effekte des »Erkennens« provoziert werden?
Die Studie verdeutlicht dabei nicht nur, wie, sondern weshalb z.B. der Begriff »Generation« oder das Datum »68« spontane Zustimmung hervorrufen. Dabei verdeutlicht sie, wie sich Pierre Bourdieus Theorie des literarischen Feldes in ein Analyseverfahren überführen lässt, das in den Sprach- und Literaturwissenschaften eingesetzt werden kann. Rezension
Eine popkulturelle und kommerzielle Erfolgsstory: Im Jahr 2000 erschien das Buch von Florian Illies mit dem Titel: Generation Golf. Er beschreibt darin in unterhaltsam, anekdotischen Stil aus eigener Erinnerung die aus seiner Sicht typischen Merkmale der Generation, die in den 1980er Jahren in der Bundesrepublik aufwuchs, also die zwischen 1965 und 1975 in der Bundesrepublik Deutschland Geborenen. Innerhalb von nur 8 Jahren hat Generation Golf 11 Auflagen erlebt; die Leser haben sich in den Buch wiedererkannt. Wie ist dieses Phänomen zu erklären? Darum geht es in dieser Darstellung. Wie erzielt der Autor den Identifikationswert für die Leser, wie produziert der Autor sein Ensemble alltäglicher Beobachtungen und Eindrücke so, dass beim Leser Effekte des »Erkennens« provoziert werden? Mit Hilfe von Pierre Bourdieus Theorie des literarischen Feldes vermag der Autor Erklärungen zu liefern.
Dieter Bach, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Tom Karasek (Dr. phil.) lehrte Sprachwissenschaft an der Universität Siegen. Seine Forschungsschwerpunkte und Interessen liegen in der Diskursanalyse und in der politischen Kommunikation. Schlagworte: Kultur, Literatur, Pop, Generation, Diskursanalyse, Generation Golf Adressaten: Literaturwissenschaft, Sprachwissenschaft, Soziologie, Kulturwissenschaft Das Buch im Spiegel der Medien »Man fragt sich, ob man es bei ›Generation Golf‹ nicht eigentlich mit einem Text zu tun hat, der so tiefgreifender Interpretationen gar nicht bedarf, da er selbst alles unverschlüsselt sagt, was zum Zeitgeist zu sagen wäre. Doch das ist eben die theoretische Volte dieser Arbeit: Der sich selbst bezeugende Zeitgeist wird als Symptom einer Geisteshaltung [...] gesehen, die nun ihrerseits die Kennzeichen und Merkmale der Generation aufscheinen lassen, der Illies zugehört.« Christian Schärf, FAZ, 20.10.2008 »Die Dissertation [...] ist eine materialreiche Studie, die an den Leser zwar hohe Ansprüche stellt, aber dafür umso gewinnbringender gelesen werden kann.« www.single-generation.de, 26.10.2008 Interview ... mit Dr. phil. Tom Karasek 1. »Bücher die die Welt nicht braucht«. Warum trifft das auf Ihr Buch nicht zu? Die Stärke des Textes liegt meines Erachtens in der Vielfalt der methodischen Zugänge, die auch noch an einem Text abgearbeitet werden, der möglicherweise unterhalb des Radars der Sprach- und Literaturwissenschaften geblieben wäre. 2. Welche neuen Perspektiven eröffnet Ihr Buch? Es ermöglicht einerseits, einen Zugriff auf populäre Texte zu gewinnen, die sonst in einer nach wie vor oft auf »Tiefe« schielenden Literaturwissenschaft außen vor bleiben – jene Texte, die im Schnittpunkt von Journalistik, Popkultur und Spontansoziologie liegen, feldintern kurz »aufflackern« und dann in der Versenkung verschwinden. Zudem bietet es einen für eigene Analysen nutzbaren Methodenrahmen, der die Theorie des literarischen Feldes mit einem diskurstheoretischen Ansatz verheiratet. 3. Welche Bedeutung kommt dem Thema in den aktuellen Forschungsdebatten zu? Es kann etwas zusätzliches Licht in die gerade wieder neu aufgewärmte »68er-Debatte« bringen, indem es aufzeigt, wie und warum die Ridikülisierungsformeln funktionieren, die gegen »die« 68er gerichtet werden, welche feldinternen Gewinne man damit erzielen kann und welche Diskursgemeinschaften auf die Überzeugungskraft der populistischen 68er-»Leichenfledderei« setzen. 4. Mit wem würden Sie Ihr Buch am liebsten diskutieren? Es läge nahe, mit dem Autor Florian Illies zu diskutieren. Dabei liefe ich zum einen Gefahr, dass sich jener (möglicherweise aufgrund der eigenen Selbstinszenierung willentlich) missverstanden fühlen würde, was einer echten Diskussion im Weg stünde. Zudem würde dieser Gesprächswunsch den Eindruck erwecken, die Subjektivität des Autors, der Autor als Person, sei für die Analyse besonders relevant. Also würde ich lieber mit Pierre Bourdieu über dessen Literaturbegriff diskutieren. 5. Ihr Buch in einem Satz: Es ist ein Versuch, Ordnung in einen Ausschnitt des populärliterarischen »Gemurmels« zu bringen. Inhaltsverzeichnis
Dankwort 7
Abkürzungen 9 Einleitung und Methodeninstrumentarium 11 Über die Schwierigkeit, populäre Literatur zu beschreiben, die das Alltägliche beschreibt 11 Entwicklung eines Werkzeugkastens: grobe und feine Werkzeuge 16 Vorbemerkung 16 In welcher Gesellschaft leben wir eigentlich? Oder: der neue (alte) Geist des Kapitalismus 18 Diskurse als soziale Praxis – Ideologie – Hegemonie 19 Texte als Ausdruck von Diskursen 22 Texte als Teilnahme am sprachlichen Markt 24 Texte als Produkt des Habitus und als Element des literarischen Feldes 26 Auf dem Weg zu einem Analyseraster 31 Ein multiperspektivischer Blick auf Generation Golf 34 Rekonstruktion historischer feldinterner Kämpfe und Effekte: Streifzüge durch die Geschichte der Populärliteratur 39 Mögliche Definitionen von Populärkultur 41 Ästhetik 42 Quantität 43 Pessimistische Kulturkritik und optimistische Affirmation 44 Subversion und Protest 47 Das Populäre und die Literatur: historische Rekonstruktion einer Transformation des literarisch „Sagbaren“ 51 Frühphase: ästhetischer Protest der Avantgarde 53 Spiel mit der Allodoxie 57 Kulturindustrielle Integration 58 Auf dem Weg nach 1968 59 Popliteratur nach 1968: der Sound der Berliner Republik 64 Theorie und Kritik der Populärliteratur: Verflachungs-, Sampling- und Archivthesen 72 Positionen und Positionierungen: Stellung und Stellungnahmen im literarischen Feld 85 Generation Golf im Zeichen feldinterner Strukturprinzipien 88 Autorhabitus und feldinterne Autorposition 88 Strukturprinzip externe Hierarchisierung: ökonomischer Erfolg, Verlagswahl, Ausstattung 98 Strukturprinzip interne Hierarchisierung: Generation Golf als konsekrierte Preisträger-Literatur 100 Das Aussagensystem Generation Golf 113 Eigene und fremde Stellungnahmen 113 Die Wahl des Realitätsbezugs aus dem Raum aller Realitätsbezüge: Sampling 138 Die Wahl des Gegenstandes aus dem Raum aller Gegenstände: die Generationendebatte 139 Die Wahl der Gattung aus dem Raum aller Gattungen: der essayistisch-autobiographische Genre-Mix 154 Die Wahl des Stils aus dem Raum aller Stile: glossenhafte Ironie 163 Der Sozialraum Generation Golf 179 Schritt 1: Typologie 180 Schritt 2: Kontextualisierung 189 Fazit: zwischen exklusiver Differenzbetonung und inklusivem Identitätsangebot 198 Transit 204 Generation Golf und der politische Korrektheitsdiskurs 207 Political Correctness: Skizze der Geburt eines Mythos und kommunikativen Jokers 208 Exkurs: Diskurskoalitionen 224 Exkurs: Zum Anteil des (flexiblen) Normalismus an Generation Golf 228 Das Konzept „Normalismus“ 228 Generation Golf als Dokument und Element flexibler Normalisierungsstrategien: Interdependenz von Gaußoiden 233 Schluss: die Fäden verbinden 259 Generation Golf im Schnittpunkt gesellschaftlicher Großerzählungen 259 Fazit 278 Literatur 285 Weitere Titel aus der Reihe Lettre |
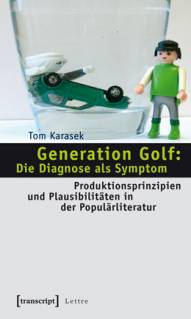
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen