|
|
|
Umschlagtext
Das bewährte Standardlehrbuch der Sprachtherapie mit Kindern nun in der 5. Auflage!
Die vielfältigen Sprachstörungen bei Kindern in den Bereichen Phonologie, Semantik, Grammatik, Sprechflüssigkeit und Schrift werden vor dem Hintergrund von Theorien der Sprache, des Spracherwerbs und der Kommunikation anschaulich beschrieben. Aus wissenschaftlichen Erkenntnissen werden Behandlungswege abgeleitet, die bewährte Methoden hilfreich ergänzen. Sprachtherapeutisches Handeln rückt dabei die Fähigkeiten und die Individualität des Kindes in den Mittelpunkt. Das Buch bietet Studierenden und Praktikern theoretisches Hintergrundwissen und gibt ihnen gleichzeitig Methoden und Anregungen für die Praxis an die Hand. Rezension
In diesem Buch sind alle wichtigen Sprachstörungen von Kindern beschrieben. Vor allem werden die Bereiche, in denen Sprachstörungen auftreten können, jeweils extra angeführt und detailliert beschrieben. Theoretische Hintergründe als auch Praxisbeispiele werden aufgezeigt. Ebenso werden Diagnostikverfahren vorgestellt. Zeitweise durch Bilder und Zeichnungen ergänzt, stellt dieses Buch ein guter Ratgeber für Therapeuten, Lehrer und Studenten dar.
B.Bühler, lehrerbibliothek.de Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Einleitung Phonologie Von Detlef Hacker 1. Phonologische Entwicklung 1.1 Perzeptionsentwicklung 1.2 Produktion 1.2.1 Prälinguistisches Stadium 1.2.2 Phonologie der ersten 50 Wörter 1.2.3 Erwerb des phonologischen Systems 1.2.4 Vervollkommnung des phonologischen Systems 2. Störungen im Erwerb 2.1 Verzögerungen bei der Überwindung phonologischer Prozesse 2.2 Ungewöhnliche phonologische Prozesse 2.3 Unausbalacierte Entwicklung 2.4 Lautpräferenz 2.5 Zur Begründung phonologischer Störungen 3. Erfassung und Beschreibung phonologischer Störungen 3.1 Erhebung einer Sprachstichprobe 3.2 Strukturbeschreibung kindlicher Äußerungen 3.3 Vergleich der Realisierungen mit den zugrunde gelegten Zielstrukturen: Beschreibung phonologischer Prozesse 3.4 Ergänzende Fragestellungen 4. Sprachtherapie mit phonologisch gestörten Kindern 4.1 Auswahl von Therapiezielen 4.2 Methodische Überlegungen 4.3 Überwindung phonologischer Prozesse: Einzelaspekte 4.4 Max auf dem Weg: Phonologische Erwerbsschritte Semantik Von Iris Füssenich 1. Erwerb von Bedeutungen 1.1 Unterstützungsrahmen für den Spracherwerb 1.2 Entwicklung von Referenzbezügen 1.3 Die Bedeutung der Objektpermanenz und die Entstehung erster Symbole 1.4 Erste sprachliche Äußerungen 1.5 Erweiterung des Lexikons 1.6 Zum Verhältnis von Sprachverstehen und Sprachproduktion 2. Störungen beim Erweb von Bedeutungen 2.1 Versuch einer Beschreibung von Bedeutungsproblemen 2.2 Methodische Schwierigkeiten bei der Erfassung von Bedeutungsproblemen 2.3 Diagnostische Leitfragen 2.4 Die Diagnose von Kindern in einigen Beispielen 3. Konsequenzen für die Therapie 3.1 Sprachtherapie als inszenierter Spracherwerb 3.2 Auswahl von Therapiezielen 3.3 Methodische Überlegungen 3.4 Paul auf dem Weg: Schritte beim semantischen Lernen Grammatik Von Friedrich M. Dannenbauer 1. Allgemeine Aspekte des Grammatikerwerbs 1.1 Eine deskriptive Skizze des frühen Grammatikerwerbs 2. Dysgrammatismus als Teilsymptomatik Spezifischer Sprachentwicklungsstörungen (SSES) 2.1 Überblick über die Symptomentwicklung 2.1.1 Der Beginn der Störung 2.1.2 Prädysgrammatisches Stadium 2.1.3 Dysgrammatisches Stadium 2.1.4 Postdysgrammatisches Stadium 2.1.5 Weitere Auffälligkeiten 2.2 Zur ursächlichen Erklärung grammatischer Beeinträchtigungen 2.2.1 Allgemeine Probleme der Ätiologie 2.2.2 Überblick über Befunde auf verschiedenen Funktionsebenen 2.2.3 Zur Möglichkeit einer Kausalattherapie 3. Die Therapie grammatischer Entwicklungsstörungen 3.1 Zur Logik der Entwicklungsproximalen Sprachtherapie 3.2 Sicherung der Therapiegrundlagen 3.2.1 Gestaltung der Beziehungsbasis 3.2.2 Etablierung von Interventionsstrukturen 3.2.3 Unspezifische Therapiearbeit 3.3 Durchführung der Sprachtherapie 3.3.1 Erfassung der sprachlichen Voraussetzungen 3.3.2 Allgemeine Aspekte der Planung 3.3.3 Bestimmung der Therapieziele 3.3.4 Vorstrukturierung der Situation 3.3.5 Modellieren der Zielstruktur 3.3.6 Überführung in die Sprachproduktion (dialogische Sicherung) 3.3.7 Metasprachliche Hilfen 3.4 Reflexion der Therapie 3.4.1 Kontrolle und Revision des Therapieverlaufs 3.4.2 Umgang mit der Therapiekonzeption 3.5 Nachwort zur Therapieintensität Sprechflüssigkeit Von Stephan Baumgartner 1. Flüssiges und unflüssiges Sprechen 1.1 Sprechen 1.2 Sprechflüssigkeit 1.3 Sprechunflüssigkeiten 1.4 Erwerb der Sprechflüssigkeit 1.4.1 Reifungsprozesse 1.4.2 Linguistische Prozesse 2. Kindliches Stottern als Störung der Sprechflüssigkeit 2.1 Kennzeichnung und konzeptionelle Einordnung 2.2 Ätiologie und die neurolinguistische Perspektive 2.3 Die Linguistische Dimension 2.4 Entwicklungsverläufe: Für und wider die Kontinuitätsannahme 2.5 Die psychologische Dimension 3. Kindliches Stottern: Beratung und Behandlung 3.1 Übergreifende Aspekte 3.1.1 Therapieziele 3.1.2 Problemanalyse 3.1.3 Indikation und spontane Remission 3.1.4 Sprachlernautonomie 3.1.5 Die Sprechflüssigkeit fördernden Interaktionen der Eltern 3.1.6 Zielsprache modellieren 3.2 Therapieziel: Kommunikative Sicherheit 3.2.1 Einführung 3.2.2 Kommunikative Grunderfahrungen 3.2.3 Stottern in der Sprechflüssigkeit fördernden Kommunikation 3.2.4 Strukturieren 3.3 Therapieziel: Stotterfreies Sprechen 3.3.1 Einführung 3.3.2 Das Sprechkonzept: langsam-weich-deutlich 3.3.3 Systematischer Aufbau neuer Sprechmuster 3.4 Therapieziel: Flüssiges Stottern 3.4.1 Einführung 3.4.2 Stottern und seine Bedingungen kennen lernen 3.4.3 Flüssiges Stottern lernen 3.5 Therapiemethoden und Erfolg Schriftsprache Von Claudia Crämer und Gabriele Schumann 1. Schriftspracherwerb als Entwicklungsprozess 1.1 Was Lehrende über Schriftsprache wissen müssen 1.1.1 Zum Zusammenhang zwischen gesprochener und geschriebener Sprache 1.1.2 Die Beziehung zwischen Laut- und Schriftstruktur 1.1.3 Die Bedeutung der gesprochenen Sprache für den Erwerb der Schriftsprache 1.1.4 Anforderungen beim Erwerb der Schriftsprache 1.2 Stufenmodell zum Schriftspracherwerb 1.2.1 Entwicklung des Schreibens 1.2.2 Entwicklung des Lesens 2. Lernschwierigkeiten beim Schriftspracherwerb 2.1 Erschwerende oder behinderte Faktoren beim Schriftspracherwerb 2.1.1 Hörbare Sprachstörungen 2.1.2 Nichthörbare Sprachstörungen 2.1.3 Verzögerte Lernentwicklung 2.1.4 Ungünstiges Problemlöseverhalten 2.1.5 Mangelnde Passung zwischen den Lernvoraussetzungen der Kinder und den schulischen Lernbedingungen 2.2 Diagnostisches Vorgehen 2.2.1 Fehler als Ausdruck von Lernentwicklung 2.2.2 Und Lernblockierung 2.2.3 Die Lernbeobachtung von Dehn 2.2.4 Analyse von Schreibproben 2.2.5 Analyse von Leseproben 3. Förderung bei Lese- und Schreibschwierigkeiten 3.1 Allgemeine Überlegungen 3.2 Grundsätze der Schriftsprachvermittlung 3.3 Förderbeispiele zu Problemschwerpunkten des Schriftspracherwerbs 3.3.1 Förderung bei hörbaren Sprachstörungen 3.3.2 Förderung bei nichthörbaren Sprachstörungen Literatur Sachverzeichnis |
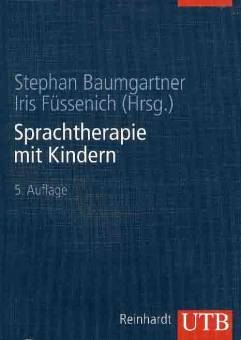
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen