|
|
|
Umschlagtext
Für viele Kinder ist der Übergang von der Grundschule in die weiterführende Schule ein einschneidendes Erlebnis in ihrem (Schul)Leben. Stellt der Schulübertritt im Sinne der Lebensereignisforschung ein kritisches Lebensereignis dar? Dies wird im theoretischen Teil des vorliegenden Bandes diskutiert. Im empirischen Teil werden die Ergebnisse einer Studie zum bevorstehenden Schulwechsel präsentiert. Hauptanliegen dieser Studie war es, die subjektive Bedeutung des bevorstehenden Wechsels zu erforschen. Den theoretischen Rahmen dafür bildete die kognitiv-transaktionale Streßtheorie von Lazarus. Schüler und Schülerinnen wurden gefragt, inwieweit sie Freude bzw. Bedauern über das Verlassen der Grundschule empfinden, sich Gedanken über die neue Schule machen und Herausforderung und Bedrohung diesbezüglich empfinden.
Ulrike Sirsch, Mag. Dr., Jahrgang 1964, Klinische Psychologin und Gesundheitspsychologin, Psychologiestudium in Wien, Abschluß mit Magisterium 1990, danach Mitarbeit in einem wissenschaftlichen Forschungsprojekt zur kindlichen Entwicklung mit dem Schwerpunkt "Risikokinder"; seit 1991 am Institut für Psychologie der Universität Wien im Bereich Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie tätig, Promotion 1996; Forschungsschwerpunkte: Schulwechsel, Selbstkonzept, Migration. Rezension
Schulwechsel, - insbesondere der Wechsel von der Grundschule zur weiterführenden Schule - , werden in ihrer lebensgeschichtlichen Bedeutung für Schülerbiographien bislang unzureichend wahrgenommen. Diese pädagogisch-psychologische Studie stellt sich der Problematik theoretisch (Teil 1) und empirisch (Teil 2: 800 Kinder aus 23 Wiener Volksschulen) und damit werden erstmals gesicherte Daten zum subjektiven Empfinden der problematischen Phase des Schulwechsels im Leben von Kindern und Jugendlichen erhoben. „Generell zeigte sich eine positive emotionale Haltung der Kinder zur weiterführenden Schule … Die Schüler betrachteten den Schulübertritt als höhere Herausforderung und geringe Bedrohung“ (S. 166). „Betrachtet man die Einflußfaktoren der Bedrohung, so ist ersichtlich, daß vor allem eine hoch ausgeprägte Leistungsangst, soziale Angst und ein niedriges Selbstkonzept eine negative Ereigniseinschätzung bewirken, während Schulklima-Aspekte auf diese keinen Einfluß zu haben scheinen“ (S. 172).
Jens Walter, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Pressestimmen Es ist erstaunlich, dass zum Thema des Schulübertritts bisher nur wenige Arbeiten aus dem deutschsprachigen Raum vorliegen. Dies gilt insbesondere deshalb, weil der Schulübertritt in den Ländern, in denen ab etwa dem 10. Lebensjahr die Schulklassen getrennt und in unterschiedlichen Leistungs- und Interessenlaufbahnen weitergeführt werden, eine ganz andere Bedeutung hat als etwa in den USA, in denen es eher die Regel ist, dass Schüler im Prinzip die gesamte Schullaufbahn bis zum College mit den gleichen Peers absolvieren können. Die hier vorgelegte Untersuchung ist damit ein bedeutender Beitrag, um diese auffallende Forschungslücke zu schließen. […] Die Qualität der vorgelegten Arbeit ist sehr hoch. Die Daten wurden sorgfältg erhoben, die statistischen Auswertungen sind durchwegs angemessen und korrekt. Die Interpretationen werden mit der gebotenen Vorsicht formuliert, die Schlussfolgerungen schießen nicht über das Ziel hinaus. Besonders interessant und erfreulich ist, dass die Autorin eine Reihe von Rohdatentabellen in den Text aufgenommen hat, speziell Häufigkeitstabellen […]. Diese Tabellen sind so interessant und komplex (z.B. Tabelle 81), dass ich sie bereits mehrfach im Unterricht als Beispieldatensätze verwendet habe. Die Studierenden fanden diese Daten ebenfalls sehr interessant. […] Insgesamt kann dieses Buch jedem empfohlen werden, der sich mit der Schule, dem Schulsystem, Problemen des Schulübertritts und den psychologischen Möglichkeiten der Beschreibung und Erklärung der dabei auftretenden Phänomene befasst. Dem Buch ist eine weite Verbreitung zu wünschen. Es stellt ein beeindruckendes Beispiel hochklassiger entwicklungspsychologischer und pädagogisch relevanter empirischer Forschung dar. Aus: Zeitschrift für Pädagogische Psychologie/German Journal of Educational Psychology, 16 (2), 2002, S. 129–131. Inhaltsverzeichnis
Einleitung und Überblick 13
1 Der Schulwechsel - ein kritisches Lebensereignis? 17 1.1 Der Schulwechsel und seine theoretische Einordnung 18 1.1.1 Kritische Lebensereignisse 19 1.1.1.1 Definition 20 1.1.1.2 Klassifikation 21 1.1.2 Entwicklungsaufgaben 23 1.1.3 Ökologische Übergänge 25 1.1.4 Zusammenfassung und Diskussion 27 1.2 Überblick über empirische Untersuchungsergebnisse zum Schulwechsel 28 1.2.1 Die subjektive Bedeutung des Schulwechsels 34 1.2.1.1 Einschätzung vor dem Schulwechsel 35 1.2.1.2 Einschätzung nach dem Schulwechsel 36 1.2.1.3 Einschätzung vor und nach dem Schulwechsel 39 1.2.1.4 Geschlechtsspezifische Unterschiede in der Einschätzung des Schulwechsels 43 1.2.1.5 Zusammenfassung und Diskussion 44 1.2.2 Schulnoten und Schulwechsel 44 1.2.2.1 Die Veränderung von Schulnoten 45 1.2.2.2 Geschlechtsspezifische Unterschiede in der Veränderung von Schulnoten 48 1.2.2.3 Die Veränderung von Schulnoten in verschiedenen Schultypen 48 1.2.2.4 Zusammenfassung und Diskussion 49 2 Die subjektive Bedeutung von Lebensereignissen 53 2.1 Ereignis- und Ressourceneinschätzung 55 2.1.1 Einschätzung eines Ereignisses als Herausforderung 56 2.1.2 Einschätzung eines Ereignisses als Bedrohung 56 2.1.3 Konfundierung von Einschätzungsprozessen 57 2.2 Determinanten der Ereigniseinschätzung 58 2.2.1 Personale Faktoren der Ereigniseinschätzung 58 2.2.2 Situative Faktoren der Ereigniseinschätzung 59 2.3 Zusammenfassung 62 3 Zielsetzung und Fragestellungen 63 3.1 Zielsetzung 63 3.2 Fragestellungen 65 4 Versuchsplan 70 4.1 Auswahl der Stichprobe 70 4.2 Beschreibung der Untersuchungsinstrumente 70 4.2.1 Erfassung sozialer Daten 72 4.2.2 Die subjektive Bedeutung des Schulwechsels 72 4.2.2.1 Emotionale Einstellung zum Verlassen der Volksschule 72 4.2.2.2 Emotionale Einstellung zu und kognitive Auseinandersetzung mit der neuen Schule ... 72 4.2.2.3 Herausforderung und Bedrohung 73 4.2.3 Selbstkonzeptaspekte 75 4.2.3.1 Selbstkonzeptskalen nach Harter 75 4.2.3.2 Selbstkonzept in Deutsch und Mathematik 78 4.2.4 Angstaspekte80 4.2.4.1 Leistungsangst 80 4.2.4.2 Soziale Angst 81 4.2.5 Schulklima-Aspekte 82 4.2.6 Soziales Netzwerk und soziale Unterstützung 85 4.2.7 Schulnoten 86 4.2.8 Inhaltliche Vorhersehbarkeit und Kontrollierbarkeit 87 5 Durchführung der Untersuchung 88 5.1 Vorstudien 88 5.2 Hauptuntersuchung 88 5.2.1 Organisation 89 5.2.2 Erhebung der Daten 89 6 Statistische Auswertung 91 7 Stichprobenbeschreibung 94 7.1 Geschlecht95 7.2 Alter 95 7.3 Zukünftiger Schultyp 96 7.4 Muttersprache 97 7.5 Zusammenfassung und Diskussion 99 8 Teststatistische Analyse der Meßinstrumente 101 8.1 Herausforderung und Bedrohung 101 8.2 Selbstkonzeptaspekte 105 8.2.1 Selbstkonzeptskalen nach Harter 105 8.2.2 Selbstkonzept in Deutsch und Mathematik 106 8.3 Angstaspekte109 8.4 Schulklima-Aspekte 112 8.5 Zusammenfassung und Diskussion 115 9 Die subjektive Bedeutung des Schulwechsels 118 9.1 Emotionale Einstellung und kognitive Auseinandersetzung 118 9.1.1 Emotionale Einstellung zum Verlassen der Volksschule 118 9.1.2 Emotionale Einstellung zur neuen Schule 121 9.1.3 Kognitive Auseinandersetzung mit der neuen Schule 121 9.1.4 Zusammenfassung 122 9.2 Zusammenhänge zwischen Einstellungen zur Schule und Herausforderung bzw. Bedrohung .... 123 9.3 Herausforderung und Bedrohung 125 9.3.1 Der Schulwechsel als Herausforderung im Leistungsbereich ... 125 9.3.2 Der Schulwechsel als Herausforderung im sozialen Bereich .... 127 9.3.3 Der Schulwechsel als Bedrohung im Leistungsbereich 129 9.3.4 Der Schulwechsel als Bedrohung im sozialen Bereich 131 9.3.5 Konfundierung von Herausforderung und Bedrohung 133 9.3.5.1 Herausforderung und Bedrohung im Leistungsbereich 133 9.3.5.2 Herausforderung und Bedrohung im sozialen Bereich 134 9.3.6 Einflußfaktoren von Herausforderung und Bedrohung 135 9.3.6.1 Herausforderung im Leistungsbereich 136 9.3.6.2 Herausforderung im sozialen Bereich 139 9.3.6.3 Bedrohung 142 9.3.7 Zusammenfassung 145 9.4 Erwartete schulische Leistungen in der weiterführenden Schule 147 9.4.1 Tatsächliche Schulleistung in der Volksschule und erwartete schulische Leistung in Deutsch 148 9.4.2 Tatsächliche Schulleistung in der Volksschule und erwartete schulische Leistung in Mathematik 152 9.4.3 Erklärungsfaktoren erwarteter Leistungen 156 9.4.3.1 Deutsch 157 9.4.3.2 Mathematik 157 9.4.4 Erwartete Verbesserung und Verschlechterung schulischer Leistungen 158 9.4.4.1 Deutsch 159 9.4.4.2 Mathematik 160 9.4.5 Zusammenfassung 163 10 Zusammenfassung uod Diskussion der Ergebnisse 164 10.1 Zusammenfassung 164 10.2 Diskussion 168 10.2.1 Ergebnisse in Relation zu Forschungsergebnissen zum Schulwechsel 168 10.2.2 Ergebnisse in Relation zu Erkenntnissen aus der Streßtheorie von Lazarus 170 10.3 Schlußfolgerungen 172 Literatur 174 Anhang 192 Anhang A 194 Anhang B 198 AnhangC 211 Anhang D 223 Weitere Titel aus der Reihe Pädagogische Psychologie und Entwicklungspsychologie |
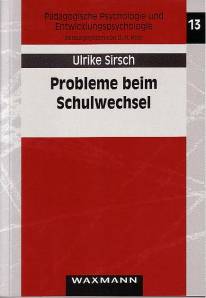
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen