|
|
|
Umschlagtext
Wer philosophiert, der argumentiert. Dabei hält sich das erstaunliche Vorurteil, daß beim philosophischen Argumentieren einfach nur die formale Logik auf die Themen der Philosophie anzuwenden sei. Aber mit Logikkenntnissen allein ist es nicht getan. Das spannende und aufregende Denkabenteuer philosophischen Argumentierens beginnt jenseits des bloß Formalen. Holm Tetens legt ein Buch vor, das in die Eigenheiten philosophischen Argumentierens ganz von den inhaltlichen Themen und Problemen der Philosophie her einführt. Dabei kommt die formale Logik durchaus zu ihrem Recht, indem zu Anfang ihre Prinzipien und die Technik ihrer Anwendung vorgestellt werden. Ansonsten ist das Buch aber so untechnisch geschrieben, daß man ihm auch ohne tiefere Logikkenntnisse gut folgen kann. Für jeden, der sich für die Philosophie interessiert, sei er Anfänger, Laie oder bereits gut mit ihr vertraut, hält dieses Buch eine Fülle an Informationen und provokanten Denkanregungen bereit.
Rezension
Das hier anzuzeigende Buch ist ein grundlegendes Methoden-Buch zur Philosophie; denn Philosophieren bedeutet ganz wesentlich Argumentieren. Natürlich kommen noch weitere Methodiken hinzu, z.B. das Analysieren und das Interpretieren, aber das Argumentieren darf doch mit Recht als die zentrale Methode der Philosophie gelten. Und in diese führt dieses Buch in vier Kapiteln strukturiert ein: 1. Grundsätze philosophischer Argumentation, 2. Argumentationsmuster und Schlussregeln, 3. Spezifische Argumentationsmuster der Philosophie und 4. Dialektische Argumentationsstrukturen in der Philosophie. Dabei wird deutlich, dass (formale) Logik zwar für alles Argumentieren grundlegend ist, für das philosophische Argumentieren aber allein nicht ausreicht; philosophisches Argumentieren ist mehr als die Anwendung formaler Logik auf die Philosophie.
Oliver Neumann, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Holm Tetens ist Professor für Theoretische Philosophie an der Freien Universität Berlin. Inhaltsverzeichnis
Vorwort 9
Teil 1: Der Grundsatz philosophischen Argumentierens 1. Was man im Lehnstuhl wissen kann 14 2. Die ewigen großen Fragen der Philosophie 16 3. Von der Welt zur Bezugnahme auf die Welt 17 Teil 2: Argumente, Schlussregeln, Argumentationsmuster 4. Der Aufbau eines Arguments 22 4.1 Ein erstes Beispiel für ein Argument 22 4.2 Die Schlüssigkeit von Argumenten 23 4.3 Vom Argument zur Form eines Arguments 25 4.4 Logisch gültige Schlussregeln 28 4.5 Annahmen um des Arguments willen 32 5. Zu Begriff und Funktion deskriptiver Argumente 34 5.1 Über Gründe und Argumente 34 5.2 Über die zwei wichtigsten Funktionen deskriptiver Argumente 36 6. Zur logischen Rekonstruktion von Argumenten 38 6.1 Ein Argument wird rekonstruiert 38 6.2 Fehlschlüsse und die Methode der Prämissenergänzung 41 6.3 Die formale Logik als Kontrastfolie 45 6.4 Deduktive und nicht-deduktive Argumente 47 7. Argumentationsmuster 51 7.1 Von der formalen Logik zur Topik 51 7.2 Descartes' «Cogito ergo sum» 55 8. Über die Darstellung von Argumenten 59 Teil 3: Argumentationsmuster der Philosophie 9. Transzendentale Argumente 68 9.1 «Bedingungen der Möglichkeit» der Bezugnahme 68 9.2 Topik und Urteilskraft 75 9.3 Fehlschlüsse im Kontext transzendentaler Argumente 76 9.4 «Bedingungen der Möglichkeit» des Argumentierens 78 10. Selbstanwendungsargumente 81 10.1 Selbstbezügliche Aussagen 81 10.2 Zwei weitere Beispiele für Selbstanwendungsargumente 86 10.3 Zur Problematik der Selbstanwendungsargumente 88 11. Modale Argumente 94 11.1 Modale Aussagen 95 11.2 Mögliche Welten 96 11.3 Bedingte Notwendigkeit 100 11.4 Die Notwendigkeit transzendentaler Aussagen 102 11.5 Zur Kritik des modalen Realismus 106 11.6 Mögliche-Welten-Argumente 110 12. Gedankenexperimente 116 12.1 Temperaturen sehen 117 12.2 Der Ablauf eines Gedankenexperiments 121 12.3 Gehirne im Tank 122 13. Das Argumentieren mit Rationalitätsannahmen 125 13.1 Intensionale Fehlschlüsse 126 13.2 Rationalität des Wissens 128 13.3 Kritik idealisierender epistemischer Prinzipien 134 13.4 Die Vagheit des Vernunftbegriffs 136 13.5 Zweckrationalität und praktischer Syllogismus 138 14. Argumentieren in der Ethik 139 14.1 Zur «Schlüssigkeit» normativer Argumente 140 14.2 Elementare Regeln des moralischen Argumentierens 144 14.3 Ein Beispiel für ein Argument aus der Ethik 147 14.4 Oberste moralische Prinzipien 151 14.5 Das Prinzip der Verallgemeinerung 153 14.6 Die Ethik des Argumentierens 161 14.7 Möglichkeiten und Grenzen moralischen Argumentierens 168 15. Analogieargumente 171 15.1 Die Uhrenanalogie von Leibniz 171 15.2 Strukturen, Analogien, Modelle 175 15.3 Humes teleologischer Gottesbeweis 178 15.4 Analogieargumente und die Suche nach der Einheit der Welt 180 15.5 Schlüsse auf die beste Erklärung als Analogieargumente 184 15.6 Metaphern in der Philosophie 188 16. Sprachkritische Argumente 195 16.1 «Sein ist offenbar kein reales Prädikat» 196 16.2 «Das Gespenst in der Maschine» 198 16.3 «Das Nichts nichtet» 203 16.4 Der «linguistic turn» 211 Teil 4: Dialektische Strukturen in der Philosophie 17. Argumente kritisieren Argumente 216 17.1 Einwände gegen ein Argument 217 17.2 Temperaturen fühlen und sehen 220 17.3 Das chinesische und das erleuchtete Zimmer 226 18. Widersprüche 232 18.1 Der Umgang mit Widersprüchen 232 18.2 Erklärung von Widersprüchen 234 18.3 Dialektik: Die Kontroverse als Modell der Wirklichkeit 238 18.4 «Reale Widersprüche» 243 19. Der Streit der Philosophen 248 19.1 Ein Panorama der Welt im Großen und Ganzen 249 19.2 Quines Maxime 257 19.3 Philosophiegeschichte als Ausloten logischer Spielräume 263 19.4 Empirisches Wissen und philosophische Argumente 270 19.5 Entdeckungen in der Philosophie 275 19.6 Eine Erklärung für den Streit der Philosophen 279 Teil 5: Anhang 20. Ein kurzer Einblick in die klassische formale Logik 282 20.1 Die drei Prinzipien der klassischen formalen Logik 282 20.2 Die extensionale Bedeutungsfestlegung der Junktoren 284 20.3 Aussagenlogische Gesetze 289 20.4 Singuläre und generelle Termini 290 20.5 Quantoren 292 20.6 Quantorenlogische Gesetze 295 20.7 Liste einiger fundamentaler logischer Gesetze 298 Literaturverzeichnis 300 (a) Zitierte oder erwähnte Texte 300 (b) Empfehlungen zur ergänzenden und vertiefenden Lektüre 303 Anmerkungen 304 Sachregister 309 Personenregister 311 Weitere Titel aus der Reihe beck'sche reihe |
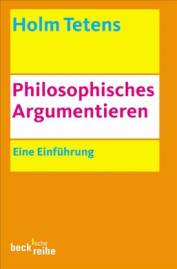
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen