|
|
|
Umschlagtext
Die Geschichte des mittelalterlichen Kreuzgangs beginnt im Rahmen der Anianischen Reform um 800. Als Wegarchitektur ist er zunächst nur das Erschließungssystem des klösterlichen Alltags. Dem Kreuzgang fiel jedoch als Herzstück der Klausuranlage innerhalb der abendländischen Klosterbaukunst eine Reihe von Sonderfunktionen zu, die sich in besonders dekorativen Formen äußerten.
Kein anderes Baumotiv der monastischen Architektur der Zeit von 800 bis 1600 steht deshalb so sehr für das Kloster als Ganzes wie dieses. Aus seiner existenziellen Notwendigkeit für das Kloster entstand ein Wunderwerk der mittelalterlichen Architektur. Rolf Legler studierte Malerei, Grafik und Bildhauerei in Nürnberg und München. Er ist einer der besten Kenner des Themas, da er sich bereits in seiner Dissertation mit dem „Kreuzgang“ auseinandersetzte. Neben weiteren Büchern zu diesem Thema befasste er sich auf intensiven Studienreisen mit der Kunst und Kultur des Mittelmeerraumes, des Vorderen Orients und Lateinamerikas. Er veröffentlichte mehrere Kunstreiseführer zu Italien und Frankreich sowie Beiträge zum Thema Klosterbaukunst in führenden Fachzeitschriften und Tageszeitungen. Rezension
Die Reihe der IMHOF-Kulturgeschichte bietet in einem ansprechenden Preis-Leistungs-Verhältnis überaus gelungene Bände auch zur kirchlich-mittelalterlichen Sakralkunst, die auch für den schulischen Unterricht von Interesse ist: in der Kunsterziehung, im Religionsunterricht oder bei Besichtigungen während Klassenfahrten; denn Klöster und Kathedralen stehen fast immer auf dem Programm und gehören zur kulturellen Grundbildung. Die Reihe umfasst allein drei Bände zu mittelalterlicher Skulptur, gotischen Kirchtürmen oder - wie hier anzuzeigend - zu mittelalterlichen Kreuzgängen. Kompakt verfasst, reich bebildert, mit zahlreichen Grundrissen, Skizzen und Illustrationen versehen bietet der Band einen anschaulichen Zugang zu den Orten im Kloster, die jeden Besucher in ihren Bann ziehen: die Kreuzgänge.
Dieter Bach, lehrerbibliothek.de Inhaltsverzeichnis
HYMNEN UND VERGESSEN 5
DER „KREUZGANG" - EIN WORT SORGT FÜR IRRUNGEN 8 Das deutsche Wort Kreuzgang 8 Claustrum, chiostro, claustro, cloister, cloftre 9 Claustrum: Kreuzgang oder Kloster? 10 Die semantische Verschiebung 12 Was ist ein Kreuzgang? 13 WERDEGANG DER ABENDLÄNDISCHEN KLOSTERBAUKUNST 15 Vorspiel am Nil (nach 300) 15 Wellenschlag zum Atlantik (bis 800) 19 Eine Explosion (Echo der Anianischen Reform) 23 Formative Epoche (von 800 bis 1000) 27 Der Klosterplan von St. Gallen 27 Zehn Charakteristika des benediktinischen Mönchtums 32 Beginn eines Siegeszuges ohnegleichen (Hohes und spätes Mittelalter) 36 DIE ARCHITEKTUR DES KREUZGANGS 39 Bauliche Voraussetzungen 39 Sonderformen 45 1. Unvollständige Kreuzgänge 46 2. Abweichungen im Grundriss 47 3. Falsche Kreuzgänge 49 Bestandteile 49 1. Die Bank 49 2. Bedachung und ihre formalen Konsequenzen 51 Grundformen 61 Echte Kreuzgänge 61 Typ a) Mediterraner Typ 62 Typ b) Der Polyforienkreuzgang 65 Typ c) Der holzgedeckte mehrgeschossige Kreuzgang 70 Typ d) Steingewölbter mehrgeschossiger Kreuzgang 75 Typ e) Gemischt gedeckter Kreuzgang 75 Der ,falsche' Kreuzgang 76 Mischformen 82 FUNKTIONSWERT 85 Vom mönchischen Pragmatismus 85 Ein Laser des Mönchslebens (Funktionswert des Kreuzgangs) 90 DER MÖNCH UND SEIN GEHÄUSE (Das Phänomen der Polyvalenzen) 99 LICHTBLICKE (Ein postantikes Hypätralsystem) 103 1. Die neue Mitte 103 2. Einzeltrakte bzw. Einzelräume 104 3. Das Klausurgeviert als Ganzes 105 4. Auf dem Weg zur Vollendung 108 IKONOGRAPHIE UND SYMBOLIK 130 1. Bäume ohne Wald 130 2. Die Pfingstgemeinde 131 3. Das Weg-Symbol 133 4. Das Schweigen der Ewigkeit 134 5. Reditus in paradisum 135 VERWIRKLICHUNG REIN MONASTISCHER ZIELE DURCH DIE ARCHITEKTUR IN VIER STUFEN (am Beispiel des St. Galler Plans) 138 Erste Stufe: funktionaler bzw. instrumentaler Wert 138 Zweite Stufe: Pädagogisch-didaktischer Wert 144 Dritte Stufe: Symbolischer Wert 147 Vierte Stufe: Absoluter Wert 148 ANHANG (Quellentexte in Auszügen) 150 ANMERKUNGEN (Literatur) 154 Weitere Titel aus der Reihe IMHOF - Kulturgeschichte |
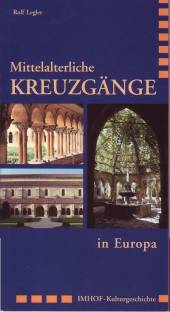
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen