|
|
|
Umschlagtext
Mittelalterliche Kreuzgänge in Europa
Die Geschichte des mittelalterlichen Kreuzgangs beginnt im Rahmen der Anianischen Reform um 800. Als Wegarchitektur ist er zunächst nur das Erschließungssystem des klösterlichen Alltags. Dem Kreuzgang fiel jedoch als Herzstück der Klausuranlage innerhalb der abendländischen Klosterbaukunst eine Reihe von Sonderfunktionen zu, die sich in seinen dekorativen Formen äußerten. Kein anderes Baumotiv der monastischen Architektur der Zeit von 800 bis 1600 steht deshalb so sehr für das Kloster als Ganzes wie dieses. Aus seiner existenziellen Notwendigkeit für das Kloster entstand ein Wunderwerk der mittelalterlichen Architektur. Rolf Legler studierte Malerei, Grafik und Bildhauerei in Nürnberg und München. Er ist einer der besten Kenner des Themas, da er sich bereits in seiner Dissertation mit dem "Kreuzgang" auseinandersetzte. Neben weiteren Büchern zu diesem Thema befasste er sich auf intensiven Studienreisen mit der Kunst und Kultur des Mittelmeerraums, des Vorderen Orients und Lateinamerikas. Er veröffentlichte mehrere Kunstreiseführer zu Italien und Frankreich sowie Beiträge zum Thema Klosterbaukunst in führenden Fachzeitschriften und Tageszeitungen. Mittelalterliche Skulptur in Deutschland, Österreich und der Schweiz Die Übersicht zur mittelalterlichen Skulptur im deutschsprachigen Raum stellt der Autor an ausgewählten Bildwerken vor. Die Untersuchung beginnt im frühen Mittelalter mit der Darstellung merowingischer Grabsteine. Mit der Hofschule Karls des Großen und den ottonischen Klosterwerkstätten erriechen die Elfenbeinschnitzerei und Goldschmiedekunst einen ersten Höhepunkt. Im 12. und 13. Jahrhundert erfährt die Bildhauerkunst an einigen Orten - insbesondere in Bamberg, Magdeburg, Naumburg und Straßburg - erneut eine Qualität von internationalem Rang. Der Überblick endet mit den bedeutenden Schnitzaltären der Spätgotik von tilman Riemenschneider, Veit Stoß und Michael Pacher. Uwe Geese ist Kunsthistoriker und promovierte über mittelalterliche Reliquienverehrung. Mit wissenschaftlichen Arbeiten zur Skulptur de Renaissance und des Barock spezialisierte er sich im Frankfurter Liebighaus auf diese Kunstgattung und publizierte seither zahlreiche Beiträge zur Geschichte der abendländischen Skulptur. Gotische Türme in Mitteleuropa Robert Bork (Universität Iowa/USA) analysiert Ursprung und Entwicklung der großen Kirchtürme der mitteleuropäischen Gotik, ihre Vorbilder in Nordfrankreich und ihre architektonische Blüte im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Dort entstanden die größten, höchsten und schönsten aller Türme des europäischen Mittelalters. Darüber hinaus wirft der Autor einen vergleichenden Blick auf England und die Rezeption der durchbrochenen Turmhelme der deutschen Gotik in Frankreich und Spanien. Im einführenden Kapitel stellt Pablo de la Riestra die breite Palette von Turmvarianten in den deutschsprachigen Ländern von der romanischen Rezeption bis zur Frührenaissance vor und bespricht die großartigsten, aber auch weniger bekannten Schöpfungen dieser Gattung. Rezension
Die Architektur des Mittelalters brachte führende Elemente hervor, die in Adaption bis in die heutige Zeit aufgegriffen und variiert werden. In speziellen Bänden widmet sich die Reihe IMHOF-Kulturgeschichte besonderen Baumerkmalen bedeutender Gebäudetypen. Verglichen werden mittelalterliche Kreuzgänge, Herzstück aller bedeutender Klöster, gotische Türme und mittelalterliche Skulpturen des deutschsprachigen Raumes. Sie geben Zeugnis von Philosophie, Denkart und Lebensweise im Mittelalter und eignen sich von daher als wichtige Quelle zur Erschließung zentraler Inhalte des Geschichtsunterrichts. Der Leser erhält umfassende Einführungen, Erklärungen und Vertiefungen. Neben der Architektur werden Funktion, Entwicklung und Veränderungen sowie Unterschiede in der Anlage der Bauwerke vorgestellt. Die informativen Texte, verfasst von renommierten Wissenschaftlern, werden durch zahlreiche ansprechende Fotografien veranschaulicht. Ein Glossar erklärt die zugrundeliegende Terminologie. Somit bildet das Paket eine wertvolle Grundlage für einen Basisapparat zur Geschichte des Mittelalters.
Georg Pfahler, lehrerbibliothek.de Inhaltsverzeichnis
Mittelalterliche Kreuzgänge in Europa
Hymnen und Vergessen Der "Kreuzgang" - Ein Wort sorgt für Irrungen Das deutsche Wort Kreuzgang Claustrum, chiostro, claustro, cloister, cloître Claustrum: Kreuzgang oder Kloster? Die semantische Verschiebung Was ist ein Kreuzgang? Werdegang der abendländischen Klosterbaukunst Vorpsiel am Nil (nach 300) Wellenschlag zum Atlantik (bis 800) Eine Explosion (Echo der Anianischen Reform) Formative Epoche (von 800 bis 1000) - Der Klosterplan von St. Gallen - Zehn Charakteristika des benediktinischen Mönchtums Beginn eines Siegeszugs ohnegleichen (Hohes und spätes Mittelalter) Die Architektur des Kreuzgangs Bauliche Voraussetzungen Sonderformen 1. Unvollständige Kreuzgänge 2. Abweichungen im Grundriss 3. Falsche Kreuzgänge Bestandteile 1. Die Bank 2. Bedachung und ihre formalen Konsequenzen Grundformen - Echte Kreuzgänge - Typ a) Mediterraner Typ - Typ b) Der Polyforienkreuzgang - Typ c) Der holzgedeckte mehrgschossige Kreuzgang - Typ d) Steingewölbter mehrgeschossiger Kreuzgang - Typ e) Gemischt gedeckter Kreuzgang - Der 'falshe' Kreuzang - Mischformen Funktionswert Vom mönchischen Pragmatismus Ein Laser des Mönchslebens (Funktionswert des Kreuzgangs) Der Mönch und sein Gehäuse (Das Phänomen der Polyzentren) Lichtblicke (Ein postantikes Hypätralsystem) 1. Die neue Mitte 2. Einzeltrakte bzw. Einzelräume 3. Das Klausurgeviert als Ganzes 4. Auf dem Weg zur Vollendung Ikonographie und Symbolik 1. Bäume ohne Wald 2. Die Pfingstgemeinde 3. Das Weg-Symbol 4. Das Schweigen der Ewigkeit 5. Reditus in paradisum Verwirklichung rein monastischer Ziele durch die Architektur in vier Stufen (am Beispiel des St. Galler Plans) Erste Stufe: funktionaler bzw. instrumentaler Wert Zweite Stufe: Pädagogisch-didaktischer Wert Dritte Stufe: Symbolischer Wert Vierte Stufe: Absoluter Wert Anhang (Quellentexte in Auszügen) Anmerkungen (Literatur) Mittelalterliche Skulptur in Deutschland, Österreich und der Schweiz Einführung Frühmittelalterliche Skulptur Vorromanische Skulptur Zeit der Karolinger - Reliefkunst aus Elfenbein Zeit der Ottonen - Ottonische Kruzifixi - Ottonische Madonnen - Bernward von Hildesheim und seine Kunst Reliquienkult und Goldschmiedekunst Romanische Skulptur Kruzifixi Lesepult Freudenstadt Taufbecken Das Sepulcrum Domini Grabmäler Kapitelle Portale Apsiden Die Skulpturen des Bamberger Doms Gotische Skulptur Südportal und Engelspfeiler des Straßburger Münsters Die Bamberger Domskulptur der jüngeren Werkstatt Magdeburg Naumburg Mainz und Meißen Triumphkreuzgruppen Bildwerke der Andacht und der religiösen Verehrung - Schutzmantelmadonnen - Vesperbilder - Christus-Johannes-Gruppen - Die "Schönen Madonnen" Die Bildkunst der Parler - Der Prager Porträtzyklus - Die Kölner Blattkonsole Niklaus Gerhaert v. Leyden Altarkunst der Spätgotik - Der Hochaltar des Michael Pacher in St. Wolfgang am Abersee - Der Hochaltar von Kefermarkt im Mühlviertel in Oberösterreich - Veit Stoß, Bildschnitzer zwischen Nürnberg und Krakau - Der Hochaltar von Michel und Gregor Erhart in Blaubeuren - Der Heilig-Blut-Altar des Tilman Riemenschneider in Rothenburg ob der Tauber - Der Breisacher Hochaltar des Meisters H.L. Körper und Gewand Gotische Grabmalskunst - Das Grabmal für Heinrich den Löwen und seine Gemahlin MAthilde - Das Grabmal für Erzbischof Siegfried III. von Eppstein - Das Grabmal für Landgraf Wilhelm II. von Hessen Anhang Glossar Literatur Register Gotische Türme in Mitteleuropa Einführung Anspruchsvolle Türme mit steinernen Spitzhelmen: Eine Definition Die Wurzeln der Symbolik hoher Türme Die ersten anspruchsvollen Helme Die Frühzeit der gotischen Turmhelme Formen und Verbreitung der frühen französischen und englischen Turmhelme Die Ruhe vor dem Sturm: Die schwierige Geschichte der anspruchsvollen Turmhelme in Frankreich im 13. Jahrhundert Neuerungen im Rheinland Straßburg vor 1350 Köln Freiburg im Breisgau Fürstliche Bauprojekte und die Öffentlichkeit im Osten des Reiches Prag Meißen Wien Bürgerliche Initiativen im Südwesten des Reiches Ulm Straßburg nach 1350 Kleinere durchbrochene Maßwerkhelme im Südwesten des Reiches Abweichende Strömungen im späteren Turmbau in Deutschland Strebewerk-Pyramiden Kuppeln und Kränze "Geglättete" und vereinfachte Turmabschlüsse Große Turmprojekte der Spätgotik in Brabant Antwerpen Mechelen Leuven Die internationale Rezeption der mitteleuropäischen Turmbauten Spanien Frankreich Das Ende und das Nachleben der steinernen helmtragenden Türme Bildnachweis Weitere Titel aus der Reihe IMHOF - Kulturgeschichte |
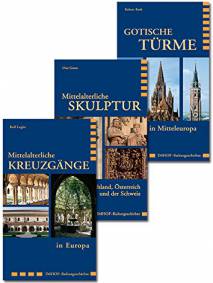
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen