|
|
|
Umschlagtext
„Meine deutsche Bildungsrepublik“ ist eine bildungspolitische Autobiographie. Ingo Richter schildert seine eigene Entwicklung und zugleich die Entwicklung der deutschen Bildungspolitik, zunächst als Jurastudent in der Nachkriegszeit, sodann als junger Bildungsreformer in den 1960er/70er Jahren am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin, als Professor für Öffentliches Recht in der Reform der Juristenausbildung in Hamburg und schließlich als Direktor des Deutschen Jugendinstituts in München und als Beobachter von PISA und den Folgen.
Rezension
Der Jurist Ingo Richter erzählt über seine Bildungserfahrungen. Im Jahre 1938 geboren, gehört er zu einer Generation, die den zweiten Weltkrieg als Kind noch erlebt hat, selbst aber größtenteils vom Bildungswesen der noch jungen Bundesrepublik geprägt wurde. Im ersten von drei Teilen berichtet Richter über seine Kindheit, Jugend und die Zeit des Studiums, um dann im zweiten Teil die Reformbemühungen des Bildungswesens der 1960er-80er Jahre zu erläutern. Im dritten Teil widmet er sich dem wiedervereinigten Deutschland und inbseondere dem sog. PISA-Schock der 2000er Jahre, schließlich auch den Umbrüchen, die durch die Corona-Pandemie im Jahr 2020 eingetreten sind.
Immer geht er vom persönlichen Erleben aus, das er in Beziehung zu den großen Systemumbrüchen setzt, die in jenen Jahren stattgefunden haben. Dabei merkt man, dass Richter als ehemaliger Leiter des Deutschen Jugendinstituts ein Bildungprofi ist und die Zusammenhänge des Bildungswesens in jahrzehntelanger Arbeit durchdacht hat. Die Erzählung ist sehr detailliert, mitunter vielleicht etwas anekdotenhaft. Nicht in allen Punkten wird man Richter zustimmen. So ruft die Vorstellung einer "Schule in einer pandemischen Gesellschaft", S.353-354, wie der Autor sie sich mit einer überwiegend digitalen Wissensvermittlung vorstellt, nach den Erfahrungen der Schulschließungen während der Corona-Pandemie, bei mir Aversionen hervor. Für die zeitgeschichtlich interessierte Leserschaft ist diese bildungsorientierte Autobiographie eine gute Lektüre! Johannes Groß, www.lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
„Meine deutsche Bildungsrepublik“ ist eine bildungspolitische Autobiographie. Ingo Richter schildert seine eigene Entwicklung und zugleich die Entwicklung der deutschen Bildungspolitik, zunächst als Jurastudent in der Nachkriegszeit, sodann als junger Bildungsreformer in den 1960er/70er Jahren am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin, als Professor für Öffentliches Recht in der Reform der Juristenausbildung in Hamburg und schließlich als Direktor des Deutschen Jugendinstituts in München und als Beobachter von PISA und den Folgen. Ingo Richter beschreibt eindrücklich, wie sich die Rolle der Wissenschaft nach 1989 gewandelt hat, indem er die Leserinnen und Leser durch seine „Bildungsrepublik“ führt: Im „Jahrzehnt der Bildungsreform“(1965-1975) wollten „wir als Wissenschaftler“ durch eine Reform des Bildungswesens einen „neuen Menschen“ schaffen, autonome Persönlichkeiten, die die autoritäre Gesellschaft der Vergangenheit überwinden und demokratisch eine „neue Gesellschaft“ begründen, in der der Grundsatz der Chancengleichheit herrscht. Nach dem Scheitern des Realsozialismus entstand eine „neue Welt“, und die Rolle der Wissenschaften beschränkte sich – im Zuge der Globalisierung nach 1989 – darauf, diese „neue Welt“ zu beschreiben und zu verstehen, z.B. durch Surveys und Leistungsmessungen. Für die Schule der Gegenwart sieht der Ingo Richter – jenseits von Surveys und Leistungsmessungen – sechs Herausforderungen. Drei von ihnen kann und muss die Schule bewältigen: 1. die Inklusion behinderter Kinder und Jugendlicher, 2. die Integration von Migrant*innen und 3. die Gefahr eines Missbrauchs des geschützten Raumes „Schule“. Drei Herausforderungen überfordern die Schule dagegen: 1. die Digitalisierung der Kommunikation und die mediale Sozialisation, 2. die „neue Unordnung des gesellschaftlichen Verhaltens“ (Anomie) und eine zunehmende radikale Kritik des Gesellschaftssystems und 3. die politische Bildung in einer Demokratie, mit der sich viele Menschen nicht mehr identifizieren. Inhaltsverzeichnis
Vorwort 11
Teil I. Ein hoffnungsvoller deutscher Jüngling − Aufwachsen und Studieren 1945−1963 Einleitung: Deutschland 1945 13 1 Aufwachsen 16 1.1 Eine preußisch-sozialdemokratische Volksschullehrerfamilie 16 1.1.1 „Auf der Lüneburger Heide ...“ – Über familiäre Milieus 16 1.1.2 „Üb immer Treu und Redlichkeit!“ – Über Weltanschauungen und Tugenden 28 1.2 Ein niedersächsisches kleinstädtisches Gymnasium 39 1.2.1 „Curriculum, Curriculum macht die kleinen Kinder dumm“ – Über die Schule 39 1.2.2 „Was bildet den Menschen?“ – „Alles!“ – Über Bildung 53 2 Studieren 71 2.1 Alma Mater Studiorum 71 2.1.1 „Ius est ars aequi et boni“ – Über mein Jurastudium 71 2.1.2 Die gute alte deutsche Universität – Über die Universität als solche 80 2.1.3 „Gaudeamus igitur – iuvenes dum sumus“ – Über studentische Milieus 89 2.1.4 „Politisches Interesse groß – politische Beteiligung klein“ – Über politische Enthaltsamkeit 100 2.2 Die Lust zum Gesetz – Über das Erlernen des juristischen Handwerks 107 2.2.1 Das Leben als Klausurfall 109 2.2.2 Juristische Geschichten, die das Leben schrieb 114 2.2.3 Von der gesellschaftlichen Relevanz der Dogmatik 118 5 Teil II. Zwei Schritte vor, einen Schritt zurück – Reformpolitiken 1963–1989 Einleitung: West-Berlin 1965 124 1 „Mit uns zieht die Neue Zeit!“ – Bildungsreformen durch Wissenschaft 129 1.1 „Ja, mach nur einen Plan, sei nur ein großes Licht!“ – Wissenschaft und Politik 130 1.1.1 Der Deutsche Ausschuss für das Erziehungs- und Bildungswesen (1963–1965) 130 1.1.2 Das Max-Planck-Institut für Bildungsforschung (1965–1979) 137 1.1.3 Der Deutsche Bildungsrat I (1965–1970) 144 1.1.4 Die Regierung Brandt-Scheel (1969) 146 1.1.5 Die Projektgruppe Curriculumentwicklung (1971–1972) 149 1.1.6 Der Deutsche Bildungsrat II (1970–1975) 152 1.2 „Alles, was Recht ist“ – Bildungsrecht und Bildungsverwaltung 156 1.2.1 Bildungsverfassungsrecht 156 1.2.2 Der Deutsche Juristentag 1976 160 1.2.3 Schulaufsicht und Schule 162 1.3 „Unter den Talaren Muff von tausend Jahren“ – Über den akademischen Aktivismus 166 1.3.1 Referendar bei Horst Mahler 167 1.3.2 Der 2. Juni 1967 169 1.3.3 Das Institut für Bildungsforschung und die Studentenbewegung 171 1.3.4 Die Juristische Fakultät und die Studentenbewegung 173 1.3.5 Die Bewegung der Studentenbewegung 174 1.3.6 „Ja, was wollt Ihr denn nun eigentlich?“ 176 1.3.7 Eintritt in die SPD 180 Exkurs: Das Referendariat und das Zweite Staatsexamen 183 2 „Stadt Hamburg an der Elbe Auen, wie bist du stattlich anzuschauen!“ – Die Reform der Juristenausbildung 188 2.1 „Vorspiel auf dem Theater“ – Am Fachbereich Rechtswissenschaft der Freien Universität Berlin 189 2.2 „Es braust ein Ruf wie Donnerhall“ – Der Ruf an die Universität Hamburg 193 6 2.3 „Reformen am offenen Herzen“ 197 2.4 „Publish or perish!“ 211 2.5 Ein kleiner Ausflug in die Politik 215 2.6 Hamburg, das Tor zur Welt 217 Teil III. Jugend- und Bildungspolitik in Zeiten der Wiedervereinigung und der Globalisierung (1989–2019) Einleitung: Deutschland 1989 230 1 „Nach Ostland wollen wir reiten“ – Bildungspolitische Spaziergänge im Osten nach 1989 239 1.1 Berlin-(Ost) – Baurecht 241 1.2 Mecklenburg-Vorpommern – West-Recht 243 1.3 Brandenburg – Lebensgestaltung, Ethik, Religionskunde (LER) 244 1.4 Sachsen – Im Zisterzienserinnen-Kloster 246 1.5 Thüringen – Eine Wiederbelebung des „Mythos Wickersdorf“? 248 1.6 Sachsen-Anhalt – Die Francke’schen Stiftungen in Halle 250 2 „Join the Navy and See the World!“ – The European Educational Law and Policy Association (ELA) 253 3 Die angewandte Aufklärung – Zehn Jahre Deutsches Jugendinstitut (1993–2003) 256 3.1 „Wir sind doch alle drei Juristen; wir werden uns schon verstehen“ 256 3.2 Das Deutsche Jugendinstitut – Die Einsamkeit der Macht 262 3.2.1 Leitung 262 3.2.2 Insignien der Macht 263 3.2.3 Zeichen der Kollegialität 264 3.2.4 Vertrauen 265 3.2.5 Gremien 266 3.3 Forschung am Deutschen Jugendinstitut – Big is not necessarily beautiful 268 3.3.1 Relevanz 269 3.3.2 Wissenschaftliche Begleitung 271 3.3.3 Reformen 272 3.3.4 Dauerbeobachtung 274 7 3.3.5 Surveys 275 3.4 Wissenschaft und Politik – Ein Geschäft auf Gegenseitigkeit 276 3.4.1 Transparenz und Vertrauen – Nur keinen Ärger in der Öffentlichkeit 276 3.4.2 Wissen als Voraussetzung der politischen Steuerung 279 3.4.3 Politikberatung – eine Alibifunktion? 281 3.4.4 Politische Konsensbildung 283 3.5 Wissenschaftliche Kooperation mit Universitäten – Privilegierte Partnerschaften? 284 3.6 Reden und Schreiben 289 3.6.1 Die Repräsentation des Deutschen Jugendinstituts in der Öffentlichkeit 289 3.6.2 Rekonstruktionsversuche von Bildungsrecht und Bildungspolitik 293 3.6.3 „Nachrufe“ zu Lebzeiten 295 4 Zivilgesellschaftliche Institutionen 298 4.1 Der Wissenschaftliche Beirat für Familienfragen 298 4.2 Die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung 300 4.3 Die Stiftung Brandenburger Tor 301 4.4 Die Freudenbergstiftung 303 4.5 Schulen und Universitäten als zivilgesellschaftliche Institutionen? 304 5 Der „PISA-Schock“ – „Außer Spesen nichts gewesen“? 306 5.1 „PISA“ als bildungspolitisches Ereignis 306 5.1.1 Der „Schock“ im Jahre 2001 306 5.1.2 Die Folgen des „PISA-Schocks“ 308 5.2 „PISA“ als juristisches Problem 311 5.3 „Nachpisanische“ bildungspolitische Spaziergänge 314 5.3.1 „Der Mantel der Geschichte weht“ – Der sächsische Beraterkreis 315 5.3.2 Spargel in Schwetzingen – Der baden-württembergische Bildungsrat 318 5.3.3 „Das ist die Berliner Luft, Luft, Luft.“ – Das Board des Modellvorhabens eigenverantwortliche Schule 321 5.3.4 „Wenn das Wasser im Rhein gold’ner Wein wär’“ – Die Enquetekommission „Chancen für Kinder“ in Nordrhein-Westfalen 326 8 6 Nachtrag: Jenseits von PISA 333 6.1 Gesellschaftliche Probleme, zu deren Lösung die Schule beitragen kann 334 6.1.1 Die Inklusion behinderter Menschen 334 6.1.2 Die Integration von Einwanderern und Flüchtlingen 338 6.1.2.1 Die Einwanderer 340 6.1.2.2 Die Flüchtlinge 344 6.1.3 Die Schule in Zeiten von Pandemien 346 6.1.3.1 Corona 2020 346 6.1.3.2 Die pandemische Gesellschaft – eine Utopie? 348 6.1.3.3 Das „Prinzip Schule“ als Problem einer pandemischen Gesellschaft 349 6.1.3.4 Die Entschulung in der pandemischen Gesellschaft 350 6.1.3.5 Die Notwendigkeit institutionalisierter Lernorte 352 6.1.3.6 Schule in einer pandemischen Gesellschaft 353 6.2 Gesellschaftliche Probleme, deren Lösung die Schule überfordert 354 6.2.1 Die Digitalisierung der Kommunikation und die mediale Sozialisation 355 6.2.2 Die Bedrohung des gesellschaftlichen Zusammenhalts durch Radikalität und Anomie 362 6.2.3 Die Bedrohung des politischen Systems durch Identifikationsverluste 367 |
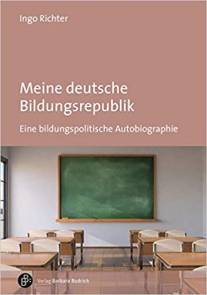
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen