|
|
|
Umschlagtext
Dass sich Menschen beim Lernen verändern und dass sie dabei sowohl Fehler machen als auch Irrtümer begehen, ist eine Selbstverständlichkeit. Darin enthalten ist aber die Tatsache, dass dieses Falsche einen entscheidenden Beitrag sowohl für die Nachhaltigkeit als auch die Sicherheit des Wissens darstellt. Durch das Falsche zum Richtigen kommen ist aber oft ein mühsamer und emotional diffiziler Weg.
Der Band ist sowohl für Praktiker gedacht (Fehlerkultur in der Schule), er ist aber auch pädagogisch-psychologisch interessant (Aufbau von negativem Wissen). Besondere Aspekte sind die emotionale Reaktion auf Fehler, die Wirkung von Beschämung auf den weiteren Lernprozess und Biografien von Personen, die über Lernprozesse berichten, die in der Tat oft sehr schmerzvoll waren. Rezension
Fehlerkultur und sog. Negatives Wissen haben in der pädagogischen Debatte z.Zt. einige Konjunktur. Dass das Negative auch Positives freisetzen kann, das schien lange Zeit in Vergessenheit geraten. Jetzt wird es wiederentdeckt. Negative Fehlererfahrungen bilden u.a. ein Schutzwissen aus, eine Art geistiges Immunsystem; man muss nicht alles Böse oder Negative nochmals tun; der Volksmund sagt: aus Fehlern lernen ... Dieser informative Band bereitet das gesamte Feld der Fehlerkultur auf: von den Funktionen Negativen Wissens bis hin zu einer angemessenen Fehlerkultur in Erziehung und Unterricht, von der durch Fehler oder Verfehlungen entstehenden Scham bis hin zu Lernen aus Fehlern im Lebenslauf: If we would learn from mistakes, we would be the brightest person."
Oliver Neumann, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Dr.Fritz Oser, ist Professor für Pädagogik und Pädagogische Psychologie an der Universität Fribourg/Schweiz. Dr. Maria Spychiger, Oberassistentin am Department Erziehungswissenschaften der Universität Fribourg/Schweiz. Aus Fehlern und Irrtümern lernen ist für niemanden angenehm, aber es führt dazu, dass Menschen eine Sache nachher besser verstehen, etwas Falsches nicht mehr tun, eine erfahrene Ungerechtigkeit nicht zulassen. Das Buch handelt von diesem so genannten "negativen" Wissen und wie es in Schule und Familie (Fehlerkultur) genutzt werden kann. Dass sich Menschen beim Lernen verändern und dass sie dabei sowohl Fehler machen als auch Irrtümer begehen, ist eine Selbstverständlichkeit. Darin enthalten ist aber die Tatsache, dass dieses Falsche einen entscheidenden Beitrag sowohl für die Nachhaltigkeit als auch die Sicherheit des Wissens darstellt. Durch das Falsche zum Richtigen kommen ist aber oft ein mühsamer und emotional diffiziler Weg. Der Band ist sowohl für Praktiker gedacht (Fehlerkultur in der Schule), er ist aber auch pädagogisch-psychologisch interessant (Aufbau von negativem Wissen). Besondere Aspekte sind die emotionale Reaktion auf Fehler, die Wirkung von Beschämung auf den weiteren Lernprozess und Biografien von Personen, die über Lernprozesse berichten, die in der Tat oft sehr schmerzvoll waren. Es werden auch Reaktionen auf Fehler wie etwas Beschämung oder Selbstärger diskutiert. Fehlerbiografien und Fragen erlebter Ungerechtigkeit und ihre Wirkung für die Herausbildung der moralischen Person sind weitere wichtige Teilaspekte. Presse-/Leserstimmen "... nicht nur lehrreich, sondern interessant und unterhaltsam." Schulmagazin 5 bis 10 Inhaltsverzeichnis
Einleitung: Zur Genese eines Unbehagens 11
Wissen, was eine Sache nicht ist 11 Damit das Richtige in der Welt seinen Platz erhält 12 Warum wir aus Fehlern nicht lernen wollen 14 Zur Entwicklung des hier vorgestellten Projektes 16 Lernen ist »schmerzhaft«, am Ziel aber führt es zu Stolz und Zuversicht 17 Vom Positiven des Negativen 18 Zum Aufbau des Buches 19 Teil I Das Konstrukt des Negativen Wissens und seine Funktionen 25 Kapitel 1 »Negatives Wissen – ein notwendiges Konstrukt zur Kennzeichnung unseres Denkens« 26 1.1 Grundlagen: Die Spiegelseite der Dinge 26 1.2 Hierarchien des Negativen 28 1.3 Wissenstheorie und Negatives Wissen 30 1.4 Funktionen des Negativen Wissens 31 1.5 Unterscheidungen in der Begrifflichkeit 35 1.6 Von der Einschränkung durch Entwicklungsgrößen: Grenzen des Fehlerwissens 39 Kapitel 2 Vom Aufbau eines geistigen Immunsystems: Schutzwissen als Resultat negativer Fehlererfahrungen 42 2.1 Zwei Prozesse für eine Sache 42 2.2 Praxisbeispiele 43 2.3 Ein Schema des Nicht-tun-Dürfens 44 2.4 Wie viele Fehler braucht der Mensch? Eine Art »verwundete« Rekonstruktion, und Risikofeindlichkeit 45 2.5 Verstehen und nicht erzwingen 46 2.6 Erwartung, Norm und Verstehen 48 2.7 Alte Meister 49 Kapitel 3 Geschichte und Geschichten: Wenn Falsches nicht reversibel ist, oder: advokatorisches Negatives Wissen 50 3.1 Zur »Logik des Misslingens« 50 3.2 Man muss nicht alles Böse nochmals tun 51 3.3 Von Generation zu Generation 52 3.4 Märchen als Prototypen für den Aufbau Negativen Wissens 53 3.5 Erste didaktische und erzieherische Empfehlungen 57 Kapitel 4 Das Konzept der Gewissheit 59 4.1 Vom Geheimnis der Negation getrieben: Gewissheit 1 59 4.2 Gewissheit 2: Was aus dem Negativen entsteht 60 4.3 »Conceptual Change« und Gewissheit 62 4.4 Nochmals Gewissheit 1 und Gewissheit 2 63 4.5 Vom Reiz des Falschen (oder über die Reversibilität fälschlicher Falschheiten) 64 4.6 Wenn Negatives als schockiernde Warnung dient 65 4.7 Geistige Voyeure 67 Teil II Emotionale und moralische Aspekte des Lernens aus Fehlern 71 Kapitel 5 Negatives Wissen und Emotionalität 72 5.1 Positive (produktive) »Beschämer« – negative (unproduktive) »Beschämer« 72 5.2 Scham und andere negative Emotionen als Determinanten für Negatives Wissen 76 5.3 Non-verbales hinderndes und förderndes Verhalten als Ausdruck emotionaler Befindlichkeiten: Die Studie von Büeler 81 5.4 Wann »es greift«: Emotionen, die Verbesserung und Umkehr bewirken 88 Kapitel 6 Negatives Wissen und Moral 93 6.1 Erinnerungen an das Böse 93 6.2 »Notwendige« Erfahrungen des Bösen 95 6.3 Entrüstung als moralischer Motor 96 6.4 Moralische Gefühle und negatives moralisches Wissen 97 Inhaltsverzeichnis 7 6.5 Erzieherische Gegebenheiten 98 6.6 Opfer und Täter 100 6.7 »Wir müssen nicht alles Böse nochmals tun« 100 6.8 Studie 1: Die Quellen der Moral 102 6.9 Studie 2: Schuld und negatives moralisches Wissen 103 6.10 Wertrationalität und Zweckrationalität 109 Teil III Fehlerkultur in Erziehung und Unterricht 111 Kapitel 7 Erziehung zu einer Fehlerkultur: eine pädagogische Illusion? Grundlagen und Planung einer Interventionsstudie 112 7.1 Lernen als Überwindung eines Defizits 112 7.2 Falsche Interventionen 113 7.3 Das Drama der Fehlerakzeptanz 116 7.4 Korrektur als Zerstörung des Falschen, oder: Wider die Sucht des Ausmerzens 120 7.5 Ein Algorithmus zur Entwicklung von Fehlerkultur 124 Kapitel 8 Fallstudien zur Entwicklung von Fehlerkultur in der Schule 133 8.1 Anlage und Inhalte der Intervention 133 8.2 Ergebnisse und Aussagen von Lehrpersonen 142 8.3 Bemerkungen über Veränderungen bei Interventionen: Relevanz, Messung und Sensibilisierung 158 Kapitel 9 Fehlerkultur aus dem Blickwinkel von Fehlersituationen im Unterricht 161 9.1 Adressatenwechsel und Bermuda-Dreieck: Lehrpersonen »überspringen« Schüler, die Fehler machen 161 9.2 Vermeidungsdidaktik vs. Fehlerermutigungs- und Fehleraufsuchdidaktik 164 9.3 Grunddimensionen und Leitsätze des guten Umgangs mit Fehlern im Unterricht 168 9.4 Nonverbale Kommunikation in der Fehlersituation 171 Kapitel 10 Das Messen von Fehlerkultur. Ansätze und Ergebnisse 174 10.1 Beobachten: Ergebnisse von Videoanalysen 174 10.2 Befragen: Entwicklung und Ergebnisse des Schülerfragebogens zum Umgang mit Fehlern in der Schule 181 10.3 Intervenieren: Kommentare zu den Messungen in den Fallstudien 192 10.4 Abschließende Kommentare 194 Kapitel 11 Wenn Fehler machen unser schulisches Selbst zerstört, oder: »If we would learn from mistakes, we would be the brightest person« (Charly Brown) 195 11.1 »Französisch war meine schwache Seite« 195 11.2 Falsche Attributionen 197 11.3 Attribution-Re-Training 199 11.4 Lernen von anderen: Fehler als Öffentlichkeitsprinzip 200 11.5 Ein untergehendes Reich: Das Ende der Geschichte des Gehorsams (Exkurs) 201 Teil IV Biografien und Fehler oder Negatives Wissen als Narben des Lebens 203 Kapitel 12 Lernen aus Fehlern im Lebenslauf 204 12.1 Menschen erzählen aus ihrem Berufsleben 204 12.2 Berichte aus biografischen Interviews 207 12.3 Literarische Beispiele aus Autobiografien 211 12.4 Entwicklungs- und lerngeschichtliche Relevanz des Fehlermachens 215 Kapitel 13 Negative Identität: Narben des Lebens als persönlicher Reichtum 217 13.1 Fehlentscheidungen als Teil des Lebensweges 217 13.2 Vom Zwang zur Fehlerfreiheit 219 13.3 Berufliche negative Identität 221 13.4 Berufliche negative Identität und autobiografisches Gedächtnis: Verläufe und Transformationen 223 13.5 Das negative Selbst und seine Welten 225 13.6 Zur Entwicklung der Negativität als Narbe des Seins 226 Teil V Zur Stabilität und Potenzialität von Lernen und Nichtlernen aus Fehlern. Ein Ausblick 229 Kapitel 14 Nochmals zur Logik des Kontrafaktischen 230 14.1 Zehn Formen einer Fehlernorm 230 14.2 »If I had sneezed, I wouldn’t be around here« 231 14.3 Nochmals Beispiele zu den Logiken des Falschen 232 14.4 Das »Falsche-Hoffnung«-Syndrom 235 14.5 Mechanik und Pragmatik 236 Kapitel 15 Ausblicke: Offene Fragen, offene Antworten 237 15.1 Warum lernen Menschen aus Fehlern nicht? 237 15.2 Fehler als Kreativitäts-Ampeln: Innovationspotenziale und Negatives Wissen 240 Literaturverzeichnis 245 Leseprobe: Einleitung: Zur Genese eines Unbehagens Wissen, was eine Sache nicht ist Die Menschen lernen es nie; sie können nie akzeptieren, dass man intelligente Fehler machen kann, die einem im Leben wirklich weiterhelfen. Vielleicht ist das gut so. Denn wenn sie es akzeptieren könnten, würden sie vermutlich den Widerstand dagegen aufgeben, Fehler zu machen. Dieser Widerstand aber ist notwendig, damit ein Lernprozess eingeleitet wird und aus dem Falschen gelernt werden kann. Und auch der innere Ärger über die eigene Unzulänglichkeit ist notwendig, denn der Umgang mit dem Falschen würde ansonsten einer lust- und leidenschaftslosen Toleranz ihm gegenüber weichen. Das, was gewusst wird, dass es nicht so ist oder nicht so funktioniert, würde durch ein abgeflachtes Verständnis dessen ersetzt, was den Widerstreit mit den Normen des Richtigen entmündigt (so wie oft ältere Menschen die Untaten ihrer Enkelkinder lustlos erdulden). Hingegen könnten wir uns vorstellen, dass Professionelle (Lehrpersonen, Betriebsausbildende, Erwachsenenbildner und -bildnerinnen), welche Lehr-Lern-Situationen arrangieren, dieser Abflachung und Leidenschaftslosigkeit Widerstand entgegenbringen. Sie hätten einerseits ein gestärktes Verhältnis zur Notwendigkeit des zu Vermeidenden, andererseits würden sie gerade deshalb das Lernen aus dem Falschen vergegenwärtigen. Und sie wüssten um seine strukturelle Geladenheit, die mitunter zu verzweifelten, überbordenden oder traurig machenden Leistungen führt: Wir sprechen vom »Negativen Wissen«. Unter Negativem Wissen verstehen wir jene Aspekte des Erkennens, die eine bisher erworbene kognitive Struktur ins Wanken bringen oder ihr aber eine unerschütterbare Sicherheit geben. Wenn Negatives Wissen das Gegenteil von dem ist, was eine Sache konstituiert, dann muss die Erkenntnis von jedem Begriff und jedem Konzept, die im Lernprozess erworben werden, genau dieses Negative Wissen als Konstituente mit einbeziehen. Man muss immer wissen, was eine Sache nicht ist, um zu wissen, was sie ist; man muss immer wissen, warum eine Sache nicht funktioniert, damit man weiß, wie sie funktioniert. Und Fehler sind das beste Mittel, um Negatives Wissen aufzubauen, weil ihre Bewusstwerdung immer gleichzeitig ein Bedürfnis oder einen normativen Ruf nach dem Richtigen impliziert. Weder die Lernpsychologie als Wissenschaft des Verstehens von Erwerbsprozessen (in ihrer klassischen oder ihrer konstruktivistischen Variante), noch die schulische, lehrmeisterliche und/oder universitäre Praxis haben diesen Aspekt des Erkennens und Lernens systematisch bearbeitet. Wir wissen noch nicht, wie viel Gegenbildliches wir wissen sollen, damit wir richtig wissen. Und wir wissen noch nicht, 12 Einleitung: Zur Genese des Unbehagens wie viel von einem Konstrukt man als sein Gegenteil oder als nicht zutreffend erfahren muss, bis es substanziell zufrieden stellend erkannt werden kann. In diesem Sinne könnte die Theorie des Negativen Wissens in der Tat ein so genanntes »starkes Programm« werden, dies jedenfalls im Sinne eines Unverzichtbarkeitspostulats. Auch wenn man unter Wissen versteht »what ever people take to be knowledge. It consists of those beliefs which people confidently hold to and live by« (Bloom 1976), wenn man also den subjektiven Aspekt des Wissens betont, ist es von Bedeutung, wie das Nicht-Ist, Nicht-Sein-Soll, Nicht-Funktionieren individuell konstruiert worden ist und neu rekonstruiert wird. Menschen haben Sicherheiten in ihrem Wissen, weil sie erfahren, erdacht oder rezipiert haben, wo dieses nicht zutrifft und wo eine Anti- Gestalt ihm gleichsam den Stempel aufdrückt. (Übrigens ist die Herkunft des Begriffs »Negatives Wissen« nicht klar. Wir kennen Begriffe wie Negative Anthropologie oder Negative Theologie oder Nagativität allgemein (Benner 2003) schon lange. In einer historischen Koinzidenz gebrauchten jedoch verschiedene Personen aus verschiedenen Disziplinen auf eigene Weise dieselbe Begrifflichkeit, z.B. Oser 1993, 1994, für Fehlerlernen, Minsky hingegen für negative Expertise im Bereich der Artificial Intelligence (in seinem Aufsatz »Negative Expertise«. International Journal of Expert Systems, S. 13–19)). Damit das Richtige in der Welt seinen Platz erhält Wenn wir von Negativem Wissen sprechen, dann ist damit eine lebendige Wissensstruktur gemeint, die sich in vier Typen einteilen lässt, nämlich deklarativ, prozedural, konzeptuell und strategisch (vgl. S. 26). Mit »lebendig« ist angesprochen, dass dieses Wissen für die Person subjektiv bedeutungsvoll und gebrauchsrelevant ist, also kaum träges Wissen (Reinmann-Rothmeier/Mandl 1995) darstellt. Wir wissen, dass dieses Wissen mentale (interne) und kulturelle (externe) Repräsentationen haben kann (Damerow/Lefèbre 1998), dass es eher begrifflich oder episodisch sein kann (Klix 1998), und wir kennen einige der Zusammenhänge zwischen Wissen und Emotion (Nummer-Winkler 1989, 1995; Op’t Eynnde/De Corte 2002). Besonders bedeutungsvoll scheinen uns auch die inhaltlichen, situativen und inferenziellen Dimensionen des Wissens zu sein (Van der Meer 1998; Baumert 2002). Es fällt uns aber auf, dass die Literatur zur Ontogenese des Wissens und zum Wissenserwerb (z.B. Reusser 1998; Möbus/Schröder 1998) kaum etwas zu den Abgrenzungen, zum Schutzwissen oder allgemein zum Negativen Wissen und kaum etwas zum Lernen aus Fehlern enthält. Es gibt praktische Gründe, warum wir glauben, dass die Theorie des Negativen Wissens konstitutiv für das menschliche Erkennen geworden ist. Wie oft haben Lehrpersonen im Unterricht die Formel »Ist es das? – Oh, nein. – Oder ist es jenes? – Eben gerade nicht. Es ist dieses« gebraucht, um gleichsam zu zeigen, was eine Sache nicht ist, um abzugrenzen, damit das Zielkonstrukt selber in den Mittelpunkt gerückt und ihm Bedeutung und Sicherheit gegeben werden kann. Intuitiv haben diese Einleitung: Zur Genese des Unbehagens 13 Lehrpersonen entdeckt, dass das Negative Wissen ein notwendiger Bestandteil des positiven Wissens (verité opposée), quasi seine Spiegelseite darstellt. Ohne dieses sind die Dinge als Denkkonstrukte nicht formbar, sie können im Gedächtnis keine Gestalt annehmen, sie haben kein Profil. Schon das Lernen der Sprache ist beispielsweise Abgrenzungslernen. Kinder, die auf jedwelches Tier zeigen und stets den gleichen Ausdruck – etwa »Muh« – verwenden, erfahren ständig die Korrektur der Bezugspersonen, die das eine Mal von Hund und das andere Mal von Katze sprechen (vgl. Szagun 1996). Das Lernen der Unterscheidung der zwanzig Schneearten durch die jungen Eskimos beruht auf dem gleichen Ausscheidungsprozess, wobei das Ausgeschiedene substanziell Teil dessen bleibt, was nicht ausgeschieden wird. Lehrpersonen, die z.B. Multiple-Choice-Prüfungsaufgaben konstruieren, sind angehalten, als falsche Aufgaben solche zu wählen, die nahe dem Zielkonstrukt liegen, dieses aber haarscharf verpassen. Menschen, die an einem Wissenswettbewerb am Fernsehen teilnehmen scheiden die Varianten, die nicht zutreffen systematisch aus, was einen Teil der Sicherheit für das Richtige darstellt. Somit gehört zu den praktischen Gründen für unser Anliegen auch das Faktum, dass durch solche Ausscheidungsprozesse und natürlich implizit durch das Machen von Fehlern in mehr oder weniger optimaler Weise Negatives Wissen aufgebaut werden kann. Zweifellos sind unter bestimmten Bedingungen Fehler sogar der Ursprung für Negatives Wissen, das dem positiven zum Durchbruch verhilft. Das Falsche nimmt dabei eine handwerkliche Funktion ein. Es hilft dem Erkenntnisprozess des Richtigen, d.h., es leistet die vorausgehende Einsicht, dass etwas anderes nicht dazugehört, nicht so ist oder nicht so abläuft. Das ist der epistemologische Grund, warum in diesem Buch der Umgang mit Fehlern und das Fehlerwissen eine zentrale Rolle spielen (vgl. Kapitel 1). Wir als Autoren erfahren immer wieder, dass Lehrende und Erziehende von »Fehlertoleranz« sprechen. Damit ist gemeint, dass man Verständnis dafür haben soll, dass die Studierenden oder Lernenden im Lernprozess Irrwege begehen. Aber genau dies meinen wir nicht. Wir denken sogar, dass Fehlertoleranz ein unerträgliches und zweideutiges Verhalten ist. Fehler und Falsches können nicht einfach zugelassen werden; sie müssen vermieden werden, damit das Richtige seinen Platz in der Welt erhält. Umgekehrt muss jeder Lernprozess durch Falsches hindurch zum Richtigen finden. Und solange formative Prozesse im Gange sind, muss in ihnen das Falsche genutzt werden, um Richtiges zu erstellen. Am Schluss eines Lehr-Lern-Prozesses sollte aber Falsches nicht mehr zu Tage treten, weil es ja als Negatives Wissen schon vorher über den Erarbeitungsprozess seine Funktion erhalten hatte. Es führt auf diese Weise zur Sicherheit des Nichtmehrtuns des Falschen (vgl. S. 59ff.). Unsere Theorie besagt deshalb, dass durch Fehler, wenn sie – auf dem Hintergrund eines Vertrauensverhältnisses, also ohne zu beschämen – öffentlich gemacht und dann erinnert werden, der Erkenntnis des Richtigen einen unverzichtbaren Dienst erweisen. Man kann auf das Falsche nicht verzichten, will man das Richtige richtig erkennen. Man muss aber das Falsche bekämpfen, damit es ein Richtiges richtig wird. Schriftsteller haben die Komplexität und grundlegende Unmittelbarkeit 14 Einleitung: Zur Genese des Unbehagens dieser Intuition in Sprache gefasst: Bei Hans Magnus Enzensberger finden wir in seinem Gedichtband »Leichter als Luft« (1999) folgende Strophen: Gegebenenfalls Wähle unter den Fehlern, die dir gegeben sind, aber wähle richtig. Vielleicht ist es falsch, das Richtige im falschen Moment zu tun, oder richtig, das Falsche im richtigen Augenblick? Ein Schritt daneben, nicht wieder gut zu machen. Der richtige Fehler, einmal versäumt, kehrt nicht so leicht wieder. So komplex zeigt sich der theoretische Ansatz zum Negativen Wissen; er ist situativ, inhaltlich, subjektiv und oft schicksalhaft geschwängert. Dass die Schulen und Universitäten Tausende Male am Tag, mit Falschem zu tun haben, dass sie mit den Irrtümern kämpfen, ist nicht genug für unseren theoretischen Kern; es weist aber darauf hin, dass in der Tat diese Situationen, wenn richtig genutzt, eine Quelle epistemischer Vernunft werden könnten. Warum wir aus Fehlern nicht lernen wollen Ein Motiv für diese vorliegende Arbeit ist, dass das Falsche in der Wissenschaft oft lange abgewehrt und durch den »protective belt« der Wissenschaftler selber verdrängt oder entkräftet wird (vgl. Lakatos/Musgrave 1979), dass dann aber genau aus den Unregelmäßigkeiten und Fehlerhaftigkeiten neue Forschungsprogramme entwickelt werden, die in der Erkenntnis dieses Falschen ihren Ursprung haben (vgl. Kuhn 1973). Die Darstellung des Aufbaus des Negativen Wissens ist deshalb an eine Reihe von zentralen Forschungserfahrungen gekoppelt. Eine davon entstand schon früh, als ich (F.O.) mit Lawrence Kohlberg, meinem Mentor an der Harvard-Universität, eine Serie von Interviews mit den klassischen moralischen Dilemmata durchführte. Der epistemologische Stellenwert dieser Dilemmata besteht darin, die grundlegenden Urteilsstrukturen von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen abzurufen und sie zu kodifizieren. Man gibt also eine Geschichte vor und stellt der teilnehmenden Person eine Reihe halbstandardisierter Fragen. Eines dieser berühmten Dilemmata ist die Heinz-Story, bei welcher es um die Frage geht, ob der Protagonist, wenn alle Einleitung: Zur Genese des Unbehagens 15 anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind, einbrechen darf, um ein Medikament zu stehlen, das mit hoher Wahrscheinlichkeit das Leben seiner an Leukämie erkrankten Frau retten würde. Interessant war, dass Versuchspersonen öfters, anstatt auf das Dilemma zu antworten, von sich selber, von ihrer Biografie zu reden begannen, d.h. von ähnlichen Erlebnissen, die sie hatten, oder von noch schlimmeren Vergehen, die sie begangen hatten, um irgendetwas Gutes zu tun oder zu tun müssen glaubten. Regelmäßig warfen wir dann diese Interviews in den Papierkorb oder wir verwendeten nur jene Teile, die für die Auswertung entsprechend dem vorgegebenen oder zu erweiternden Skoring-Manual brauchbar waren (vgl. Kap. 6, S. 96). Wenn nämlich die Befragten von sich sprachen, sagten sie oft sehr wenig darüber aus, wie und warum in einer bestimmten Weise gehandelt werden sollte, d.h., dass der normative Status ihres Urteils bzw. die entsprechenden Begründungen vernachlässigt wurden; vielmehr offenbarten sie etwas über die Entstehung, über die Genese ihres moralischen Denkens. Biografische Erlebnisse, so merkte ich (F.O.) bald, hatten einen anderen theoretischen Stellenwert: Die jeweils geschilderte Erfahrung gehörte nicht zur Sphäre des Abrufens bisher aufgebauter Strukturen. Vielmehr kam hier ein Anderes zur Sprache, nämlich die Rekonstruktion der Genese von Moralität, wie sie aus schmerzlichen Erlebnissen entwickelt worden war. Da hat eine Person den Bruch einer Freundschaft durch dummes Kritisieren verursacht und möchte, dass dies nicht geschehen wäre, aber sie kann es nicht wieder gutmachen und möchte so etwas nicht ein zweites Mal erleben. Da lässt jemand aus lauter Übermut im Großkaufhaus etwas mitgehen, wird erwischt und schämt sich zu Tode, sieht auch ein, dass trotz der kaum profunden Absicht ein größeres Vergehen entstanden war, als die Erwartung wahrhaben konnte. Hier lässt ein Vorarbeiter kleine Gegenstände der Fabrik, die er gerade in seinem Haushalt brauchen kann, in der Tasche verschwinden, und kann dann wochenlang nicht schlafen, weil er glaubt, beobachtet worden zu sein. Da fährt jemand mit dem Wagen unabsichtlich, aber doch aus Gleichgültigkeit eine Person an, die dann wochenlang im Spital liegt und diese Unvorsichtigkeit schwer bezahlen muss etc. In all diesen Beispielen schleppen die Menschen »Negative« Erfahrungen mit sich herum. Sie stellen nicht wie die Dilemmata Surrogate des Lebens dar, sondern Identitätsnarben, ohne die sie nicht wären, was sie geworden sind. Der epistemologische Stellenwert solcher Erfahrungen ist ein anderer: Menschen haben aus negativen Erfahrungen ihre Moralität aufgebaut. Nicht die gegenwärtigen Strukturen sind in Situationen des Erfassens maßgeblich, sondern der Weg ihrer Entstehung, der nachgezeichnet und damit bedeutungsvoll wird. Nicht die gegenwärtigen kognitiven Organisationen des Urteils werden so abgerufen, sondern es wird rekonstruiert, was dieses Urteil hervorgebracht hat und wie es jetzt als Lebensnarbe mitgeschleppt wird: Es geht um die Entstehung der Moral aus dem Scheitern von Beziehungen und der Gefährdung dessen, was man als richtig erkennt. Aber Negatives Wissen ist nicht in erster Linie eine Sache der Moral; jeder Wissensbereich des menschlichen gegenwärtigen Lebens hat seinen eigenen Schatz an privatem und öffentlichem Fehlerwissen. Jede Person, die ein Essen zubereitet oder 16 Einleitung: Zur Genese des Unbehagens die Auto fährt, handelt auf dem Hintergrund dieses Negativen Wissens; dasselbe gilt für jeden Richter, Handwerker, Sozialarbeiter, Therapeuten, Journalisten, Ingenieur, Operateur etc. Das Wesen dieser negativen Erfahrungen verstehen wir heute im Lichte unserer Forschung, wie sie in diesem Buch dargestellt wird, zwar bedeutend besser; aber die einschlägigen wissenstheoretischen Abhandlungen thematisieren dieses Negative Wissen bisher kaum. Auch die emotionale Komponente seines jeweiligen Entstehens wird selten berücksichtigt, was dazu führt, dass eine Reihe neuer Aussagen über seine Wirkungsweise und den möglichen Einbezug dieser Komponente im Wissensmanagement noch zu wenig erfolgen kann. Wenn negative Erfahrungen bewirken, dass wir bestimmte Erkenntnisse abgrenzbar sichern oder dass wir bestimmte Dinge nicht mehr tun, dann stellt allerdings der Satz, dass wer sich die Finger verbrennt, nicht mehr in die Kerze greift, ein zu einfaches Schema für das dar, was wir entwickeln. Wer Negatives Wissen aufgebaut hat, adaptiert in einer neuen Situation die Erfordernis des Handelns durch Rekonstruktionsprozesse des Falsch-Richtig-Gefälles. Fehlerwissen führt zwar in vielen Fällen zu Automatismen des Handelns, dies aber erst an zweiter Stelle, nach der Erkenntnis dieses kontrastiven Verhältnisses. Zur Entwicklung des hier vorgestellten Projektes In unserem fünfjährigen Forschungsprojekt, das vom Schweizerischen Nationalfonds finanziell getragen worden ist, wurde uns mehr und mehr bewusst, dass, geschwächt durch den etwas langsamen Blick der kognitiven Wissenschaften, die das Phänomen des Negativen Wissens lange Zeit ausgeschlossen hatten, aber auch verwirrt durch die klinische Methodologie der Entwicklungspsychologen, die seit Piaget, Kohlberg, Selman, Lerner u.a. kaum mehr Sinn dafür hatte, was die Strukturen verunsichert, hingegen den Abruf der Kompetenz betonte, und geblendet durch eine Erziehungswissenschaft, die immer nur das Positive, das Glück und die »pädagogische Andacht«, also ein Gefühl ritualisierten Wohlbefindens und Flow will, dass also die Wirkung des Negativen Wissens in beschämender Weise vernachlässigt worden ist. Unbestreitbar müsste hier ein neues Denken entstehen, das nicht so sehr das Richtige betont, sondern die Spannung zwischen dem Richtigen und dem Falschen, nicht so sehr das Gute, sondern die Spannung zwischen dem Guten und dem Schlechten, nicht so sehr das Schöne, sondern die Spannung zwischen dem Schönen und dem Hässlichen. Negatives Wissen ist immer die Frucht einer Irritation angesichts der scheinbaren Wohlgeformtheit der Welt. Wir können nicht mehr verschleiern, dass alles, was wir wirklich lernen, durch eine komplizierte Entstehungsphase, durch Scheitern und Schmerzen hindurchgegangen ist. Es tauchen dauernd neue Beweisstücke dafür auf, dass wir nur durch die Erkämpfung einer Sache, nur durch die Bemühung, die dieses Scheitern als Möglichkeit einschließt, überhaupt unsere Strukturen erwerben können. Das andere Gesicht des Janus, das hinter jedem unserer Wissenskonzepte sichtbar gemacht werden muss, ist bis jetzt noch kaum erEinleitung: Zur Genese des Unbehagens 17 forscht worden. Für die Idee, dass Wissen immer zur Verfügung steht, also für das Wissensmanagement ist dies ein niederschmetternder Befund; denn wie sollten wir Wissen verfügbar machen, wenn wir nichts über das wissen, was dieses Wissen vom falschen Wissen unterscheidet? Lernen ist »schmerzhaft«, am Ziel aber führt es zu Stolz und Zuversicht In dieser Einleitung möchten wir gleich zum Vornherein eingestehen, dass Fehler nicht einfach die Sache einer falschen Logik oder eines falschen Denkprozesses sind (vgl. Kap. 15). Es gibt die Dimension der Ablenkung, das Faktum der Unaufmerksamkeit, die verblüffende Idee der Verwirrung durch Stress, die Tatsache, dass Angst im Kern des Irrtums oder des Fehlers liegt. Dies alles ändert nichts daran, dass die Falschhandlung oder die Falschantwort oder die Falscherfahrung Anlässe für einen Erkenntnisprozess darstellen, die mittels Verblüffung, Selbstscham und versuchter Korrektur zum Wissen über das Nicht-so-Sein oder Nicht-so-Funktionieren einer Sache führen. In unseren Ausführungen gehen wir daher so weit zu behaupten, dass Schulen und Universitäten in Bildung und Ausbildung oft Erkenntnis verhindern, weil das Gegenteil des Wahren oder Funktionierenden nicht zugelassen wird. Ein Beispiel hiefür ist die Lehrerbildung: Jungen Lehramtskandidaten und -kandidatinnen wird oft vorgegaukelt, dass das Unterrichten linear, leicht, erfolgreich und begeisternd zu verlaufen habe. Es wird nicht zugelassen, dass sie scheitern. Und selbst bei den schlechtesten Versuchen wird noch etwas Gutes gefunden, damit die Wahrheit, nämlich dass das Unterrichten ein mindestens so komplexes Unterfangen wie das Navigieren eines Schiffes im Schneesturm ist, keinen Eingang in den Kopf der Betroffenen finde (vgl. Oser/Oelkers 2001). Das eigentliche Lernen, das in der Erfahrung der Grenze des Machbaren in diesem Beruf besteht, müsste, sofern das Sozialklima positiv und unterstützend ist, zu einer viel größeren Herausforderung, aber auch zu mehr Sinn führen. Man wäre durch den Widerstand hindurchgegangen und hätte so eine Kompetenz erworben, die nicht leicht anders herzustellen ist. Das soll deshalb nicht sein, weil angenommen wird, das Sozialklima und das damit zusammenhängende Wohlbefindlichkeitsausmaß sei unabhängig vom Scheitern in Leistungssituationen. Diese Annahme ist die zentrale Schwachstelle der verschiedenen Ansätze humanistischer Alltagspsychologien, die das vollständige Lösen aller Konflikte, die vollständige positive Interaktion der Menschen untereinander, aber nie den Widerstreit und das Leben mit den Unterschieden akzeptieren wollen. Sie führt zu kitschigen Vorstellungen dessen, wie ein Lehrer-Schüler-Verhältnis aufgebaut sein soll: Statt davon zu sprechen, was an Verkehrtem ansteht und wo das Falsche und Schwache darin eine Quelle der Verbesserung sein könnte, wird das Angenommensein allein, die Sozialbeziehung allein, das gute Gefühl an sich, das »Es-stimmt-fürmich « allein betont. Dass beide notwenig sind, die Transformation der kognitiven Strukturen und das positive Sozialklima, wird weiter hinten ausführlicher dargestellt. Wir kommen später darauf zu sprechen, dass z.B. für den jungen Piloten im 18 Einleitung: Zur Genese des Unbehagens Simulator die Welt im Gegensatz zu den Lehrpersonen gar nicht »stimmt«, weil er viele Fehler machen muss und gerade deswegen Freude am Fliegen erhält. Wir kommen darauf zu sprechen, dass wirkliches Lernen im Prozess selber noch nicht »Spaß« macht, weil es uns zur Veränderung zwingt, erreichte Veränderung aber das fachliche oder soziale Selbstgefühl stärkt (vgl. S. 225ff.). Selbst wenn die vier von Siegler (2000, S. 30ff.) vorgestellten »Lessons from Recent Studies of Childrens Learning « berücksichtigen, bleibt der wirkliche Lernprozess mühsam, oft gebrochen und risikoreich. Er sagt, dass leider deshalb nur das Leichte, Seichte und Schöne im Mittelpunkt stehe. Ferner meint er, dass Entdeckungen sowohl nach dem Erfolg als auch nach dem Misserfolg geschehen. Dies unterstützt die Theorie vom Aufbau des Negativen Wissens eindrucksvoll. Siegler sagt weiter, dass frühe Variabilität in Beziehung zu späterem Lernerfolg zu setzen sei. Auch das stimmt für die Fehlerkultur, die selber eine Variabilität darstellt. Schließlich werden Strategien, so Siegler, nicht durch blindes Trial-and-Error-Verhalten erzeugt. Sie stehen im Kontext von konzeptuellem Verstehen und Nichtverstehen. Auch dieses Diktum widerspricht der Fehlerkultur nicht; denn Negatives Wissen kann nur bewusst und gegen den Widerstand von innen und/oder von außen aufgebaut werden. Aber dieser Widerstand führt zu Stolz und zum Ethos des Durchgehens durch eine Sache, durch eine Aufgabe, durch eine Erarbeitung. Vom Positiven des Negativen Was bis jetzt vorgestellt worden ist, stellt nicht den einzigen Grund dafür dar, warum das Negative Wissen und das damit zusammenhängende Fehlerlernen nicht bewusst ausgeschöpft werden. Menschen haben die Tendenz, das Positive allein sehen und anerkennen zu wollen. In seinem neuen Buch zum Thema »Lernen. Gehirnforschung und die Schule des Lebens« sagt Spitzer (2002, S. 181): »Gelernt wird immer dann, wenn positive Erfahrungen gemacht werden. Dieser Mechanismus ist wesentlich für das Lernen der verschiedensten Dinge, wobei klar sein muss, dass für den Menschen die positive Erfahrung schlechthin in positiven Sozialkontakten besteht.« Er weist darauf hin, dass sich menschliches Lernen immer in Gemeinschaft vollziehe und diese den besten Verstärker für das eigene Tun abgebe. Es fehlt das Lernen aus dem Irrtum, aus der Krise, aus dem Nichtgehen einer Sache. Es fehlt die Mühsal intensiver Suchprozesse. Es fehlt vollständig der Aspekt des Zusammenhangs zwischen dem, wie etwas nicht ist, und dem, wie es ist, und dem, wie etwas nicht funktioniert, und dem, wie es funktioniert, und der damit einhergehenden Bewusstheit von Welt. Es fehlt der dialektische Aspekt des Lernens aus dem Irrtum, der genau dieses ermöglicht. Es fehlt das Suchen in Einsamkeit. Und es fehlt das Lernen des Gegenteils vom Richtigen, das den Lernenden aber Sicherheit und Würde verleiht. Man kann etwas wirklich nur aus seinem Gegenteil erkennen. Unser Credo ist: Wir behaupten, dass das Konzept des Aufbaus Negativen Wissens eine Chance ist, solche Haltungen aufzubauen. Wir nehmen an, dass das StreEinleitung: Zur Genese des Unbehagens 19 ben nach Optimismus den Umgang mit Pessimismus voraussetzt, wir glauben, dass sich ein gutes Klima in der Spannung der Entzweiung bewähren muss; wir setzen voraus, dass das Machen eines Fehlers und seine Korrektur einen echten Gewinn für das Lernen darstellen, und wir versuchen zu zeigen, dass der gelebte Widerstreit oder der gelebte Dissens wichtiger für die Erkenntnis ist als die blinde Übereinstimmung mit ihren kumpelhaften Mauscheleien. Weitere Titel aus der Reihe BELTZ Pädagogik |
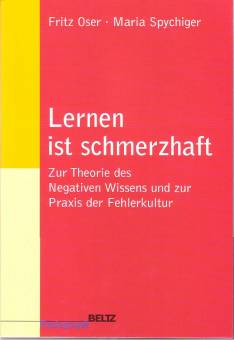
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen