|
|
|
Umschlagtext
Auf einen Begriff scheint ›Heimat‹ nicht zu bringen zu sein. Vielmehr stellt sich Unschärfe oder Mehrdeutigkeit ein. Womöglich liegt in der Offenheit und begrifflichen Widerständigkeit gerade der Reiz, das Potenzial, aber auch die Brisanz dieses streitbaren wie umstrittenen Konzepts.
Eine Öffnung der ›Heimat‹ hin zu den Anforderungen von Moderne und Globalisierungen lässt sich ebenso konstatieren wie die zum Teil fatalen Folgen von Ausschließung und Abgrenzung, für die der Begriff auch steht. Heimaten gewinnen ihre Plausibilität aus je spezifischen historischen Umständen. Brüche, Transformationen, Aufmerksamkeitsverschiebungen und Neuakzentuierungen, die das Konzept seit etwa 1800 in zunehmendem Maße geprägt haben, lassen Konjunkturen erkennen. Diese sind meist – in den Koordinaten von Raum, Zeit und Identität – Protokolle der Verunsicherung oder des Verlusts. Heimat fungiert dann gleichermaßen als Sehnsuchtsraum und Ordnungsentwurf. Der Band versteht sich nicht als ein weiterer Versuch, Heimat zu definieren, sondern versammelt Studien aus Literatur-, Film- und Geschichtswissenschaft, die vor allem der Frage nachgehen, wo, wann und wie Heimat thematisiert und konzeptualisiert wurde und wird. Es wird also an einzelnen Lektüren und Überlegungen erprobt, was als eine historische Perspektive notwendiger Impuls für eine Beschäftigung mit Heimat sein könnte. Rezension
Heimat - das ist ein angesichts von Moderne und Globalisierung merkwürdiger Begriff, ein besetzter Begriff, verbunden mit eher kitschigen Assoziationen wie Heimatmusik und Heimatfilm, mit Lederhose, Dirndl und konservativ-reaktionärer Engstirnigkeit, zugleich aber wächst zugleich mit Moderne und Globalisierung das Bedürfnis nach Beheimatung, nach Heimat, nach Geborgenheit, nach Vertrautem ... Heimat - das ist ein schillernder Begriff. Umso wichtiger ist es, dass diesem Sachverhalt einmal systematische, wissenschaftliche Aufmerksamkeit geschenkt wird, wie es in diesem informativen und interdisziplinären Band geschieht. Der Begriff Heimat hat in Zeiten der Verunsicherung oder des Verlusts Konjunktur; Heimat fungiert dann gleichermaßen als Sehnsuchtsraum und Ordnungsentwurf.
Jens Walter, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Editorial zur Reihe "Kultur- und Medientheorie" Das klassische Feld der Geisteswissenschaften sieht sich seit geraumer Zeit einer grundsätzlichen Herausforderung gegenüber: Die Kultur- und Medienwissenschaften haben sich nicht nur als eigenständige Disziplinen etabliert, sie erheben weit über ihre Disziplingrenzen hinaus den radikalen Anspruch, die tradierte episteme der Geisteswissenschaften neu zu bestimmen. Die Reihe Kultur- und Medientheorie geht dieser Transformation eines ganzen Wissensfeldes in der Vielfalt ihrer Facetten nach. Schlagworte: Literatur, Film, Geschichte, Kultur, Heimat Adressaten: Literaturwissenschaft, Geschichtswissenschaft, Filmwissenschaft, Soziologie, Volkskunde, Philosophie Gunther Gebhard (Dipl.-Soz.) studierte Soziologie, Geschichts- und Politikwissenschaften in Dresden und ist Lehrbeauftragter an der TU Dresden. Oliver Geisler (M.A.) ist Literatur- und Kulturwissenschaftler und promoviert an der TU Dresden. Steffen Schröter (Dipl.-Soz.) studierte Soziologie, Germanistik und Kunstgeschichte in Dresden und Lissabon und ist Lehrbeauftragter an der TU Dresden. Das Buch im Spiegel der Medien »[J]eder Artikel [bietet] eine ausgesprochen anregende Lektüre, die viele weiterführende Fragen aufwirft und deutlich macht, dass 'Heimat' als kultur- und sozialwissenschaftlichem Begriff eine unverminderte Bedeutung innewohnt.« Gregor Hufenreuter, H-Soz-u-Kult, 10 (2007) »[Der Band ist] ein äußerst informatives und beachtenswertes Kompendium des Wissens über einen spezifisch deutschen Begriff, der zugleich aber auch ein universales Phänomen meint.« Tomasz G. Pszczólkowski, Studien zur Deutschkunde, 38 (2008) »[D]ie anregende Lektüre der einzelnen Artikel [wirft] viele weitere Fragen auf. Deutlich wird, dass Heimat in kultur- und sozialwissenschaftlicher Hinsicht relevant ist und bleibt.« Nils Korsten, Zeitschrift für Volkskunde, 104/2 (2008) Das Buch im Spiegel der Leser Ihre Meinung zum Buch ist gefragt! Senden Sie uns Ihre Rezension. »Man braucht nur einen kurzen Blick in die Geschichte des 20. Jahrhunderts zu werfen, um festzustellen, dass in vielfältiger Weise Heimat als Begriff vor allem durch politische Konzeptualisierungen und Instrumentalisierungen seine Hochzeiten erlebte. Im Nationalsozialismus zunächst eher metaphorisch an Blut und Boden gebunden, verdeutlichte dann der Zweite Weltkrieg nicht nur die wörtliche, sondern vor allem die lebensweltliche Umsetzung der Metaphorik des Heimatbegriffes; die sogenannten Berichte von der Heimatfront geben davon immer noch trauriges und erschütterndes Zeugnis. Dennoch veraltete danach der Begriff keineswegs, denn trotz der nationalsozialistischen Pervertierung zeigte der doktrinäre Sozialismus der ehemaligen DDR, dass Heimat immer noch fruchtbar auf ideologischen Nährboden angepflanzt werden konnte. Das schulisch kanonisierte mithin institutionalisierte Lied ›Unsre Heimat‹ Heribert Kellers und Hans Naumilkats ist wohl das Paradigma politischer Instrumentalisierung und hat im kollektiven Gedächtnis der Ostdeutschen immer noch Präsenz. Nicht zuletzt deswegen erscheint heutzutage der Heimatbegriff wenn nicht als obsolet so doch zumindest als Anachronismus. Dass dies aber nur scheinbar so ist, eröffnet der von Gunther Gebhard, Oliver Geisler und Steffen Schröter herausgegebene Sammelband ›Heimat. Konturen und Konjunkturen eines umstrittenen Konzepts‹ und darüber hinaus, dass der Heimatbegriff von den historischen Ereignissen des 20. Jahrhunderts semantisch überformt ist und aufgrund seiner spezifischen ›definitorische[n] Widerständigkeit‹ (S. 9), so die Herausgeber, vielgestaltige Bedeutung annimmt, der die Beiträge des interdisziplinären Bandes nachgehen. Die historisch-chronologisch geordneten Aufsätze präsentieren eben dadurch die Konjunkturen respektive ›Thematisierungschübe‹ (S.12) und zugleich die Konturierungen des Heimatkonzeptes von der prädiskursiven Phase der Frühen Neuzeit (Eric Piltz, S. 57 - 79) bis in die Gegenwart. Neben dieser zeitlichen Achse sind aber immer auch die räumliche Achse und die Modi der Identitätsangebote in den Blick genommen. Infolgedessen kommt die Ausbuchstabierung des Heimatbegriffes verschiedener Kulturen (Doreen Eischingers ›Jüdische Heimat‹, S. 81 - 107) und die mediale Erzeugung eines Identitätsversprechens (Alexandra Ludewig, S. 141 - 160) zur Darstellung, das aufgrund seines phantasmatischen Potentials sich letztlich auch als Sujet der Gegenwartsliteratur erweist (Steffen Hendel, S. 161 - 178 und Christian Luckscheiter, S. 179 - 195). Heimat ist demnach selbst im Zeitalter der Globalisierung präsent wenn nicht gar notwendig, jedoch nur insofern die vergangenen, ideologisch aufgeladenen Konzepte ›verlernt werden‹ (Bernd Hüppauf, S. 109 - 140 hier S. 138). Dies bedeutet, die semantisch-politischen Facettierungen vergangener Heimatkonzepte zu thematisieren, was die gelungene Einleitung der Herausgeber leistet, die außerdem im Anschluß an Hans Blumenbergs Theorie der Unbegrifflichkeit insbesondere die Historizität von ›Heimat als Näheverhältnis von Mensch und Raum [vorstellt], das Identifikation und Identität hervorbringt‹ (S. 10). Im Kursus durch Texte literarischer, philosophischer und soziologischer Provenienz der letzten zweihundert Jahre wird dabei der Wandel des Heimatdenkens, das im 20. Jahrhundert infolge ideologischer Instrumentalisierungen geschlossen gegenüber dem Anderen war, während das 19. Jahrhundert zu großen Teilen offen dem Fremden gegenüberstand, gezeichnet. Offenheit ist dem Sammelband auch in anderer Hinsicht eigen: Basierend auf dem forum junge wissenschaft, das im Jahre 2006 zum zweiten Mal stattfand, suchen die Herausgeber und Veranstalter jenseits verschlossener Universitätstüren im offen Raum des Dresdner Kulturvereins riesa e.V. den Weg in die Öffentlichkeit, gleichsam um dieser auch die Relevanz geisteswissenschaftlicher Arbeit zu zeigen. Wünschenswert, soviel Emphase sei abschließend gestattet, bleibt die Fortsetzung des Projektes und außerdem, dass jenseits von Geltungsbedürfnissen noch mehr etablierte Geistes- und Kulturwissenschaftler wie Bernd Hüppauf Interesse an der Zusammenarbeit mit der jüngeren Generation nicht nur offerieren, sondern auch umsetzen.« Kai-Uwe Reinhold, cand. Magister Artium: Germanistik Literaturwissenschaft und Kulturgeschichte, Philosophie und Soziologie; Mitarbeiter des DRESDNER Kulturmagazins Inhaltsverzeichnis
Vorwort
7 Heimatdenken: Konjunkturen und Konturen. Statt einer Einleitung GUNTHER GEBHARD, OLIVER GEISLER, STEFFEN SCHRÖTER 9 Verortung der Erinnerung. Heimat und Raumerfahrung in Selbstzeugnissen der Frühen Neuzeit ERIC PILTZ 57 Jüdische Heimat nach dem Holocaust in Ungarn DOREEN ESCHINGER 81 Heimat – die Wiederkehr eines verpönten Wortes. Ein Populärmythos im Zeitalter der Globalisierung BERND HÜPPAUF 109 ›Ostalgie‹ und ›Westalgie‹ als Ausdruck von Heimatsehnsüchten. Eine Reise in die Traumfabriken deutscher Filme ALEXANDRA LUDEWIG 141 Heimat, wo anders! – Über das Reisen in zwei fiktionalen Texten von Angela Krauß und Christian Kracht STEFFEN HENDEL 161 Formen des Beheimatens in der Heimatlosigkeit. Peter Handkes Erzählwelt und Heimat ›um 2000‹ CHRISTIAN LUCKSCHEITER 179 Autorinnen und Autoren 197 Weitere Titel aus der Reihe Kultur- und Medientheorie |
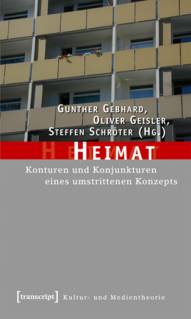
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen