|
|
|
Umschlagtext
Der Doppelband zum 20. Jahrhundert verfolgt gegenüber den anderen Bänden der Reihe einen besonderen, seinem Gegenstand geschuldeten Ansatz: Sozial- und semantikgeschichtliche Aspekte werden in einem wissenssoziologischen Ansatz verbunden, der davon ausgeht, dass sich religiös-soziale Formationen und religiöse Semantiken wechselseitig beeinflussen, ohne doch ineinander aufzugehen. Denn Religion ist im 20. Jahrhundert mehr denn je ein umstrittener Sachverhalt. Säkularisierung, Individualisierung und Pluralisierung sind zentrale Stichworte, die die Religionsgeschichte des 20. Jahrhunderts kennzeichnen. Um diese Entwicklungen nachzuzeichnen, werden im ersten Band zunächst in der Sektion »Epochen« zeitliche Aspekte, namentlich synchrone Zusammenhänge zwischen religiösen Formationen innerhalb eines Zeitraums behandelt. Die Sektion »Themen« befasst sich schließlich mit den im 20. Jahrhundert bedeutsamsten Kontexten, die entweder selbst explizit religiöser Art sind oder in einem signifikanten Bezug zur Religion stehen. Der zweite Teilband widmet sich ›Positionen‹ und ›Formationen‹. Unter dem Stichwort ›Positionen‹ werden die wichtigsten religiösen Gemeinschaften und Richtungen behandelt. Mit dem Stichwort ›Formationen‹ richtet sich der Blick auf schichtungsbezogene Aspekte (Arbeiterschaft, Bürgertum, Gender, Generationen), die für die Erscheinungsform des Religiösen zumindest zeitweise von Bedeutung waren.
Bd. 1: Altertum und Frühmittelalter – Hrsg.: Peter Dinzelbacher Bd. 2: Hoch- und Spätmittelalter – Hrsg.: Peter Dinzelbacher Bd. 3: Zeitalter der Reformation – Hrsg.: Albrecht Burkardt, Stefan Ehrenpreis Bd. 4: 1650 bis 1750 – Hrsg.: Anne Conrad, Kaspar von Greyerz Bd. 5: 1750-1900 – Hrsg.: Michael Pammer Bd. 6: 20. Jahrhundert – Hrsg.: Lucian Hölscher, Volkhard Krech Rezension
Religionslehrer/inne/n täte es trotz aller konfessionellen Verengung, die der bundesrepublikanische Religionsunterricht gemäß Art.7GG mit sich bringt, gut, wenn der Blick geweitet würde vom (konfessionellen) Christentum auf alle Arten von Religion. Das gilt umso mehr für die Gegenwart, in der Migration, Multikulturalität, Säkularisierung, Pluralisierung und Individualisierung die religiöse Situation bestimmen. Der hier anzuzeigende Band wendet sich der ganz aktuellen, gegenwärtigen Religiosität im deutschsprachigen Raum zu: das 20. Jahrhundert. Religionsgeschichte darf nicht mit Kirchengeschichte verwechselt werden, - selbst wenn es in dem hier anzuzeigenden Zeitraum des Bands 2 des Handbuch des Religionsgeschichte sich noch um ein sehr homogenes, christlich geprägtes Ganzes im deutschsprachigen Raum handelt. Hier wird nicht Kirchengeschichte nachgezeichnet - und also auch nicht aus einer konfessionellen Perspektive heraus gearbeitet, sondern hier werden religionswissenschaftlich (nicht theologisch) die wesentlichen Züge der jeweils zeittypischen Spiritualität, Frömmigkeit und Volksreligion innerhalb und außerhalb des amtskirchlich vorgegebenen Rahmens aufgezeigt. Die Darstellung kombiniert den historischen mit dem religionsphänomenologischen Zugang. So wird ein Überblick über die Religiosität eines Zeitalters gegeben.
Thomas Bernhard, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Handbuch der Religionsgeschichte im deutschsprachigen Raum Herausgegeben von Peter Dinzelbacher Eine Religionsgeschichte Deutschland existierte bisher nicht. Sie hat nicht die wohlbekannten Geschicke der Kirchen nachzuzeichnen, sondern die wesentlichen Züge der jeweils zeittypischen Spiritualität, Frömmigkeit und Volksreligion innerhalb und außerhalb des amtskirchlich vorgegebenen Rahmens. Die Darstellung basiert auf der Kombination des historischen mit dem religionsphänomenologischen Zugang: Einerseits wird die Entwicklung der dominierenden Formen der christlichen Religiosität in den einzelnen Epochen bzw. Konfessionen umrissen, andererseits die Hauptmomente ihrer Vermittlung und Manifestationen in ihren jeweils charakterischen Ausdrucksformen vorgestellt. Es geht um Kommunikation religiöser Vorstellungen und Normen durch die Katechese in Wort und Bild, um die Vorstellungswelt (Gott, Engel, Heilige, Dämonen, Tote, Jenseits), um die dominierenden Erlebnisweisen von Religion einschließlich der geschlechsspezifischen, aber auch um die Numinosität der natürlichen und menschengeschaffenen Dinge, des Raumes und der Zeit, um die zahllosen Formen, in denen Frömmigkeit gelebt wurde: Liturgie, Gebet, Wallfahrt, geistliches Spiel, Meditation, und es geht um das Selbstverständnis des Gläubigen als "homo religiosus". Auch die Religiosität des Judentums ist berücksichtigt. Band 1: Altertum und Frühmittelalter. Band 2: Hoch- und Spätmittelalter. Band 3: Reformation. Erscheint voraussichtlich 2016. Band 4: 1650 bis 1750 Band 5: 1750 – 1900. Band 6/1: 20. Jahrhundert - Epochen und Themen Band 6/2: 20. Jahrhundert - Positionen und Formationen. Inhaltsverzeichnis
TEIL I: RELIGIÖSE POSITIONEN
PROTESTANTISMUS (Alf Christophersen) 15 I. Der Protestantismus und Das Wesen des Christentums 15 II. Das protestantische Prinzip oder: „Das Denken ist eines Jeden Pflicht“ (G. W. F. Hegel) 19 III. Max Weber, der „Geist des Kapitalismus“ und die Säkularisierung 26 IV. Das politisierte Christentum und die ‚soziale Frage‘ 31 V. Rudolf Bultmann oder: Der Rückzug in die Existenz 35 VI. Paul Tillich oder: Die Entscheidung für den Religiösen Sozialismus 39 VII. Das Bekenntnis von Barmen oder: Die Abwehr natürlicher Theologie 41 VIII. Signale des Aufbruchs und der Abgrenzung oder: Standortbestimmungen im ‚Säkularen Zeitalter‘ (C. Taylor) 48 IX. Religionstheologie oder: Wie exklusiv ist der eigene Glaube? 53 RÖMISCHER KATHOLIZISMUS (Thomas Mittmann) 57 I. Einleitung 57 II. Der Römische Katholizismus zu Beginn des 20. Jahrhunderts 58 1. Zugehörigkeit, territoriale Verteilung und Entwicklung der katholischen Bevölkerung im Deutschen Reich 58 2. Innerkirchliche und staatskirchenrechtliche Entwicklungen 59 III. Der Römische Katholizismus im Ersten Weltkrieg 60 1. Die Haltung der katholischen Kirche zum Ersten Weltkrieg 60 2. Auslandsseelsorge, Weltmission und Verbandswesen 62 3. Katholischer Aufbruch in Liturgie, Presse und Medien 63 IV. Der Römische Katholizismus in der Weimarer Republik 64 1. Demographische Entwicklungen und Neustrukturierung der Bistumsorganisation 64 2. Verbesserte Kontextbedingungen für den Katholizismus 64 3. Liturgische Bewegung und katholische Jugendverbände 65 V. Der Römische Katholizismus im Nationalsozialismus 66 1. Resistenz und Arrangement des Katholizismus gegenüber dem Nazi-Regime 66 2. Staatliche Einschränkungen und Repressionen 67 3. Katholische Kirche und Zweiter Weltkrieg 68 VI. Die Entwicklung des deutschen Katholizismus in der Nachkriegszeit 69 1. Wiederaufbau und Rechristianisierung 69 2. Schulddebatte und Institutionalisierung der katholischen Zeitgeschichtsforschung 71 3. Der Katholizismus und die politischen Parteien in der Bundesrepublik 73 VII. Das Zweite Vatikanische Konzil 75 1. Hintergründe und Ergebnisse 75 2. Zwischen Euphorie und enttäuschten Hoffnungen – Nachwirkungen des Konzils 77 VIII. Innerkatholische Polarisierungen in den ‚langen 1960er Jahren‘ 78 1. Medialisierung, Politisierung und Pluralisierung des Katholizismus 78 2. Neue und neuformierte Arbeitsformen: Akademien und Katholikentage 80 3. Die Vernetzung des Katholizismus mit den neuen sozialen Bewegungen 81 IX. Transformationen des Katholizismus im deutschsprachigen Raum außerhalb Westdeutschlands 82 1. Der Katholizismus in der DDR 82 2. Entwicklungen des Katholizismus im 20. Jahrhundert in Österreich und in der Schweiz 83 X. Der Katholizismus nach der Wiedervereinigung 87 1. Kircheninstitutionelles Zusammenwachsen und konfessionelle Veränderungen 87 2. Krisensymptome des deutschen Katholizismus im 21. Jahrhundert 88 XI. Resümee und Ausblick 89 WEITERE CHRISTLICHE UND CHRISTENTUMSNAHE GEMEINSCHAFTEN (Tobias Sarx) 93 I. Einleitung 93 II. Freikirchen altkonfessioneller Prägung 94 1. Altkatholische Kirchen 94 2. Selbständige Lutherische Kirchen 96 3. Evangelisch-Altreformierte Kirche 97 III. Orthodoxe und altorientalische Kirchen im deutschsprachigen Raum 98 IV. Pietistische und erweckliche Gemeinschaften 99 V. Evangelische Freikirchen (außer Pfingstkirchen und Charismatische Bewegung) 101 VI. Pfingstkirchen, Charismatische Bewegung 105 VII. Religiöse Gruppierungen außerhalb des ‚anerkannten‘ freikirchlichen Spektrums 110 1. Neuapostolische Kirche 111 2. Zeugen Jehovas 111 3. Mormonen 112 4. Religiöse Gruppen in Distanz zur bürgerlichen Gesellschaft 113 5. Neuoffenbarungsreligionen 114 6. Christliche Wissenschaft 115 7. Christlich-religiöse Gruppen ohne typische Gemeindestrukturen 115 8. Neue religiöse Bewegungen seit den 1960er-Jahren 116 VIII. Resümee 118 VÖLKISCHE RELIGIOSITÄT (Justus H. Ulbricht) 121 I. Entstehungsbedingungen 122 1. Die Charakteristika der völkisch-religiösen ‚Szene‘ 123 2. Glaubensinhalte 124 3. Vordenker 126 II. Organisations- und Deutungsgeschichte(n) 127 1. Entstehungsphase um 1900 – Die „Reformation des 20. Jahrhunderts“ 127 2. Weimarer Republik – Wachstum und Zersplitterung 128 3. Drittes Reich – Enttäuschte Hoffnungen 130 4. Die Nachkriegszeit – Sammlung und Erneuerung 132 5. Unterwegs im ‚neuen Zeitalter‘ 134 III. Fazit 136 JUDENTUM (Uri-Robert Kaufmann) 139 I. Vorgeschichte 139 II. Pluralisierung 139 III. Nach 1900 143 IV. 1933-1939 146 V. Nach 1945 147 ISLAM (Levent Tezcan) 151 I. Einleitung 151 II. Islam vor der Arbeitsmigration 152 1. Islam im Vielvölkerstaat und der ‚Lagerislam‘ der Kriegsgefangenen 152 2. Der ‚Vereinsislam‘ mit bürgerlichem Antlitz 154 3. Der ‚Soldatenislam‘ der Zwischenkriegszeit 155 4. Der ‚Flüchtlingsislam‘ und der Auftritt der Muslimbrüder 155 III. Der Islam der Arbeitsmigranten 157 1. „Vom Exilislam zum Diasporaislam“ 158 2. Formation des modernen Alevitentums in der Diaspora 160 3. Islam als Public Religion 162 4. Der 11. September und die neue Islampolitik 164 IV. Bewegung im Islamfeld 165 1. Dialog als Kommunikationsformat 166 2. Moschee und die funktionale ‚Verkirchlichung‘ des Islam 166 3. Universitäre Imamausbildung 168 4. Außerhalb des Verbandsislam 172 V. Schlussbemerkungen 175 ESOTERIK (Diethard Sawicki) 177 I. Strömungen, Protagonisten, soziale Formationen 177 II. Generelle Merkmale 182 III. Definitionsprobleme und Zugriffsmöglichkeiten 186 IV. Politisch-soziale Klassifikationsversuche 188 SÄKULARISMUS (FREIRELIGIÖSE, FREIDENKER, MONISTEN, ETHIKER, HUMANISTEN) (Todd H. Weir) 189 I. Strukturen 189 1. Säkularismus und Religion 189 2. Säkularismus und Konfession 191 3. Aspekte des Säkularismus im Wilhelminischen Deutschland 192 a) Rechtlicher Status 192 b) Weltanschauung 193 c) Sozialstruktur 195 d) Milieu und Politik 196 4. Transnationale Dimensionen des deutschen Säkularismus 197 II. Geschichte des Säkularismus 1900 bis 2000 199 1. Das späte Kaiserreich 1900-1914 199 2. Krieg und Revolution 201 3. Weimarer Republik 202 4. Drittes Reich 208 5. Kalter Krieg und geteiltes Deutschland 211 6. Seit der Wiedervereinigung 214 TEIL II: SOZIALE FORMATIONEN ARBEITERSCHAFT UND BÜRGERTUM (Lucian Hölscher) 219 I. Theoretische Vorbemerkungen 219 II. Systematische Begriffsbildungen 220 1. Bürgertum 220 a) Das Stadtbürgertum 220 b) Das Staatsbürgertum 221 c) Bürgertum als soziale Klasse 221 2. Arbeiterschaft und Proletariat 222 3. Religion 225 a) Quantitativer Religionsbegriff 226 b) Qualitativer Religionsbegriff 226 c) Negativer Religionsbegriff 228 III. Zeitgenössische Begriffsbildungen 229 1. Die ‚Religion der Arbeiter‘ und der ‚proletarische Glaube‘ 230 a) Klassengebundene Fremd- und Selbstwahrnehmungen im Kaiserreich 230 b) Die Auflösung des Konzepts ‚proletarischer Religiosität‘ nach dem Zweiten Weltkrieg 234 2. ‚Bürgerliche Religion‘ und ‚bürgerliche Kirche‘ 236 IV. Der Prozess der Entkirchlichung 238 1. Die Frühe Neuzeit 238 2. Das 19. Jahrhundert 240 3. Das 20. Jahrhundert 242 V. Die Kirchengemeinden 245 1. Kirchliches Wahlrecht 245 2. Die soziale Zusammensetzung der Gemeinderäte 247 VI. Religiöse Sozialisationsprozesse 248 1. Familiäre Prägungen 248 2. Die Schule 250 3. Erstkommunion, Konfirmation und sozialistische Jugendweihe 251 4. Die kirchliche Beerdigung 253 VII. Bürgerliche Bildungsreligiosität 255 1. Die neue Religiosität um 1900 255 2. Der Humanismus 257 3. Der Goethekult 259 4. Der George-Kult 261 5. Die Lebensreform 263 GESCHLECHTER (Kornelia Sammet) 267 I. Einleitung 267 II. Geschlecht als (sozial-)wissenschaftliche Analysekategorie 268 1. Von der Frauen- zur Geschlechterforschung 268 2. Soziologische Analyse von Geschlechterverhältnissen 271 III. Geschlechterverhältnisse im 20. Jahrhundert in Deutschland 273 IV. Religion und Geschlechterordnung im 20. Jahrhundert 279 1. Geschlecht in der Organisation Kirche: die Diskussionen um das geistliche Amt der Frau im Protestantismus 279 2. Geschlecht in religiösen Wissenssystemen: die Feministische Theologie 283 3. Doing Gender und Doing Religion: das muslimische Kopftuch 287 V. Resümee 291 GENERATIONEN (Christel Gärtner) 293 I. Einleitung 293 II. Generationen als Indikatoren für sozialen und religiösen Wandel 294 1. Generationenbegriff: Kohorten vs. historische Generationen 294 2. Der Generationenansatz in der Tradition Mannheims und seine Weiterentwicklung 295 3. Das Verhältnis von Generation und Religion 297 III. Die Entstehung der Jugendbewegung aus der ‚Krise der Moderne‘ 299 1. Die gesellschaftliche Ausgangslage des religiösen Wandels: Um- und Aufbrüche um 1900 299 2. Das religiöse Feld und seine generationenprägenden, konfessionellen Besonderheiten 301 a) Protestantismus: Vom Dualismus zur Trias 302 b) Katholizismus: Zwischen Antimodernismus und Reformversuchen 303 IV. Religiöse Zwischengeneration(en) im Nationalsozialismus 308 1. Die Deutschen Christen im Nationalsozialismus: Höhepunkt und Abbruch der nationalprotestantischen Mentalität 309 2. Katholisches Bildungsbürgertum im Nationalsozialismus: Transformation von der bürgerlich-katholischen zur bürgerlichsäkularen Lebensführung 312 3. Der Milieu-Katholizismus im Nationalsozialismus: Weiterführung und Transformation der religiösen Tradition 313 a) Verbands- und Milieukatholizismus: Dogmenglaube und enge Sexualmoral 314 b) Das Verhältnis von Kirchenbindung und Autonomie 316 V. Die Entstehung der 68er-Bewegung in der ‚Krise‘ der 1960er Jahre 318 1. Gesellschaftliche Lage und religiöses Feld: Verlust der Deutungshoheit der christlichen Kirchen und die Selbstdiagnose als säkularisierte Gesellschaft 318 2. Kulturprotestantische Transformation: Bindung an die Kirche, säkulare Sinngebung und Offenheit für ästhetische Transzendenzerfahrung 321 3. Katholische Generationen zwischen autoritativer Vergewisserung und religiöser Individualisierung 324 a) Aggiornamento: Eine katholische Generation im Aufbruch 324 b) Baby-Boomer: Eine sinnkrisenhafte Zwischengeneration 326 c) Generation der religiösen Indifferenz: Auflösung der katholischen Identität 327 VI. DDR: Atheismus und Religionslosigkeit als Normalfall 329 VII. Gegenwärtige Jugendgeneration: individuelle und reflexive Aneignung von religiös-kulturellen Deutungstraditionen 332 1. Westdeutsche Jugendliche 334 2. Ostdeutsche Jugendliche 335 3. Muslimische Jugendliche 336 VIII. Fazit: Transformation eines christlich-konfessionellen Typus 337 Anmerkungen 339 Bildverzeichnis 410 Abkürzungsverzeichnis 411 Literaturverzeichnis 414 Personenregister 486 Sachregister 496 Weitere Titel aus der Reihe Handbuch der Religionsgeschichte im deutschsprachigen Raum |
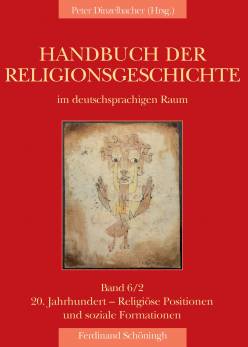
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen