|
|
|
Umschlagtext
Der Doppelband zum 20. Jahrhundert verfolgt gegenüber den anderen Bänden der Reihe einen besonderen, seinem Gegenstand geschuldeten Ansatz: Sozial- und semantikgeschichtliche Aspekte werden in einem wissenssoziologischen Ansatz verbunden, der davon ausgeht, dass sich religiös-soziale Formationen und religiöse Semantiken wechselseitig beeinflussen, ohne doch ineinander aufzugehen.
Denn Religion ist im 20. Jahrhundert mehr denn je ein umstrittener Sachverhalt. Säkularisierung, Individualisierung und Pluralisierung sind zentrale Stichworte, die die Religionsgeschichte des 20. Jahrhunderts kennzeichnen. Um diese Entwicklungen nachzuzeichnen, werden im ersten Band zunächst in der Sektion »Epochen« zeitliche Aspekte, namentlich synchrone Zusammenhänge zwischen religiösen Formationen innerhalb eines Zeitraums behandelt. Die Sektion »Themen« befasst sich schließlich mit den im 20. Jahrhundert bedeutsamsten Kontexten, die entweder selbst explizit religiöser Art sind oder in einem signifikanten Bezug zur Religion stehen. Der zweite Band 6/2 wird »Positionen und Formationen« zum Thema haben. Rezension
Das späte 20. Jhdt. weist deutliche Zeichen der Auflösung traditioneller Sozialformen des Religiösen auf. Religionslehrer/inne/n täte es trotz aller konfessionellen Verengung, die der bundesrepublikanische Religionsunterricht gemäß Art.7GG mit sich bringt, gut, wenn der Blick geweitet würde vom (konfessionellen) Christentum auf alle Arten von Religion. Das gilt umso mehr für die Gegenwart, in der Migration, Multikulturalität, Säkularisierung, Pluralisierung und Individualisierung die religiöse Situation bestimmen. Der hier anzuzeigende Band wendet sich der ganz aktuellen, gegenwärtigen Religiosität im deutschsprachigen Raum zu: das 20. Jahrhundert. Religionsgeschichte darf nicht mit Kirchengeschichte verwechselt werden, - selbst wenn es in dem hier anzuzeigenden Zeitraum des Bands 2 des Handbuch des Religionsgeschichte sich noch um ein sehr homogenes, christlich geprägtes Ganzes im deutschsprachigen Raum handelt. Hier wird nicht Kirchengeschichte nachgezeichnet - und also auch nicht aus einer konfessionellen Perspektive heraus gearbeitet, sondern hier werden religionswissenschaftlich (nicht theologisch) die wesentlichen Züge der jeweils zeittypischen Spiritualität, Frömmigkeit und Volksreligion innerhalb und außerhalb des amtskirchlich vorgegebenen Rahmens aufgezeigt. Die Darstellung kombiniert den historischen mit dem religionsphänomenologischen Zugang. So wird ein Überblick über die Religiosität eines Zeitalters gegeben. Für die Religionsgeschichte bildet das 20. Jahrhundert eine besondere Herausforderung. Zum ersten Mal in der Neuzeit Europas wächst die Zahl derjenigen, die sich keiner Religionsgemeinschaft als Mitglied zurechnen, in einem europäischen Land so stark an, dass sie die größte Bevölkerungsgruppe bilden. zugleich transformiert sich auch der Begriff der Religion sowie sein Gegenstandsbereich. Religion wird nicht mehr ausschließlich den Kirchen und religiösen Kadern der Religionsgemeinschaften zugerechnet, sondern vermehrt auch außerhalb institutioneller Bindungen gelebt und gepflegt.
Thomas Bernhard, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Handbuch der Religionsgeschichte im deutschsprachigen Raum Herausgegeben von Peter Dinzelbacher Eine Religionsgeschichte Deutschland existierte bisher nicht. Sie hat nicht die wohlbekannten Geschicke der Kirchen nachzuzeichnen, sondern die wesentlichen Züge der jeweils zeittypischen Spiritualität, Frömmigkeit und Volksreligion innerhalb und außerhalb des amtskirchlich vorgegebenen Rahmens. Die Darstellung basiert auf der Kombination des historischen mit dem religionsphänomenologischen Zugang: Einerseits wird die Entwicklung der dominierenden Formen der christlichen Religiosität in den einzelnen Epochen bzw. Konfessionen umrissen, andererseits die Hauptmomente ihrer Vermittlung und Manifestationen in ihren jeweils charakterischen Ausdrucksformen vorgestellt. Es geht um Kommunikation religiöser Vorstellungen und Normen durch die Katechese in Wort und Bild, um die Vorstellungswelt (Gott, Engel, Heilige, Dämonen, Tote, Jenseits), um die dominierenden Erlebnisweisen von Religion einschließlich der geschlechsspezifischen, aber auch um die Numinosität der natürlichen und menschengeschaffenen Dinge, des Raumes und der Zeit, um die zahllosen Formen, in denen Frömmigkeit gelebt wurde: Liturgie, Gebet, Wallfahrt, geistliches Spiel, Meditation, und es geht um das Selbstverständnis des Gläubigen als "homo religiosus". Auch die Religiosität des Judentums ist berücksichtigt. Band 1: Altertum und Frühmittelalter. Band 2: Hoch- und Spätmittelalter. Band 3: Reformation. Band 4: 1650 bis 1750 Band 5: 1750 – 1900. Band 6/1: 20. Jahrhundert - Epochen und Themen Band 6/2: 20. Jahrhundert - Positionen und Formationen. Inhaltsverzeichnis
Danksagungen 13
Einleitung (Volkhard Krech, Lucian Hölscher) 14 TEIL I: KONTINUITÄTEN, ÜBERGÄNGE, ZÄSUREN ERSTER WELTKRIEG (Andreas Holzem) 21 I. Kriegslegitimation – ethische Einhegung – Trost und Duldung: Das ambivalente Verhältnis von Christentum und Krieg 21 II. Die ‚Feuertaufe‘: Kriegsreligiosität eines katholischen Soldaten und die Dimensionen einer ‚Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts‘ 25 III. Krieg und Nation: Protestantische und katholische Befindlichkeiten um 1914 28 1. Der nationalreligiöse Diskurs im deutschen Protestantismus 29 2. Der katholische Nationsdiskurs zwischen Kulturkampf und Krieg 35 3. Skizzen einer jüdischen Kriegsdeutung und Resumée 43 IV. Strukturen der Feldseelsorge 46 V. Der Krieg als Missionar 50 VI. Der Krieg und die popularen Kulte: Maria Immaculata, das ‚Heiligste Herz Jesu‘, der kämpfende Erzengel Michael und der ‚Aberglaube‘ 54 VII. Nach dem Krieg 57 ZWISCHENKRIEGSZEIT BIS 1933 (Siegfried Weichlein) 61 I. Das Erbe des Ersten Weltkrieges 61 II. Religionsgemeinschaften und die Revolution von 1918 63 1. Der Protestantismus 64 2. Neuorganisation der protestantischen Landeskirchen 68 3. Der Katholizismus 71 4. Österreich 72 5. Das Judentum 75 III. Religion und Staat 76 IV. Religion und Politik 80 1. Religion und Demokratie 81 2. Katholische Parteien und politisches Wahlverhalten 82 3. Protestantische Parteien und Wahlverhalten 84 V. Religion und Gesellschaft 87 1. Verbandskatholizismus und Verbandsprotestantismus 89 2. Katholischer Aufbruch 93 3. Verbandsprotestantismus 96 4. Kirchliche Bindungen 98 5. Religion und Weltanschauung 101 6. Geschlecht und Religion 102 7. Vagierende Religiosität, Freidenker und Monismus 103 8. Judentum 106 VI. Religion und Zivilgesellschaft im frühen 20. Jahrhundert 110 DRITTES REICH (Christoph Auffarth) 113 I. Eine zweite Geschichte des Dritten Reiches: Gibt es Kontinuitäten? 113 II. Religionsgeschichte des Dritten Reiches: Die Aufgabe 114 III. Eine religionsproduktive Zeit 116 IV. Nationale Eschatologie: Zwischen Apokalypse und chiliastischer Utopie 120 V. Nationale Religion: Völkisch und Christlich 121 VI. Feste, Rituale, Inszenierung: der 9. November 127 VII. Nationalsozialismus im Rahmen von Religion in der Moderne: eine religionswissenschaftliche Perspektive 131 (Antonius Liedhegener) 135 I. Religion im deutschen Sprachraum in der Nachkriegszeit. Der historiographische Ausgangspunkt 135 II. Religion und Kirchen nach dem Nationalsozialismus 138 1. Kirche und Glaube in der ‚Stunde Null‘ 138 2. Die Kirchen im wieder entstehenden öffentlichen Leben: Rechristianisierungsvorstellungen und Interessenpolitik 139 3. Der kurze ‚religiöse Frühling‘ der unmittelbaren Nachkriegsjahre 141 III. Von der ‚Trümmergesellschaft‘ zum ‚Wirtschaftswunder‘. Politik und Religion 142 1. Der Aufstieg der Christdemokratie und die Etablierung westlicher Demokratien. Religion und Parteien in der unmittelbaren Nachkriegszeit 142 2. Religionsfreiheit und kooperative Trennung. Die Regelung des Verhältnisses von Staat und Kirchen 144 3. Die Demokratisierung in der Nachkriegszeit und das katholische Milieu 148 4. Nation und Freiheit: Protestantismus, Demokratie und Parteiensystem 150 5. Die Sozialdemokratie und Religion 152 IV. Kirchlichkeit und Religiosität im Modernisierungsschub der Nachkriegszeit 153 1. Religionszugehörigkeit und religiös-weltanschauliche Vielfalt 153 2. Kirchenbindung und Entkirchlichung in den 1950er Jahren 157 3. Religion im Alltag des Wirtschaftswunders: Konvention und individualisierte Frömmigkeit 161 V. Religion, Öffentlichkeit und Zivilgesellschaft 166 1. Religion und die Entstehung demokratieförderlicher ‚Zivilgesellschaften‘ 166 2. Entkonfessionalisierung und religiöse Vorurteile. Das Verhältnis der Religionen zueinander 169 VI. Mehr Aufbruch und Veränderung als Restauration: Die Modernisierung von Religion, Politik und Zivilgesellschaft in der Nachkriegszeit 173 DIE LANGEN 1960ER JAHRE (Peter J. Bräunlein) 175 I. Der religionsgeschichtliche Problemhorizont 175 1. Die 1960er Jahre: zwischen ‚Kohärenzfiktion‘‚ ‚Reminiszenzgewimmel‘ und ‚Collage‘? 175 2. Die ‚langen‘ 1960er Jahre und das ‚Schlüsseljahr‘ 1968 176 II. Dominante Semantiken der 1960er Historiographie 177 1. ‚Fortschritt‘, ‚Modernisierung‘, ‚Säkularisierung‘ 177 2. ‚Kalter Krieg‘ 182 3. ‚Studenten-Revolte‘, ‚Jugend-Protest‘, ‚Sexuelle Revolution‘ 183 4. ‚Kirchenkrise‘ 188 III. Ereignisgeschichtliches Panorama 189 1. Bürgerrechtsbewegungen 190 2. Frauenemanzipation – Feminismus 191 3. Vietnamkrieg 192 IV. Soziostruktureller Wandel 194 1. Wirtschaftsboom, Babyboom und Pillenknick 194 2. Bruchlinien: Bürgertum, Familie, Ehe, Jugend 195 3. Wohn- und Fernsehkultur 197 V. Transformationsvorgänge der Institution Kirche 198 1. Kirchliche Domänen in Erosionsgefahr: Bekenntnisschule und Jugendpastoral 199 2. Medien kirchlicher Selbstmodernisierung: Enzykliken, Denkschriften, Akademien 201 3. Politisierung und Polarisierung 202 4. Sexualmoral zwischen Pille und Pillenenzyklika 204 5. Radikaltheologien 205 6. Heiligenkult und revolutionärer Kampf 207 7. Zusammenfassung 209 VI. Individualisierung von Religion und Pluralisierung des religiösen Feldes 210 1. Sucher-Generation, Neue Spiritualität und Lesereligion 212 2. LSD als ‚Sakrament‘: Bewusstseinserweiterung und Selbstfindung 215 3. Counter Culture und Heilsversprechen 217 4. Blues- und Beatmessen: Popkultur in der Kirche 218 5. Pluralisierung des religiösen Feldes und die Sektendebatte 219 DER ZEITRAUM VON 1975-1989 (Thomas Mittmann) 221 I. Einleitung 221 II. Der Wandel des religiösen Feldes in der Bundesrepublik Deutschland und im übrigen deutschsprachigen Raum 222 1. Die Entwicklung der christlichen Kirchen in der Bundesrepublik Deutschland 222 2. Neue Akteure im pluralen religiösen Feld 224 3. Institutionalisierungsprozesse innerhalb der ‚Fremd‘ - und‚Weltreligionen‘ 226 4. Konfessionsfreie und Nichtgläubige 229 5. Entwicklungen im religiösen Feld Ostdeutschlands 230 6. Religiöser Wandel in der Schweiz und in Österreich 232 III. Der Wandel im Verhältnis von Religion und Politik in der Bundesrepublik Deutschland 233 1. Kirchenpolitik der Parteien und Parteipolitik der Kirchen 233 2. Innerkirchliche Polarisierungen um das Verhältnis von Religion und Politik 236 3. Die Kirchen als Partner der neuen sozialen Bewegungen 238 IV. Der Einfluss Internationaler Entwicklungen 241 V. Fazit 242 DER ZEITRAUM SEIT 1989 (Jens Schlamelcher) 245 I. Säkularisierung, Pluralisierung, Individualisierung? 246 II. Die Veränderung religiöser Sozialgestalten seit den 1990er Jahren 249 1. Erosion und Emergenz religiöser Gemeinschaften 250 2. Der Trend zur Organisation 252 3. Die Ausbildung religiöser Märkte und die Eventisierung der Religion 253 4. Religion und die digitale Revolution 255 III. Religiöse Semantiken im Spannungsfeld zwischen dogmatischer Konkretisierung und formaler Abstraktion 256 IV. Religion im Interferenzbereich mit anderen gesellschaftlichen Funktionssystemen 259 1. Die Bedeutung wirtschaftlicher Transformationsprozesse für Religion 259 2. Die Veränderungen rechtlicher und politischer Rahmenbedingungen 261 3. Religion und die Massenmedien 262 4. Religion und Wissenschaften 264 5. Religion, Medizin und Psychotheraphie 264 V. Conclusio 265 TEIL II: THEMEN APOKALYPSE UND KATASTROPHE (Nicolai Hannig) 269 I. Begriffshistorische Vorbemerkungen 269 II. Jahrhundertwende 1900 271 III. Die 1920er Jahre 275 IV. Nationalsozialismus 277 V. Nachkriegszeit 280 VI. Bundesrepublik: Die säkularisierte Apokalypse 282 MEDIEN UND RELIGION (Frank Bösch) 285 I.Zugänge der Forschung 286 II. Milieumedien in der Hochmoderne (1870-1930) 290 III. Medien, Kirche und Religion im Nationalsozialismus 296 IV. Kirche und Medien in der DDR 299 V. Stärkung der Kirchen in der frühen Bundesrepublik 302 VI. Public Religions: Kirche, Religion und Medien seit den 1960er Jahren 306 KUNST UND RELIGION (Markus Kleinert, Volkhard Krech und Magnus Schlette) 312 I. Zur Einleitung: Die Frage nach dem Satzbau 312 II. Die Kunstreligion Stefan Georges 315 III. Beethovenkult und politische Religion 320 IV. Reinhold Schneider als Repräsentant christlicher Literatur 323 V. Pop Art als Kritik 326 VI. Ästhetische Transzendenz im Minimalismus 330 VII. Land Art und neue Spiritualität 335 VIII. Schamanismus und Kreuz bei Joseph Beuys 338 IX. Resümee: Systematik und Typologie 341 RELIGIÖSE LEBENSFÜHRUNG IN DER MODERNE. ETHISCHE DISKURSE IM ZENTRUM RELIGIÖSER SELBSTVERSTÄNDIGUNGSDEBATTEN UND KONFLIKTE (Traugott Jähnichen) 346 I. Einleitung 346 II. Zur Bedeutung der Ethik für die Religionskultur 347 1. Das Verständnis von Ethik als Theorie der Lebensführung 347 2. ‚Ethik‘ auf dem Weg zur gesellschaftlichen Orientierungswissenschaft zu Beginn des 20. Jahrhunderts? 348 III. Von der personalen Gesinnungsethik zur religiös motivierten Weltverantwortung – Transformationen der Grundkategorien religiöser Ethiken im 20. Jahrhundert 351 1. Religiöse Ethiken vor 1914 im Spannungsfeld von individueller Gesinnungsethik und Suchbewegungen einer normativ begründeten Kulturethik 351 2. Versuche religiös-ethischer Neubesinnungen im „Zeitalter der Katastrophen“ zwischen den beiden Weltkriegen 354 3. Zwischen Restauration und Neuaufbruch –Zeitdeutungen und christlich-ethische Impulse in der Ära Adenauer 362 4. Von Aufbrüchen und neuer Unübersichtlichkeit –Suchbewegung religiöser Ethik im Spannungsfeld von Weltveränderung und Bewahrung der Schöpfung 366 IV. Öffentliche Ordnung und private Lebensführung als exemplarische Felder religiös-ethischer Diskurse 374 1. Die gemeinsame soziale und politische Verantwortung der Konfessionen und Religionen 374 2. Wachsende Gegensätze und Konflikte der christlichenKonfessionen und der Religionen im Blick auf die private Lebensführung 379 V. Ausblick 387 RECHT UND RELIGION (Sarah J. Jahn) 389 I. Das Verständnis von Religionsfreiheit und Religionsgleichheit in ausgewählten Rechtstexten im deutschsprachigen Raum des 20. Jahrhunderts 390 1. Zum Verständnis von Religionsfreiheit in Rechtstexten kommunitär geprägter Staaten 391 a) Recht und Religion im Dritten Reich: „Die Verfassung von Wei mar ist tot, es lebe die Verfassung von Potsdam.“ 391 b) Das Verständnis von Religionsfreiheit in den Rechtstexten der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) 393 2. Zum Verständnis von Religionsgleichheit in Rechtstexten liberal geprägter Staaten 396 a) Das Verständnis von Religionsgleichheit im Rechtstext der Bundesrepublik Deutschland 397 b) Das Verständnis von Religionsgleichheit in den Rechtstexten der Schweizerischen Eidgenossenschaft 400 c) Das Verständnis von Religionsgleichheit in den Rechtstexten der Republik Österreich 403 II. Zur Verhältnisbestimmung von Religion und Recht im deutschsprachigen Raum des 20. Jahrhunderts: Wenn Recht säkular ist und Religion Recht beansprucht 407 1. Integrationsleistung von Recht 407 2. Integrationsfähigkeit von Religion 410 III. Allgemeine Thesen zu Religion und Recht des 20. Jahrhunderts im deutschsprachigen Raum 412 1. Zur Ver(grund)rechtlichung von Religion 413 2. Zur Ver(walt)rechtlichung von Religion 413 Anmerkungen 415 Bildverzeichnis 511 Abkürzungsverzeichnis 514 Literaturverzeichnis 517 Weitere Titel aus der Reihe Handbuch der Religionsgeschichte im deutschsprachigen Raum |
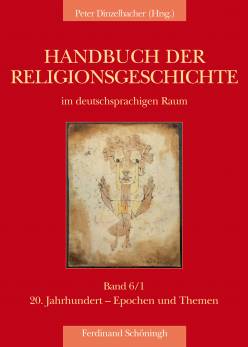
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen