|
|
|
Umschlagtext
Führen die medialen und digitalen Transformationen, wie sie insbesondere in spätmodernen kapitalistischen Gesellschaften in den letzten Jahren in rasanter Geschwindigkeit stattgefunden haben, auch zu fundamentalen Veränderungen kindlichen Lebens und Erlebens? Und falls ja, in welcher Weise und mit welchen Konsequenzen? Obwohl diese Fragen gesellschaftlich wie pädagogisch bedeutsam sind, wurden Veränderungen kindlicher Lebenswelten und Lebenslagen durch Technik in den Folgen für kindliche Subjektivität in der deutschsprachigen Kindheitsforschung bislang wenig untersucht. Das Handbuch gibt einen systematischen Überblick über zentrale Zusammenhänge und die interdisziplinär geführten Diskurse – ausgehend von Analysen zum Verhältnis von Gesellschaftsentwicklung, Technik und Digitalisierungsprozessen über Ergebnisse der Kindheitsforschung bis zu Fragen der Initiierung und Beförderung emanzipatorischer Bildungs- wie Lernprozesse.
Rezension
Digitalisierung ist in aller Munde, gerade auch im Hinblick auf Mediatisierung, Technisierung und Gamification in Bildungsprozessen. Daher ist das umfangreiche Projekt eines Handbuchs zur Digitalisierung mit dem Schwerpunkt auf der Phase der Kindheit und Jugend von vornherein zu begrüßen.
Unter vier Oberthemen (1. Technik und Gesellschaft, 2. Digitalisierung und Mediatisierung von Kindheit, 3. Digitales Konstruieren, Spielen und Handeln und 4. Digitalisierung und digitale Bildung in Institutionen) setzen sich namhafte Expertinnen und Experten mit der Thematik auseinander. Sie gehen etwa der Frage nach, welche Wechselwirkungen Digitalisierung und Demokratie eingehen. Auch die mittlerweile nicht mehr auf die Jugendgeneration bezogene omnipräsente Nutzung von social media wird ausführlich untersucht und beschrieben. Welche Auswirkungen kann das (übermäßige) Spiel mit Shooterspielen für junge Menschen haben? Das für den Schulbetrieb vermutlich wichtigste Kapitel ist das vierte: Hier geht es auch um den Erwerb informatorischer Grundlagen - ein kontrovers diskutiertes Feld, wie Lydia Murmann in ihrem Beitrag zeigt. Inwiefern kann informatorische Fertigkeiten als Beitrag zur technischen Grundbildung junger Menschen verstanden werden? Dem Herausgeberteam gelingt mit diesem Sammelband ein reichhaltiger Überblick, an dem sich sowohl Studierende als auch Lehrkräfte ausführlich bilden können. Für den schulischen Unterricht (etwa in den Fächern Erziehungswissenschaften oder Psychologie) können einige Textabschnitte sicher ebenfalls interessant sein. Exemplarisch sei hier der Beitrag von Sonja Ganguin und Uwe Sander zur Fähigkeit der Medienkritik von Kindern und Jugendlichen genannt (S.309-318). Dieser Text ist sicher für Oberstufenkurse ein interessantes Resümee der gegenwärtigen Forschungslage. Johannes Groß, www.lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Führen die medialen und digitalen Transformationen, wie sie insbesondere in spätmodernen kapitalistischen Gesellschaften in den letzten Jahren in rasanter Geschwindigkeit stattgefunden haben, auch zu fundamentalen Veränderungen kindlichen Lebens und Erlebens? Und falls ja, in welcher Weise und mit welchen Konsequenzen? Obwohl diese Fragen gesellschaftlich wie pädagogisch bedeutsam sind, wurden Veränderungen kindlicher Lebenswelten und Lebenslagen durch Technik in den Folgen für kindliche Subjektivität in der deutschsprachigen Kindheitsforschung bislang wenig untersucht. Das Handbuch gibt einen systematischen Überblick über zentrale Zusammenhänge und die interdisziplinär geführten Diskurse – ausgehend von Analysen zum Verhältnis von Gesellschaftsentwicklung, Technik und Digitalisierungsprozessen über Ergebnisse der Kindheitsforschung bis zu Fragen der Initiierung und Beförderung emanzipatorischer Bildungs- wie Lernprozesse. Die Notwendigkeit des Einsatzes und der Umgang mit Technik wird insbesondere in der frühen Kindheit unterschiedlich bzw. kontrovers diskutiert. Zum einen sollen Kinder Kindermedienangebote nutzen, um erste Wörter, Farben, mathematisches und naturwissenschaftliches Wissen sich anzueignen, wie sie bspw. zur Qualifizierung als Ware Arbeitskraft dienlich erscheint. Technik und deren Nutzung ist demzufolge eine Bildungs-, Erziehungs- und Sozialisationsaufgabe. Zum anderen wird immer wieder der Verlust an „natürlichen“ Erfahrungen durch die Technisierung kindlicher Lebenswelten thematisiert. Kindheit wird in der öffentlichen Wahrnehmung immer noch mit dem Konstrukt „natürlich“ belegt und als Zeit der „magischen Unberührtheit“ idealisiert, möglichst unberührt von Mediennutzung, wie beispielsweise durch Fernseher, Smartphones und Tablets. Es können jedoch gemeinsame Dimensionen in gegenwärtigen Debatten skizziert werden, die sich mit den Begriffen Beschleunigung, Verlust, Selbstverständlichkeit und Vergesellschaftung in neuer Weise umschreiben lassen und Fragen nach Stärkung oder Schwächung von Subjektivität, Handlungskompetenz und politischen Bewusstseins dringlich werden lassen: Was sind die Konsequenzen der medialen und digitalen Transformationen für Kinder und Kindheit? Was sind die sozialen, kulturellen, pädagogischen und politischen Folgen? Welchen Zugang haben Kinder zu Technik und wie verändert die Techniknutzung sie selber, ihre sozialen Beziehungen und sozialen Netzwerke? In welcher Weise werden durch die Techniknutzung neue Differenzkategorien geschaffen (Gender, Familien, Generation, Multikulturalität usw.)? Wie interagieren Kinder mit und in technischen Systemen/Welten? Wie verändern sich Kinder und Kindheit im Kontext der digitalen Transformationen? Was bedeutet eine digitalisierte Kindheit? Welche neuen Zugriffsmöglichkeiten auf kindliche Subjektivität ergeben sich aus der Techniknutzung und welche Widerstandspotentiale (Adorno, Erziehung zur Mündigkeit)? Welche veränderten Konzeptualisierungsansätze von Kindheitspolitik ergeben sich? Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rita Braches-Chyrek/Charlotte Röhner/Jo Moran-Ellis/Heinz Sünker 1. Technik und Gesellschaft Technik als Lebensform. Zur Geschichte technischer Kulturen . . . . . . . Martina Heßler Kinder und Technik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jo Moran-Ellis/Heinz Sünker Erziehung zur Kooperation und zum Mut in der digitalen Epoche . . . Friedhelm Schütte Digitalisierung, Technik, Gesellschaftsform und Bildung . . . . . . . . . . . Heinz Sünker Erklärbarkeit und demokratisches Denken. Eine Annäherung an eine informationelle Öffentlichkeit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . David M. Berry Wirken Digitalisierung und Internet demokratisierend?. . . Marius Melzer Die Familienmaschine. Verbetrieblichte Lebensführung als Subsumption des Lebens unter den Produktionsprozess . . . Stefan Paulus 2. Digitalisierung und Mediatisierung von Kindheit Verwandtschaft und Kindheit im Zeitalter assistierter Reproduktion – Einblicke in die ethnographische Erforschung des doing family . . . . . . . . 139 Konstanze N’Guessan Digitalisierung, Geschlecht und Kindheit – oder: zur Reproduktion des symbolisch-strukturellen Dominanzverhältnisses von Technik und Männlichkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Bianca Prietl Sozialisation im sich verändernden Kulturfeld der Medien und der Massenkommunikation 164 Ben Bachmair Konvergenz, Partizipation, Portabilität Über Kinder und Medien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heinz Hengst Doing Family and Social Media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Claudia Zerle-Elsäßer/Andreas Lange Kinder als Akteure und Akteurinnen in der Fotografie . . . . . . . . . . . . . . . . Julia Gottschalk 3. Digitales Konstruieren, Spielen und Handeln Kindheit, Technik und Spiel aus historischer Perspektive . . . . . . . . . . . . . . Stefan Poser Verstrickt in soziomaterielle Figurationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christina Schachtner Kinder und digitales Spielen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Volker Mehringer „Mein Sohn weiß, das ist alles nur Ketchup.“ Digitale Shooterspiele in der frühen Kindheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Claudia Henrichwark Technik und Technikbeherrschung im PC-Spiel ‚Minecraft‘ . . . . . . . . . . . . . Charlotte Röhner 4. Digitalisierung und digitale Bildung in Institutionen Wie medienkompetent bzw. medienkritisch sollten Kinder sein? . . . . . . . Sonja Ganguin und Uwe Sander Digitalisierung in Kindertageseinrichtungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eva Reichert-Garschhammer Digitale Bildung und Medienbildung im Grundschulunterricht . . . . Thomas Irion Frühe technische und informatorische Bildung im Elementar- und Primarbereich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charlotte Röhner Programmierende Grundschüler*innen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lydia Murmann Technische Dispositive in der Organisierung von Kindheit und Jugend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rita Braches-Chyrek Beobachtung der Beobachteten: Technologie, Schutz und Fürsorge an einem Tag im Leben von Jasmine Rachel Thomson/Ester McGeeney Autor*innen |
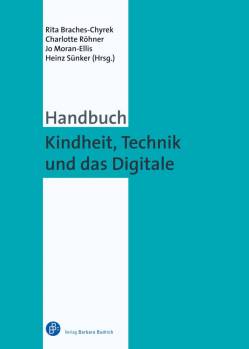
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen