|
|
|
Umschlagtext
Was unterscheidet die für die Erziehungswissenschaft konstitutive Grundkategorie „Erziehung“ noch innerhalb ihrer Theoriesprache? Einerseits scheint es so, als habe sich das Theoriekonzept „Erziehung“ in diesem der „Sozialisation“ aufgelöst. Andererseits stehen hier die normativen Aspekte, von denen noch pädagogische Klärungsmöglichkeiten zu erwarten wären, im Verdacht des Spekulativen. Das Buch erarbeitet die notwendigen geistes-, human- und sozialwissenschaftlichen Theoriegrundlagen, um auf die Frage nach der Güte des Erziehungsbegriffs eine Antwort zu geben. Hierbei werden fallorientierte Diskussionen der Thesen ebenso mit einbezogen, wie über die entwicklungs- und sozialisationstheoretischen Aspekte hinausgehende, anthropologische und kulturtheoretische Theoriezusammenhänge.
Rezension
Kann man heute noch guten Gewissens von "Erziehung" sprechen? Oder ist der Begriff viel zu sehr verbraucht und mißbraucht? Und verbinden sich mit ihm nicht allzu normative Vorstellungen? Und ist der Begriff Erziehung nicht auch viel zu sehr mit einem direktiven, wenig wechselseitigen Pädagogik-Konzept verbunden? Solchen und ähnlichen Fragen wendet sich dieses damit für die Lehrerhand bedeutsamen Buchs zu; es klärt: Was ist Erziehung? (vgl. Kap. 7), unterscheidet zwischen Erziehung und Sozialisation (vgl. Kap. 6) und betont das Selbst im Erziehunsprozess (vgl. Kap. 3), so dass Erziehung nur als Interaktion begriffen werden kann (Titel und vgl. Kap. 2). Das Buch bietet eine Besinnung über eine grundlegende Kategorie, die elementar ist für alle, die in pädagogischen Kontexten tätig sind.
Oliver Neumann, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Was unterscheidet die für die Erziehungswissenschaft konstitutive Grundkategorie „Erziehung“ noch innerhalb ihrer Theoriesprache? Spätestens seit der letzten Jahrhundertwende ist diese Frage nicht mehr zu ignorieren. Das Buch erarbeitet die notwendigen geistes-, human- und sozialwissenschaftlichen Theoriegrundlagen, um darauf eine Antwort zu geben. Inhaltsverzeichnis
Zum Geleit 9
Erster Teil Erziehung als Interaktion Kapitel 1 Problem der theoriesesemantischen Bestimmbarkeit des Erziehungsbegriffs. Eine Skizze 28 1.1 Auflösung eines Theoriebegriffs 30 1.2 Reflexionsblindstellen. Der Erziehungsbegriff zwischen Alltags- und Theoriesprache 32 1.3 Ein Gedankenexperiment 37 Kapitel 2 Erziehung als Interaktion. Ein kategorialer Bestimmungsversuch 40 2.1 Erzieherhandeln, Kommunikation, Interaktion 40 2.2 Interaktion und Kommunikation. Systemtheoretische Zugänge zu einer Differenz 58 2.3 Intelligenz und Ontogenese. Strukturgenetischer Zugänge zu einem Zusammenhang 65 2.4 Exkurs: Daumensaugen als Interaktion? Eine pädagogische Spekulation zum strukturgenetischen Ansatz 72 2.5 Phylogenese und Interaktion. Symbolisch-interaktionistische und anthropologische Perspektiven 81 2.6 Leib und Zeit. Grundkategorien der Interaktionstheorie 90 2.7 Schwierigkeiten mit einem Spielzeug. Über die Kategorien der „Situation" und des „Hiatus" 111 Kapitel 3 Das Selbst im Erziehungsprozess 124 3.1 Selbsttätigkeit und Bildsamkeit. Zur neuhumanistischen Orientierung am Selbst 124 3.2 Eile und Zweckorientierung. Zur pädagogischen Skepsis gegenüber dem Selbst in der Neuzeit 135 3.3 Identität als Balancierungsakt. Möglichkeiten und Grenzen der sozialwissenschaftlichen Theoriesemantik 143 Zweiter Teil Sozialisation und Erziehung Kapitel 4 4 Biografie als sozialer Tatbestand. Zuspitzungen der Problemstruktur in der Moderne 156 4.1 Gelingende Anpassungsleistungen. Zur pädagogischen Bedeutung des Sozialisationsbegriffs 159 4.2 Die Größe des Stoffs. Rekonstruktionen zu den autobiografischen Texten Franz Kafkas und Thomas Bernhards 170 4.3 Verlust von Identität. Zum Begriff der Moderne 184 Kapitel 5 Von der methodischen Sozialisierung zur funktionalen Erziehung. Vorstufen der Sozialisationstheorie 194 5.1 Erziehung als methodische Sozialisierung. Zur Säkularisierung der Erziehung 194 5.2 Die funktionale Erziehung. Zwischen Ertüchtigung, Degenerationsangst und Freisetzung 205 Kapitel 6 Sozialisation und Erziehung. Von den Problemen einer Unterscheidung zum Sinn des Unterschieds 223 6.1 Anpassung als pädagogisches Problem. Zur Migration des Sozialisationsbegriffs in die pädagogische Theoriesprache 223 6.2 Selbstsozialisation. Über eine Art des terminologischen Rollback-Effekts 238 6.3 Autopoiese, Autonomie, (Selbst-)Sozialisation. Eine kleine Kritik der Systemtheorie 249 7 Zuletzt: Was ist Erziehung? 268 7.1 Definition der Erziehung 272 7.2 Lernen in Abhängigkeit von Dritten 275 7.3 Primär-, Sekundär- und Tertiärrahmung der Erziehungssituation. Zur Struktur der Erziehungsinteraktion 277 7.4 Formen: Selbsterziehung, informale und formale Erziehung 280 7.5 Schluss 288 Literatur 290 Weitere Titel aus der Reihe Edition Erziehungswissenschaft |
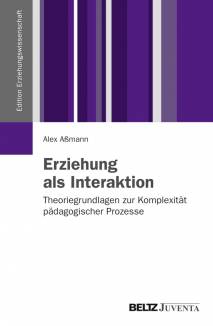
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen