|
|
|
Umschlagtext
Die Welt autistischer Kinder erscheint uns fremd und gleichzeitig faszinierend. Merkwürdige Eigenheiten zeichnen ihr Verhalten aus: sprachliche Stereotypien, Kommunikation ohne Hintergrundverständnis, ein Denken wie aus dem Zusammenhang gerissen, skurrile Interessen und Vorlieben.
Christian Klicpera und Paul Innerhofer vermitteln in ihrem Standardwerk einen Überblick über den aktuellen Stand der Forschung zum frühkindlichen Autismus. Dem Praktiker geben sie einen Leitfaden für Diagnose und Therapie an die Hand. Rezension
Autismus bedeutet das Sich-Zurückziehen eines Kindes, eines Menschen in sich selbst und einen mangelnden Zugang in die reale Welt. Menschen mit autistischer Persönlichkeits-Störung haben kommunikative und soziale Probleme im Umgang mit anderen Menschen; sie sind zu sehr auf sich selbst fixiert (griech.: autos – selbst). Das Phänomen Autismus ist in den vergangenen Jahrzehnten verstärkt in das Bewußtsein der Öffentlichkeit getreten. Auch im Hinblick auf die schulischen Probleme autistischer Kinder ist eine Sensibilisierung eingetreten. Autismus stellt eine tiefgreifende Entwicklungsstörung dar, die im frühen Kindesalter beginnt. Hauptkennzeichen des frühkindlichen Autismus sind die extreme Abkapselung autistischer Kinder von der menschlichen Umgebung sowie ihre panische Angst vor Veränderungen ihrer Umwelt. Sie finden schwer Zugang zu anderen Menschen. Erst im Sommer 2004 hat sich der 16. Weltkongreß für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Berlin dem Thema zugewendet. – Dieses Buch darf als Standardwerk zum frühkindlichen Autismus gelten und bietet einen Überblick über den Stand der Forschung. Es spannt den Bogen von empirischen Befunden über die Diagnostik bis hin zur Therapie. Umfangreiche Register und Literaturhinweise beschließen den informativen Band.
Thomas Bernhard für lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
"Dalia, Chrysanthemen, durch dunkle Wolken scheinen. " - Was klingt wie ein surrealistisches Gedicht, ist einer der Sätze, die der fünfjährige autistische Donald immer wieder vor sich hinmurmelt. Sprachliche Stereotypien sind ein Hauptmerkmal des frühkindlichen Autismus. Aber auch das Sozialverhalten dieser Kinder ist gestört: Sie nehmen selten Blickkontakt auf, gestikulieren wenig, kommunizieren ohne Situations- und Hintergrundverständnis. Ihr Denken scheint wie aus dem Zusammenhang gerissen. Sie entwickeln eigenartige Interessen, sammeln merkwürdige Gegenstände, z. B. Türklinken, oder lassen stundenlang Sand durch die Finger rieseln. Christian Klicpera und Paul Innerhofer geben in diesem Standardwerk einen umfassenden Überblick über den aktuellen Kenntnisstand zum Autismus. Autoreninformation Prof. Dr. med. Dr. phil. Christian Klicpera, Institut für Psychologie an der Universität Wien. Prof. Dr. phil. Paul Innerhofer, ehemals Institut für Psychologie an der Universität Wien. Pressestimmen "Die Autoren vermitteln in ihrem Standardwerk - nach theoretischen Überlegungen sowie der Darstellung und Interpretation empirischer Befunde - breite und tiefgründige Aussagen zur Diagnostik und Behandlung des Autismus. ... Insgesamt gesehen, werden nicht nur Eltern Hinweise zur Einbeziehung in die Therapie des autistischen Kindes aufgezeigt, sondern es finden auch Therapeuten und (Sonder-)Pädagogen tragfähige Ansätze und Anregungen für ihre verantwortungsvolle Arbeit. Den Autoren ist Dank und Anerkennung auszusprechen." Deutsche Behinderten-Zeitschrift Inhaltsverzeichnis
Vorwort zur zweiten Auflage 11
1 Einleitung 13 2 Theoretische Überlegungen26 2.1 Vom Wert einer Theorie26 2.2 Theoretische Anliegen in der Auseinandersetzung mit der autistischen Störung .27 2.3 Das Konzept des Lebenszusammenhangs als Ansatz zum Verstehen der Störung 28 3 Empirische Befunde: Darstellung und Interpretation 30 3.1 Ein Denken wie aus dem Zusammenhang gerissen30 3.1.1 Intelligenz und Intelligenzprofile 30 3.1.2 Spezielle kognitive Fähigkeiten 35 3.1.3 Die kognitive Entwicklung autistischer Kinder nach dem Piaget’schen Modell 37 3.1.4 Gedächtnisleistungen autistischer Kinder42 3.1.5 Sensorische Defizite und Aufmerksamkeitsstörungen bei autistischen Kindern 47 3.1.6 Auffälligkeiten bei der Reizverarbeitung – mangelnde zentrale Kohärenz 52 3.1.7 Entwicklung planvollen Handelns (Ausbildung exekutiver Funktionen) 55 3.1.8 Spielverhalten58 3.2 Kommunikation mit spärlichem Hintergrundverständnis64 3.2.1 Die präverbale Phase und die Anfänge der Sprachentwicklung65 3.2.2 Phonologie und Artikulation 66 3.2.3 Syntax 67 3.2.4 Semantik 69 3.2.5 Intonation 77 3.2.6 Kommunikation 78 3.2.7 Echolalien 83 3.2.8 Interpretation der Befunde zur Sprachentwicklung autistischer Kinder 88 3.3 Ein Sozialverhalten ohne Bild vom Anderen 95 3.3.1 Frühe Auffälligkeiten im Sozialverhalten 95 3.3.2 Eltern-Kind-Interaktion und Bindungsverhalten der Kinder 96 3.3.3 Verhalten gegenüber anderen Kindern 99 3.3.4 Subtypen autistischer Kinder nach der Art des Sozialverhaltens 100 3.3.5 Nonverbale Kommunikation 102 3.3.5.1 Mangelnder gemeinsamer Bezug auf die Umgebung (joint attention) . 102 3.3.5.2 Blickkontakt 104 3.3.5.3 Distanzverhalten 106 3.3.5.4 Gestische Kommunikation 108 3.3.6 Gesichter und Emotionen erkennen – affektiver Ausdruck 112 3.3.7 Soziales Verständnis 122 3.3.8 Welchen Stellenwert haben die Probleme im Sozialverhalten für das Störungsbild des frühkindlichen Autismus? 137 3.4 Auffälligkeiten im Verhalten 144 3.4.1 Stereotypien 144 3.4.2 Selbstverletzendes Verhalten 149 3.4.3 Der Drang zum Aufrechterhalten von Gleichheit und Unverändertheit in der Umgebung: Ritualisierte und zwanghafte Verhaltenselemente 152 3.5 Entwicklungsverlauf der autistischen Störung 157 3.5.1 Die Entwicklung der sozialen Kontaktfähigkeit 161 3.5.2 Die Entwicklung der Sprache 164 3.5.3 Die Entwicklung kognitiver Fähigkeiten 166 3.5.4 Die Entwicklung ritualisierten und zwanghaften Verhaltens . 167 3.5.5 Die Entwicklung aggressiven und selbstverletzenden Verhaltens 168 3.5.6 Affektive Entwicklung 168 3.5.7 Sexualität und sexuelle Schwierigkeiten 169 3.6 Somatische Faktoren in der Genese des frühkindlichen Autismus 173 3.6.1 Genetische Faktoren 173 3.6.2 Prä- und perinatale Risikofaktoren 175 3.6.3 Frühkindlicher Autismus im Rahmen spezifischer Erkrankungen 176 3.6.4 Strukturelle Veränderungen des Zentralnervensystems 180 3.6.5 Neurophysiologische Befunde 182 3.6.6 Neurochemische Hypothesen und Befunde 184 3.6.7 Neuropsychologische Hypothesen 186 3.7 Die Eltern autistischer Kinder 189 3.7.1 Beziehung der Eltern zu ihren autistischen Kindern 191 3.7.2 Auffälligkeiten der Eltern-Kind-Interaktionen 191 3.7.3 Was ist für die Eltern belastend? 192 3.7.4 Folgen für die Familien 194 3.7.5 Besonderheiten der Eltern autistischer Kinder 197 3.7.6 Wie können wir den Eltern wirksam helfen? 200 3.8 Epidemiologie des frühkindlichen Autismus 202 4 Intuitive Informationsverarbeitung – die „Alinguismus“- Theorie 204 4.1 Psychologische Theorien über die autistische Störung . 204 4.2 Die Alinguismustheorie zur Erklärung des frühkindlichen Autismus 209 5 Diagnostik 219 5.1 Die Klassifikationsdiagnostik bei autistischen Kindern 220 5.1.1 Diagnostische Kriterien für das Syndrom des frühkindlichen Autismus 220 5.1.1.1 Die Defintion von Kernsymptomen 221 5.1.1.2 Die Erstellung von diagnostischen Instrumenten zur Erfassung der Kernsymptome 223 5.1.1.3 Die Diagnose der autistischen Störung in den ersten beiden Lebensjahren 226 5.1.2 Der differentialdiagnostische Ansatz 227 5.1.2.1 Differenzierungen innerhalb umfassender Entwicklungsstörungen 228 5.1.2.2 Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen dem frühkindlichen und dem Asperger’schen Autismus 228 5.1.2.3 Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen geistig behinderten und normal intelligenten autistischen Kindern 237 5.1.2.4 Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen geistig behinderten Kindern mit bzw. ohne autistische Störung 239 5.1.2.5 Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen autistischen und dysphatischen Kindern 242 5.1.2.6 Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen frühkindlichem Autismus und Schizophrenie 246 5.1.2.7 Unterschiede zwischen frühkindlichem Autismus und desintegrativer Psychose (Heller’sche Demenz) 249 5.1.2.8 Unterschiede zwischen frühkindlichem Autismus und dem Rett-Syndrom 251 5.2 Therapievorbereitende und -begleitende Diagnostik253 5.2.1 Detaillierte Analyse der Grundlagen von Sprache, Kommunikation und Sozialverhalten 255 5.2.2 Anregungen aus dem theoretischen Verständnis der autistischen Störung für die therapiebegleitende Diagnostik 258 6 Behandlung: Erziehung und Therapie 263 6.1 Hinweise zur Gewinnung von Therapiezielen 263 6.2 Gestaltung des Alltags in Zusammenarbeit mit den Eltern 264 6.2.1 Lernen, mit autistischen Kindern zu leben 267 6.2.2 Beschützende Lebenshilfe für das Kind 268 6.2.3 Gestaltung der Umgebung unter der Rücksicht der Lernerleichterung 269 6.3 Spezielle therapeutische Förderung 271 6.3.1 Aufbau lebenspraktischer Fertigkeiten 272 6.3.2 Aufbau sozialer Verhaltensmuster 273 6.3.3 Aufbau von Kommunikation 283 6.3.3.1 Klassische verhaltenstherapeutische Sprachaufbauprogramme 283 6.3.3.2 Psycholinguistisch orientierte Sprachaufbauprogramme 288 6.3.3.3 Aufbau komplexer Interaktions- und Kommunikationsstrukturen . 296 6.3.3.4 Die Berücksichtigung besonderer Merkmale autistischer Kinder in der Sprachtherapie 297 6.3.3.5 Der Einsatz alternativer Kommunikationsformen 300 6.3.4 Abbau störender Verhaltensweisen 302 6.3.4.1 Behandlung von Stereotypien 303 6.3.4.2 Medikamentöse Behandlung 308 6.4 Förderung von Integration 310 6.5 Einbeziehung der Eltern in die Therapie der autistischen Kinder 314 6.6 Umstrittene Therapieansätze 317 6.6.1 Die Festhaltetherapie 318 6.6.2 Fazilitierte Kommunikation 319 Abschließende Reflexionen 324 Literatur 326 Namenregister 354 Sachregister 359 |
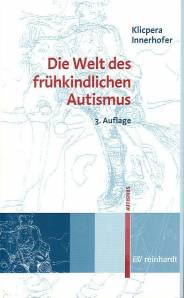
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen