|
|
|
Umschlagtext
Rom stand im 3. Jahrhundert militärisch, politisch, sozial und fiskalisch am Abgrund. Doch hat intensive Forschung der letzten Jahre der Epoche auch ein anderes Gesicht gegeben: Viele der Reformen des tetrarchischen und konstantinischen Zeitalters warfen ihre Schatten weit voraus, die Periode der Soldatenkaiser war alles andere als das Beispiel einer ›Weltkrise‹, sondern vor allem eines Anpassungsprozesses an völlig neue Gegebenheiten. Viele Soldatenkaiser waren nichts weniger als unzivilisierte Haudegen und provinzielle Parvenüs: Sie stellten sich, typisch römisch, traditionsverbunden, und doch innovativ, den Herausforderungen ihres Zeitalters.
Rezension
Im 3. Jhdt. n.Chr. gerät das Römische Reich unter dem severischen Kaiserhaus zunehmend in eine fatale Krise, die nur mehr zwischenzeitlich abgewendet werden kann und schließlich einen Vorboten des Untergangs im 4./5. Jhdts. darstellt. Gleichwohl versuchen Maximinus Thrax und Philippus Arabs (235 – 249), Decius bis Gallienus (249 – 268), Claudius II. Gothicus bis Carus (268 – 283) und schließlich Diokletian und die Tetrarchie (284 – 305) in der Zeit vor der Konstantinischen Wende, mit unterschiedlichen Mitteln und Wegen das Reich zu stabilisieren und zu retten. Die Schrift-Quellen-Lage der Epoche ist relativ schmal, - umso mehr ist die Forschung auf andere Quellen verwiesen, um zu einer historischen Rekonstruktion zu gelangen.
Jens Walter, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
WBG-Preis EUR 9,90 Buchhandelspreis EUR 14,90 Das Römische Reich stand im 3. Jh. n.Chr. am Abgrund: militärisch, politisch, sozial und fiskalisch. War es eine ›Weltkrise‹, die der antike Mittelmeerraum unter den Soldatenkaisern durchlitt? Dieser Band zeichnet die verschiedenen Aspekte nach und versucht sich in einer Deutung: Nicht eine alle Lebensbereiche erfassende Krise erschütterte das römische Weltreich, sondern umwälzende Veränderungen außerhalb des Imperiums erforderten militärische Reaktionen und brachten die alte Prinzipatsordnung ins Wanken. Die ›Soldatenkaiser‹ – viele dieser durchweg vom Heer erhobenen Kaiser waren alles andere als unzivilisierte Haudegen – stellten sich typisch römisch, traditionsverbunden und doch innovativ den Herausforderungen ihres Zeitalters und schufen so ein neues Imperium. Michael Sommer, geb. 1970, ist Lecturer (Classics) an der University of Liverpool und Autor zahlreicher Werke zur antiken Geschichte. Bei der WBG sind von ihm unter anderem erschienen »Die Soldatenkaiser«, »Der römische Orient. Zwischen Mittelmeer und Tigris« sowie zuletzt »Römischer Kaiser. Herrschaft und Alltag«. Rezensionen »Sommer bietet eine gelungene Einführung in die Soldatenkaiserzeit. Unter Auswertung der Ergebnisse der neueren Forschung und Einbeziehung unterschiedlichster Quellen zeichnet der Autor ein lebendiges Bild des Römischen Reiches in dieser Krisenzeit, ohne den Leser mit zu vielen Details zu überfordern. Der flüssig und anschaulich geschriebene Text vermittelt somit einen schnellen Überblick und eignet sich ... hervorragend als Einführung für Studierende.« H-Soz-U-Kult »... ein übersichtliches Bild über eine schwierige Epoche ...« Das Historisch-Politische Buch »Insgesamt ist Sommer eine gute und lesbare Darstellung gelungen, die auch nicht darauf verzichtet, auf Meinungen der Forschung einzugehen. Unterstützt wird die Orientierung für den Leser in dem Buch durch prägnante Marginalien ... eine lesenswerte Einführung zu einer oft vernachlässigten Epoche ... Man wünscht dem Buch eine große Resonanz, die dazu beitragen kann, die Zeit der Soldatenkaiser in schulischen und universitären Kontexten weiter aufzuwerten.« Forum Classicum Inhaltsverzeichnis
Geschichte Kompakt – Antike
Vorwort I. Historische Voraussetzungen 1. Prinzipat 2. Einheit des Mittelmeerraums II. Die Quellen und ihre Probleme 1. Literarische Quellen 2. Inschriften 3. Papyri 4. Münzen 5. Archäologische Quellen III. Die Soldatenkaiser: Das Drama und seine Akteure 1. Vorspiel: Das severische Kaiserhaus 2. Erster Akt: Von Maximinus Thrax bis Philippus Arabs (235 – 249) 3. Zweiter Akt: Von Decius bis Gallienus (249 – 268) 4. Dritter Akt: Von Claudius II. Gothicus bis Carus (268 – 283) 5. Nachspiel: Diokletian und die Tetrarchie (284 – 305) IV. Herausforderuungen: Die alte Ordnung in der Krise 1. Die Grenzen im Westen: Rhein und Donau 2. Ein neuer Nachbar im Osten: Die Sasaniden 3. Usurpation 4. Zwischen Kontinuität und Rezession: Die Wirtschaft V. Antworten: Eine neue Ordnung zeichnet sich ab 1. Militär und Strategie 2. ›Sonderreiche‹: Die Regionalisierung militärischer Verantwortung 3. Innovationen in Wirtschaft und Verwaltung 4. Auf der Suche nach Legitimität: Ansätze zu einer religiösen Fundierung des Kaisertums VI. Bilanz der Epoche Auswahlbibliographie Register Leseprobe Permanentes Krisenmanagement »Noch häufiger, gerade im 3. Jahrhundert, erklärt sich das militärische Handeln der Kaiser aus jeweils aktuellen Notlagen heraus: Gallienus und Postumus unterdrückten lange ihre wechselseitige Rivalität, weil ihre Heere gegen äußere Feinde gebunden waren, die sie für gefährlicher hielten und deren Einbrechen ins Reich unweigerlich neue Usurpationen heraufbeschwören musste; derselbe Gallienus befestigte das Hinterland, stationierte in Mediolanum (Mailand) Reiter und löste sie von den Legionen, weil das System der Grenzverteidigung nicht mehr funktionierte; die Regionalisierung militärischer Verantwortung, ob vom Kaiser veranlasst (Philippus Arabs – Priscus, Valerian – Gallienus), geduldet (Gallienus – Odaenathus) oder dem Kaiser aufgezwungen (Gallienus – Postumus), war keine strategische Grundsatzentscheidung, sondern ergab sich einfach aus der strukturellen Überforderung eines monarchischen Prinzipats, in allen bedrohten Reichsteilen zugleich Kaisernähe zu demonstrieren. Einer kohärenten Strategie stand obendrein allzu oft das ungenügende geographische und ethnographische Wissen der Römer entgegen. Die Informationen, die reisende Kaufleute und vereinzelte militärische Kommandounternehmen tief ins Feindesland von dort nach Rom brachten, reichten bei weitem nicht aus, um eine hinreichend komplexe Vorstellung vom jenseits der römischen ›limites‹ liegenden Barbarenland zu entwickeln. Die Möglichkeiten der politischen Verantwortlichen, nachrichtendienstliche Informationen über ihre Feinde zu erlangen, waren mehr als beschränkt. Das Bild von den römischen Kaisern als weit vorausplanenden Strategen ist also, für das 3. Jahrhundert wie für alle anderen Epochen der Kaisergeschichte, irreführend. Gerade die Soldatenkaiser waren aber durchweg Meister der Improvisation. In militärisch angespannter Lage, während scheinbar alle Dämme brachen, waren sie immer wieder zu unkonventionellem Handeln imstande, das zudem, obwohl zuerst nur als Notmaßnahme ersonnen, wegweisende Lösungen für die Zukunft bot.« Weitere Titel aus der Reihe Geschichte kompakt |
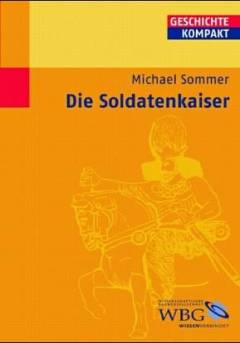
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen