|
|
|
Umschlagtext
Dieses Lehrbuch bietet eine umfassende Einführung in die Literatur der deutschen Aufklärung. Es analysiert die dichtungstheoretische Entwicklung von Gottsched bis Lessing und behandelt die bedeutendsten Werke und Autoren dieser Epoche im Zusammenhang mit den zentralen ideen-, sozial- und mentalitätsgeschichtlichen Strömungen der Zeit zwischen 1730 und 1780.
"[...] sicherlich die derzeit beste und differenzierteste Einführung in die deutsche Aufklärungsliteratur." Literatur in Wissenschaft und Unterricht "Das Buch empfiehlt sich durch Übersichtlichkeit, problembewußte Sachnähe und Darstellungspräzision." Germanistik Rezension
Das Buch bietet einen umfassenden Überblick über die Literaturepoche der Aufklärung. Es werden sowohl Begriffe geklärt, als auch der historische Hintergrund, sämtliche Vertreter und ihre Werke sowie alle Gattungen genau beschrieben. Immer wieder werden Beispiele angeführt, um bestimmte Merkmale nachzuweisen, sodass man alle Argumentationen leicht nachvollziehen kann. Vor allem die zahlreichen, zur Zeit der Aufklärung entstandenen Theorien werden vorgestellt und einfach erklärt.
Dieses Nachschlagewerk ist trotz der sehr wissenschaftlichen Bearbeitung des Themas leicht verständlich und auch als Lexikon gut zu gebrauchen, da die einzelnen Abschnitte kurz gehalten sind, aber dennoch alle wichtigen Details enthalten. Zudem werden wichtige Begriffe und Personennamen mit Fettschrift hervorgehoben. Ein sehr gutes Buch, das alle Aspekte der Aufklärung behandelt und auch die sozialen und kulturellen Hintergründe nicht vernachlässigt. Jana Groh, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Metzler Verlag Eine Einführung in die literarische Epoche der Aufklärung - im geistes- und kulturgeschichtlichen Kontext. Inhaltsverzeichnis
Vorbemerkung IX
I. Ideen- und wirkungsgeschichtliche Aspekte der Epoche 1. Allgemeine Tendenzen 1 Geschichte des Aufklärungsbegriffs 1 Phasengliederung und Periodisierung 7 Hauptströmungen und Leitaspekte 11 2. Entwicklung des frühaufklärerischen Rationalismus Descartes und Leibniz 14 Schulphilosophische Popularisierung: Christian Wolff 18 Empiristische Tendenzen bei Thomasius 21 3. Das neue Weltbild der Naturwissenschaften Grundlagen der kopernikanischen Astronomie 25 Kopernikus-Rezeption in der frühen Neuzeit 28 Durchsetzung des heliozentrischen Weltbildes 32 4. Theologisch-konfessionelle Strömungen Physikotheologie 34 Deismus 36 Neologie 40 Pietismus 41 5. Buchmarkt und Publizistik Entfaltung literarischer Öffentlichkeit 45 Zeitschriftenproduktion seit Beginn des 18. Jahrhunderts 47 6. Forschungsübersicht Methodik der Ideengeschichte 49 Sozialhistorische Perspektiven 51 Gesichtspunkte der mentalitäts- und kulturgeschichtlichen Forschung 55 Fragen der Epochenabgrenzung 58 II. Poetik und Ästhetik 1. Aspekte der Poetik im 17. Jahrhundert Rhetorisches Ordnungsgefüge 60 Nachahmungskonzept 62 Normwandel um 1700 65 2. Gottscheds Normpoetik Grundzüge der Critischen Dichtkunst 68 Mimesistheorie 72 Kategorien poetischer Produktivität 76 Funktion der rhetorischen Regelkunde 78 3. Dichtungstheorie bei Bodmer und Breitinger Frühschriften 80 Begriff des "Wunderbaren" 83 Das Erhabene 86 Poetik Breitingers 88 4. Sensualistische Ästhetik: Baumgarten und Meier Anregungen durch Muratori, Dubos und König 92 Ästhetisches System bie Baumgarten 95 Meiers Wissenschaft des Schönen 99 5. Lessings Grundlegung der Illusionsästhetik Methodische Aspekte 102 Wechselseitige Erhellung der Künste 104 Lehre von den Zeichen 107 Fundierung des Illusionsgedankens 111 6. Forschungsübersicht Ältere Stiltheorie 115 Untersuchungen zum Naturbegriff 118 Neuere Arbeiten zu poetologischen Leitkategorien 121 III. Lyrik und Lehrdichtung 1. Grundzüge der Aufklärungslyrik Zum Lyrikbegriff 126 Entwicklung nach 1700 127 Wandel der Formen 128 2. Brockes und sein Kreis Biographisches 129 Leitmotive des Hauptwerks 131 Naturwissenschaftliche Thematik 134 3. Hallers Lehrgedichte Poesie und Naturforschung 138 Die Alpen 139 Lehrdichtung 143 4. Anakreontische Odendichtung Grundzüge der Gattung 148 Zentrale Topoi 150 5. Klopstocks Oden und Hymnen Aspekte des Gesamtwerks 152 Der Zürchersee 155 Das Landleben 157 6. Forschungsübersicht Studien zum naturwissenschaftlichen Horizont der Aufklärungslyrik 161 Gattungsgeschichte 164 Perspektiven und Desiderate 165 IV. Drama und Theater 1. Drama zwischen Barock und Aufklärung Vom Schultheater zum Kunstdrama 167 Trauerspiel des 17. Jahrhunderts 170 Entwicklung des Lustspiels 174 Barocke Schulbühne 176 Verfall des Dramas um 1700 182 2. Theaterreform seit Gottsched Bühnenpraxis zur Zeit der Frühaufklärung 184 Schlegels Gottsched-Kritik 188 Nationaltheaterbewegung 189 3. Tragödie der frühen Aufklärung Gottscheds Trauerspielkonzept 194 Gottscheds Sterbender Cato als Musterstück 197 Modifikation des klassizistischen Heldentyps bei Schlegel 201 Lessings Philotas 206 4. Das bürgerliche Trauerspiel Begriffsgeschichte 207 Lessings Poetik des Mitleids 212 Miss Sara Sampson als Gattungsparadigma 215 Trauerspieltheorie der Hamburgischen Dramaturgie 218 Das Modell der Emilia Galotti 221 5. Entwicklung der Komödie Aspekte der Typenkomödie 224 Lustspiele des Gottschedkreises 227 Lustspiele in Versen 230 Die rührende Komödie 232 Lessings Lustspiele 234 Nathan der Weise als gattungspoetischer Sonderfall 238 6. Forschungsübersicht Geistesgeschichtliche Strömungen der älteren Tragödienforschung 239 Quellenstudien 239 Sozialhistorische Arbeiten 240 Aktuelle Tendenzen 243 Aspekte der Lustspielforschung 244 V. Fabel, Erzählung und Roman 1. Formen der aufgeklärten Prosa Gattungsgeschichtliche Hintergrüne 247 Konjunktur des Romans 249 2. Wirkungskonzepte der Fabel Historischer Horizont 251 Fabeltheorie 251 Formen der Gattung 258 3. Satire und Erzählung von Gottsched bis Wieland Grundmuster der Aufklärungssatire 260 Abriß der Gattungstheorie 262 Satirische Praxis von Liscow bis Lichtenberg 264 Poetik der Erzählung 268 Differenz der erzählerischen Formtypen 272 4. Roman der Frühaufklärung Theoretische Entwicklung seit Opitz 276 Heideggers Romankritik und ihre Rezeption 278 Schnabels Insel Felsenburg und der frühaufklärerische Roman 281 5. Entwicklung des Romans zwischen 1740 und 1775 Typologie des Aufklärungsromans 286 Rehabilitierung der Gattung 292 Wielands Geschichte des Agathon 294 Theorie des Romans bei Blanckenburg 298 6. Forschungsübersicht Allgemeine Tendenzen der Prosaforschung 302 Studien zum Roman 305 Abschluß und Ausblick Popularphilosophie, Pädagogik und Anthropologie der Spätaufklärung 310 Geschichtsdenken 314 Vollendung der Aufklärung: Geschichtsphilosophie bei Lessing und Herder 316 Bibliographie Zu Kapitel I 321 Zu Kapitel II 326 Zu Kapitel III 329 Zu Kapitel IV 332 Zu Kapitel V 336 Namenregister 340 Weitere Titel aus der Reihe Lehrbuch Germanistik |
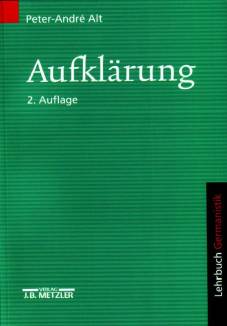
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen