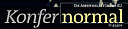
Übersicht Impressum |
200276/02Licht 75/02 Abenteuerland 200165/01Gottesdienst 64/01 Martins Mantel 63/01 Wir sind drin |
|
konfer normal 64/2001 Die Arbeithilfe für den KU Martins MantelGütersloher Verlagshaus - Verlagswebsite besuchen ISSN 1436-946X 2001 28 Seiten, geheftet, 21 x 30 cm 4.95 Euro Bestellen per eMail |
||||
|
Die Idee zu diesem Heft ist uns vor zwei Jahren gekommen. Nach den Herbstferien wollten wir etwas über die Martinsgeschichte mit den Konfirmand/inn/en machen. Zu dem Thema "Martin und der Bettler" gab und gibt es viel Material für Kinder, auch Predigten für Erwachsene; für die Arbeit mit Konfirmand/ inn/en fanden wir so gut wie nichts. Dennoch hatten wir Lust, mit ihnen die Geschichte zu bearbeiten, die seit Jahrhunderten jedes Jahr erzählt wird. Natürlich war uns klar, dass die Geschichte :schon vielen Jugendlichen aus Kindertagen ,bekannt ist. Aber wir sahen in dieser Bekanntheit eine Chance, das Thema Nächstenliebe neu zu bedenken. Uns ist an dieser Geschichte vor allem folgendes wichtig: Auch wenn Menschen schon in größerem Umfang Hilfe geleistet haben als Martin, der einem Bettler die Hälfte seines Mantels schenkt, sehen wir in Martin die Grundhaltung christlicher Nächstenliebe verkörpert: Er nimmt einen Menschen in seiner Bedürftigkeit wahr, geht an seiner Not nicht vorbei und leistet ganz konkret Hilfe. Martins Handeln ist also heute für uns noch ein Beispiel dafür, dass jemand in einer konkreten Situation die erforderliche Hilfe leisten kann. Zentrales Symbol seiner Hilfeleistung ist der Mantel: Schutz gegen Kälte. Martins Mantel bietet in zweierlei Hinsicht Schutz gegen Kälte: Zum einen hat er dem Bettler körperliche Wärme gespendet, und zum anderen wurde auch sein "Herz" erwärmt, indem er menschliche Zuwendung erfahren hat. Deshalb soll der "Mantel" als Symbol für Wärme und Zuwendung, die Menschen einander in zweifachem Sinn geben können (materiell und sozial),in allen Konfirmandenstunden anschaulich präsent sein und ein Impuls für die Jugendlichen, darüber nachzudenken, wie Hilfe in anderen Situationen aussehen kann. Wir haben dabei als inhaltlichen Schwerpunkt den Aspekt materieller Hilfe zurückgestellt zugunsten des Aspektes mitmenschlicher Zuwendung. Denn Themen wie "Obdachlosigkeit", "Straßenkinder", "Hunger in der sog. 3. Welt" werden häufig schon in der Schule behandelt oder im Rahmen von "Brot für die Welt"-Aktionen. Deshalb geht es in dieser Einheit vor allem um Schicksale von Jugendlichen, die an sozialer Kälte leiden und die Zuwendung und emotionale Unterstützung brauchen. Den Konfirmand/ inn/en soll der Blick für diese Jugendlichen geöffnet und sie sollen für deren Probleme sensibilisiert werden. So schauen sie über den eigenen Tellerrand und bleiben nicht nur bei ihren eigenen Bedürfnissen stehen. Viele nehmen auch an solchen Schicksalen Anteil, weil sie Jugendliche, die an sozialer Kälte leiden, bereits in ihrem schulischen Umfeld finden oder weil sie sogar selbst betroffen sind. Dabei ist es einerseits ein Vorteil, dass die Konfirmand/inn/en dicht an diesen Problemen "dran" sind, andererseits birgt es die Gefahr, dass Gefühle aufbrechen können, die in der Unterrichtssituation nicht leicht aufzufangen sind. Unterrichtende brauchen hier viel "Fingerspitzengefühl". Vielleicht gibt es aber auch Konfirmand/inn/en in der Gruppe, die meinen, man könne eh nichts dran ändern, dass es den einen gut geht und den anderen schlecht; dann bietet diese Einheit einen Aufhänger, um wenigstens über solche Auffassungen ins Gespräch zukommen und auf den diakonischen Auftrag der Kirche aufmerksam zu machen. In jedem Fall bietet die Martinsgeschichte Anstoß, Jugendliche für Worte, Gesten und Taten zu sensibilisieren, mit denen sie selbst anderen ein Stück Wärme vermitteln können. So entdecken sie auch ihre eigenen Möglichkeiten zu helfen. Damit möchten wir einen Kontrapunkt setzen zu der Meinung, jeder müsse sehen, wo er bleibe, und an der Not anderer könnten wir eh nichts ändern. Von daher ergeben sich folgende Ziele: Vorstellungen äußern und reflektieren, die Menschen mit den Begriffen"arm" und "reich" verbinden. Die Martinsgeschichte neu kennen sowie "arm" und "reich" als Beschreibungen für Lebensgefühle verstehen lernen. Konfirmand/inn/en anregen, über ihr eigenes Lebensgefühl nachzudenken. Über den Tellerrand eigener Sorgen und Befindlichkeiten schauen und sensibel werden für Jugendliche, die an sozialer Kälte leiden. Von der Martinsgeschichte ausgehend eigene Möglichkeiten zu helfen entdecken. Aufgrund dieser Vorüberlegungen hat sich für uns folgender Aufbau der Einheit ergeben: In der ersten Stunde geht es darum, Gegensätze anhand von Adjektiven wahrzunehmen und zu verstehen, dass eines das andere bedingt: Ich kann z. B. etwas nur als hell beschreiben, weil ich weiß, was dunkel ist. Mit dem in die Mitte gelegten Mantel/Umhang (in zwei Hälften zerschnitten oder durch Tesa Krepp-Band in zwei Hälften geteilt) ist das Thema "Martin" von Anfang an präsent. Durch die Zuordnung der gegensätzlichen Adjektive zu den Hälften "arm" und "reich" wird deutlich, wie in unseren Köpfen Begriffe, mit denen wir Positives verbinden, von uns automatisch der Hälfte "reich" zugeordnet werden und umgekehrt. Dieser Zugang ermöglicht ein neues Wahrnehmen der Martinslegende, die deshalb auch erst nach der Arbeit mit den Gegensatzpaaren erzählt wird. [M112] Ausgehend von den beiden Hauptpersonen der Geschichte und ihrem Lebensgefühl geht es anschließend darum, etwas vom Lebensgefühl der Konfirmand/inn/en wahrzunehmen. Durch die Reflexion der Gegensatzpaare dürfte ihnen das leichter fallen, als wenn sie eigene Worte dafür suchen müssten; und durch das Bedenken ihres eigenen Lebensgefühls dürfte es ihnen nachher auch leichter fallen, sich in die Situation anderer zu versetzen. Die Erstellung von Collagen in Zweiergruppen visualisiert das bis dahin Erarbeitete, stellt es in einen größeren Zusammenhang und dient der Vertiefung. Bei der anschließenden Präsentation können die Konfirmand/inn/en erkennen, dass die Adjektive, die den beiden Mantelhälften zugeordnet wurden, vielfach miteinander vernetzt sind und nicht willkürlich zusammengestellt wurden. In der zweiten Stunde lernen sie nun Schicksale von Jugendlichen kennen [m314], die an sozialer Kälte leiden bzw. auch von solchen, denen es gut geht, obwohl sie ökonomisch arm sind. Vielleicht finden sich manche Konfirmand/inn/en in diesen Lebensgeschichten wieder und können ausgehend von deren Geschichte später auch über "dunkle Gefühle" im eigenen Leben sprechen. Es wird ein Ort geschaffen, wo sie über sich reden können und vielleicht eröffnet sich so ein Gespräch über ihre Defizite und Sehnsüchte. Außerdem können sie in diesen Geschichten aus dem Leben Jugendlicher entdecken, dass Situationen und Lebensgefühl von Menschen sich nicht der strikten Trennung in gut oder schlecht, schwarz oder weiß fügen: Nicht jeder Reiche ist glücklich und nicht jeder Arme sieht sich und sein Leben im Dunkeln. Diese Differenzierung wird dann wieder verknüpft mit der Martinsgeschichte [m5]:Seit Martin zurückgezogener, einfacherlebt und sich um andere sorgt, fühlt er sich reicher als zu der Zeit, in der er an materiellen Dingen keinen Mangel litt. In der dritten Stunde wird an die erste Martinsgeschichte angeknüpft [m2]. Schere und Windjacke erinnern an das Teilen des Umhangs und gleichzeitig kann deutlich werden, dass mit bloßer Imitation in einer neuen Situation keineswegs geholfen ist. Die Jugendlichen, von denen die Geschichten der vorigen Stunde erzählen, brauchen andere Hilfe. Jede Situation erfordert je eigenes Handeln und eigene Wege. Indem die Konfirmand/inn/en Geschichten schreiben, wie "ihrer" Person Hilfe zuteil werden kann, entwickeln sie eigene Phantasie für Worte und Gesten, die anderen Wärme spenden können. Abgeschlossen wird die gesamte Einheit mit einer kreativen Arbeit: Die Jugendlichen basteln ein Schatzkästchen [m6]. Damit kann deutlich werden, dass es beim Helfen um etwas sehr Persönliches geht, das jede/r selbst auf seine/ ihre Weise füllen, umsetzen und verwirklichen muss. Der Zettel im Kästchen ist ihr"Stück vom Mantel", das sie anderen abgeben können. InhaltsverzeichnisEinleitende BemerkungenZeitraster Erste Stunde Zweite Stunde Dritte Stunde Materialteil Material m1 Martin teilt seinen Mantel m2 Martins Geschichte m3 Bild eines traurigen Mädchens m4 Geschichten m5 Bischof von Tours m6 Bastelanleitung --------------------------- Zeitraster 1. Stunde ( 70 - 90 min) 1. Gegensätze wahrnehmen - Spiel ( 5-10 min) 2.Diskussion und Zuordnung der Adjektive zu den den beiden Mantelhälften arm- reich ( 10 min ) 3. Die Geschichte von Martin und dem Bettler ( 10 min ) 4. Unser Lebensgefühl ( 10 - 20 min ) 5. Collagen herstellen ( 30 min ) 2. Stunde ( 70 - 90 min ) 1. Präsentation der Collagen.( 10 -15 min ) 2. Blick über den eigenen Tellerrand ( 30 min ) Überleitung und Geschichten von Jugendlichen und deren Lebensgefühl kennen lernen 3. Präsentation der Lebensgefühle "ihrer Jungendlichen" ( 15 min ) 4. Zuordnung zu den beiden Mantelhälften ( 10 -15 min ) 5. Erzählung von Martin und den Gänsen ( 5 -10 min ) 3. Stunde ( 70 - 90 min ) 1. Wie Hilfe heute aussehen kann ( 5-10 min ) 2."Wie es weiter gehen kann " Fortsetzungsgeschichten schreiben, wie Hilfe aussieht für Jugendliche in ihren Geschichten ( 20 min ) 3. Präsentation der Ergebnisse ( 10 -15 min ) 4. Kreatives Arbeiten :" Mein Schatzkästlein" ( 30 - 40 min ) Leseprobeweitere Informationen über www.konfernormal.de |
|||||
