|
|
|
Umschlagtext
Die Rede vom »Schweigen« der Dramatik und dem restaurativen Impetus des Regietheaters im Nachkriegsdeutschland zählt zu den Gemeinplätzen germanistischer Forschung. Die hier vorgelegte umfassende Bestandsaufnahme unterzieht solche Thesen einer kritischen Revision: Zwischen 1945 und 1961 sind über 500 Zeitstücke unterschiedlichster Inhalte, Tendenzen und Formen nachweisbar. Sie belegen, daß nach dem Zweiten Weltkrieg das Drama neben der Publizistik als Hauptmedium gesellschaftlicher Selbstverständigung fungiert. Auch ein großer Teil der Regie-Avantgarde schreibt die Moderne nachdrücklich fort und leistet damit einen bis heute unterschätzten Beitrag zur Rückkehr des deutschen Theaters in die Weltspitze.
Wolf Gerhard Schmidt hat Germanistik, Musikwissenschaft, Philosophie, Komparatistik an den Universitäten in Saarbrücken, Cambridge (GB) und Frankfurt a.M. studiert. Seit 2004 ist er wissenschaftlicher Assistent an der KU Eichstätt-Ingolstadt, seit 2008 Privatdozent für Neuere deutsche Literaturwissenschaft und Komparatistik. Rezension
Diese Eichstätter Habilitationsschrift ist nicht nur äußerlich von Gewicht ... und es geht letztlich um weitaus mehr als "nur" um eine Geschichte des Dramas in der deutschen Nachkriegszeit ... Man könnte fast behaupten, in der ebenso immens fleißigen (es werden über 500 Dramen unterschiedlichster Inhalte, Tendenzen und Formen zwischen 1945 und 1961 aufgearbeitet) wie subtilen Analyse findet sich exemplarisch auf das Drama bezogen so etwas wie eine Kulturgeschichte Nachkriegsdeutschlands. Der Autor widerspricht also nicht nur der geläufigen theaterwissenschaftlichen These: Der einschlägigen Forschung gilt die Nachkriegsepoche, d.h. die Phase zwischen 1945 und dem Beginn der sechziger Jahre, vor allem mit Blick auf Drama und Theater als »Dürrezeit«. Er geht vielmehr weit darüber hinaus, indem er die These nicht nur widerlegt, sondern im Drama neben der Publizistik das Hauptmedium gesellschaftlicher Selbstverständigung in der Nachkriegszeit wahrnimmt.
Jens Walter, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Fachgebiet: Literaturwissenschaft Umfangreiche Studie zur deutschen Nachkriegsdramatik Das Drama als Hauptmedium gesellschaftlicher Selbstverständigung Das deutsche Nachkriegsdrama neu entdeckt. Die umfangreiche Studie untersucht 500 zwischen 1945 und 1961 entstandene Zeitstücke unterschiedlichster Inhalte, Tendenzen und Formen. Thesen vom „Schweigen“ der Dramatik im Nachkriegsdeutschland werden durch diese Bestandsaufnahme einer kritischen Revision unterzogen. Wolf Gerhard Schmidt, geb. 1973, Studium der Germanistik, Musikwissenschaft, Philosophie und Komparatistik an den Universitäten in Saarbrücken, Cambridge (GB) und Frankfurt a.M., seit 2004 wissenschaftlicher Assistent an der KU Eichstätt-Ingolstadt, seit 2008 Privatdozent für Neuere deutsche Literaturwissenschaft und Komparatistik, seit 2009 Mitglied der `Jungen Akademie` der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina. Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung 1
»Restaurationsepoche«? Zur Neubewertung der Nachkriegszeit 1 – Posthistoire: Das Ende der europäischen Avantgarden 6 – Konservatismus/Innovation in Drama und Theater 11 – Relative Autonomie des deutschen Diskurses 17 – Kulturgeographische Perspektive 19 – Die Frage der Periodisierung 20 – Aufbau und Struktur der Arbeit 25 2. Der Mythos vom »Schweigen des Dramas« 27 Forschungsbericht 27 – Gründe bisheriger Fehleinschätzungen 33 3. Drama und Theater als Medien kollektiver Sinnstiftung 37 »Fiktionsbedürftigkeit« und Formung des »Imaginären« im »Probespielraum« 38 – Applikation auf das vorliegende Projekt 40 – Verhältnis Referenz/Performanz 42 A. Soziokulturelle Ordnungen 45 1. Globalperspektive und Theaterpolitik 47 1.1 »Anstalt der Moral« und Medium der Ideologie(kritik): Die soziokulturelle Funktion von Drama und Theater 47 1.2 Direktiven I: Westliche Besatzer/Bundesrepublik 53 1.3 Direktiven II: Sowjetunion/DDR60 1.3.1 Nachkriegsphase (1945-1949)60 1.3.2 Aufbauphase I: Affirmation (1949-1953) 66 1.3.3 Aufbauphase II: Dialektisierung (1953-1961) 72 2. Topographie und Repertoire 77 2.1 Das Zürcher Schauspielhaus 77 2.2 Das ›Theaterwunder‹ der ersten Nachkriegsjahre 83 2.3 Die Diversifikation der deutschen Bühnenlandschaft 90 3. Medialisierung und Performanz 96 3.1 Integrales Theater: Sinnstiftung im ›Spiel aller möglichen Fälle‹ 96 Systemisch: Pluralität der ästhetischen Konzepte (im Subventionsmodell) 97 – Architektonisch: Dekonstruktion der Guckkastenbühne 100 – Dramaturgisch: Offenhalten verschiedener Textperspektiven 104 3.1.1 Statuarische Expression (Fehling)105 3.1.2 Skeptischer Klassizismus (Gründgens) 110 3.1.3 Instrumentale Choreographie (Sellner/Koch)116 3.1.4 Sonstige (semi)integrale Konzepte127 Hilpert 128 – Schalla 129 – Stroux 130 – Schweikart, Schuh 131 – Barlog 132 – Ruhrfestspiele 133 – Buckwitz 135 3.2 Engagiertes Theater: Provokation durch gegenwartsbezogene Regie 137 3.2.1 »Wahrheit des Ausdrucks« und pazifistische Revolte: Ambivalenzen in Kortners Inszenierungskonzept138 3.2.2 Kritik, Defätismus, Kontrolle: Zur Subversivlogik von Piscators »Bekenntnistheater«145 3.3 Tangentiales Theater: Aktualisierung im Zeichen des Sozialismus 160 3.3.1 Linearer Realismus: Leitfunktion der ›Überaufgabe‹ 162 Stanislawski-System 163 – Klassikerdiskurs 165 – Regietheater: Wangenheim, Heinz, Vallentin, Kayser, Burghardt, Paryla 166 – Abweichung: Hellberg – Versuche einer Repertoire-Ausweitung 169 3.3.2 Vom linearen zum dialektischen Realismus: Langhoffs (Klassiker)Inszenierungen 170 3.3.3 Epischer Realismus: Modellbildung und Adaptionstechnik bei Brecht 177 B. Semantische Ordnungen 187 1. Narrative der Repräsentation 189 1.1 Biologisch-anthropologischer Diskurs: Äquivalenz zwischen Menschheits- und Naturentwicklung189 Krieg als Sintflut (Wilder-Rezeption) 189 – Krieg als Krankheit 190 – Krieg als Kampf der Geschlechter 191 1.2 Historisch-intertextueller Diskurs: Äquivalenz/Diskrepanz zwischen Gegenwart und Vergangenheit 193 1.2.1 Statische Geschichte: Vergleichbarkeit/Wiederholung193 Abstandstheorie 193 – Der ›ewige Krieg‹ (psychologisch, mythisch, ökonomisch, ethisch) 195 – Deutsche Tragödie/Welttragödie: historisch (Postfaschismus), intertextuell (Kain, Faust, Hamlet etc.) 199 1.2.2 Dynamische Geschichte I: Bekenntnis/Peripetie205 Das angebliche Fehlen einer deutschen »Bewältigungsdramatik« 205 – Widerstand/Revolte 206 – Leiden/Schuld 208 – Holocaust-Diskurs: Vierziger Jahre (Boeheim, Müller, Denger, Rohde, Vogel, Geis, Meier) 213 – Fünfziger Jahre (Drewitz, Altendorf, Remarque, Sylvanus, Frank, Andres, Haecker, Harlan u.a.) 217– Wandlung/Heimkehr 226 – Absurdität von Krieg und Subordination 228 1.2.3 Dynamische Geschichte II: Der ›dritte Weg‹ als Lösung weltpolitischer Aporien 229 2. Narrative der Ethik 233 2.1 Deontologischer Diskurs: Gewissen und moral sense 233 2.2 Utilitaristischer Diskurs: Aufbautat und Verantwortung 236 2.3 Agapistischer Diskurs: ›Liebe‹ als Universalprinzip 239 3. Narrative der Transzendenz 241 3.1 Christlich-religiöser Diskurs: Äquivalenz zwischen Menschheits- und Heilsgeschichte 241 Das Dritte Reich als Objektivation biblischer Archetypen: Luzifer, Kain, Judas etc. 242 – Opfertod statt Revolte (Andres, Ahlsen u.a.) 244 – Christentum und Sozialismus 248 3.2 Mythisch-metaphysischer Diskurs: Äquivalenz zwischen irdischer und kosmischer Ordnung249 Mythos versus »Oberflächenwirklichkeit« 250 – diachron: Antikerekurs (Rehberg, Glaeser u.a.) 252 – synchron: Duplizität der Handlungsebenen (Syberberg, Vietta u.a.) 254 4. Narrative des Marxismus 260 4.1 Konvergenzdiskurs 260 4.1.1 Theorie und Wirklichkeit: Sozialistischer Realismus 260 Begriffsgeschichte 261 – Theatrale Politik: Der Staat als Kunstwerk 264 – Kodifizierung I: Lukács’ Modellvorgabe 266 – Kodifizierung II: Die affirmative DDR-Diskussion 268 – Kritik und Ausweitung 272 4.1.2 Geschlecht und Kollektiv: Neuer Mensch 276 Die Frau als sozialistische »Muse« 276 – Der Weg vom »Ich« zum »Wir« 279 4.1.3 Technik und Humanismus: Befreite Arbeit 284 Das Produktionsstück 285 – Pioniertat und sinnstiftendes Opfer 287 4.2 Divergenzdiskurs 289 4.2.1 Negative Geschichte I: Monokapital und Faschismus 289 Totalitarismusthese 289 – Das ›kleine Absurde‹ der bürgerlichen Welt 291 – Frieden und Kampf 295 – Modifikationen im Avantgardebereich 297 4.2.2 Negative Geschichte II: Analyse der Klassengesellschaft (Hacks)298 Das Volksbuch vom Herzog Ernst 299 – Eröffnung des indischen Zeitalters 300 – Die Schlacht bei Lobositz 302 – Der Müller von Sanssouci 304 4.2.3 Positive Geschichte: Aufstände und Revolutionen 308 Abstandstheorie / Wider die ›deutsche Misere‹ 308 – Dramatisierung historischer ›Höhepunkte‹ von der Antike bis zur Gegenwart (Knauth, Wolf, Zinner u.a.) 309 5. Narrative des Absurdismus 316 5.1 Nonsens als Systembegriff 316 5.1.1 Die ›Pariser Avantgarde‹ in Deutschland 316 5.1.2 Sinnlose Revolte und Posthistorismus (Hildesheimer) 320 Theorie des Absurden und Kunstdiskurs 321 – Der Drachenthron 323 – Die Herren der Welt 324 - Spiele in denen es dunkel wird 325 – Der schiefe Turm von Pisa, Das Opfer Helena 327 – Die Verspätung 328 5.2 Nonsens als Grenzphänomen 330 5.2.1 Soziale Apokalypse: Der (deutsche) Bürger 331 Altendorf, Asmodi, Oelschlegel, Waldmann, Dorst, Moers, Hey u.a. 5.2.2 Nukleare Apokalypse: Das zerstörte Genom (Jahnn) 338 6. Problematisierung der Narrative 342 6.1 Repräsentation: Insuffizienz systembildender Ähnlichkeitsbezüge 342 6.1.1 Jenseits des Humanen: Das Groteske, Surreale und Extreme 342 6.1.2 Jenseits der Historie: Politisch-gesellschaftliche Ortlosigkeit 345 6.2 Ethik: Grenzen der Wirksamkeit moralischer Maximen 347 6.2.1 Inkommensurabilität individueller Normgebung 347 Westdiskurs: Extremsituation (Scholz, Weiss u.a.) 348 – Der ›funktionale Mensch‹ (Hubalek, Kästner, Michelsen u.a.) 350 – Ende der Universalmoral (Spoerl, Ahlsen, Andres u.a.) 351 – Ostdiskurs: Triebsubversion (Hacks, Müller, Lange u.a.) 353 6.2.2 Inkommensurabilität kollektiver Machtmechanismen 358 6.3 Transzendenz: Zweifel an Sinn und Wahrheit höherer Ordnungen 360 6.3.1 Aporien christlicher Herrschaft (Schneider) 360 Der Kronprinz 360 – Der große Verzicht 361 – Die Tarnkappe 362 – Der Traum des Eroberers, Zar Alexander, Innozenz und Franziskus 363 – Claudel-Kritik / Das Drama als »Tribunal in apokalyptischem Aspekt« 365 6.3.2 Polyvalenz mythischer Erzählungen 369 Mythos als ab- und anwesendes »Urbild« (Haecker, Lange) 369 – Offenheit des Mythos (Peregrin, Westpfahl) 371 – Manipulation des Mythos (Eschmann, Lintzel) 372 6.4 Marxismus: Skepsis gegenüber dem historischen Fortschritt 374 6.4.1 Deformierte Dialektik I: Oberfläche/Tiefenstruktur (Brecht) 374 Der kaukasische Kreidekreis 374 – Die Tage der Kommune 378 – Turandot oder Der Kongreß der Weißwäscher 385 – Leben des Galilei 389 6.4.2 Deformierte Dialektik II: Hypertrophie (Hacks) 395 »Konvergenztheorie« und Wahrheitspluralismus 395 – Die Sorgen und die Macht 399 – Moritz Tassow 405 6.4.3 Deformierte Dialektik III: Fragmentarisierung (Müller) 410 Teleologie und Inkommensurabilität 410 – Der Lohndrücker 415 – Die Korrektur 418 – Die Umsiedlerin oder Das Leben auf dem Lande 419 6.5 Absurdismus: Nonsens als Katalysator kritischer Sinnstiftung 424 6.5.1 Postnihilismus (Borchert) 425 Die Utopie in der Leerstelle I: Draußen vor der Tür 6.5.2 Postexistentialismus (Grass) 429 Der Sisyphos-Mythos 429 – Hochwasser 430 – Onkel, Onkel 432 – Noch zehn Minuten bis Buffalo / Eine »neue Muse« 433 Die bösen Köche 434 – Zweiundreißig Zähne 435 6.5.3 Postmarxismus (Müller) 435 Die Utopie in der Leerstelle II: Das aporetische Produktionsstück C. Ästhetische Ordnungen 441 1. Der Dramatiker: Zwischen Pontifikat und Identitätsverlust 443 Legitimation der Sonderstellung: religiös (Syberberg u.a.) – ethisch (Weisenborn u.a.) 443 – elitär (Jahnn u.a.) 446 – Der politische Diskurs (Kipphardt u.a.) 448 – Der skeptizistische Diskurs (Dorst u.a.) 451 – Neue Selbstfindung? (Weiss) 453 – Ende des Avantgardismus 454 2. Der Protagonist: Heroe, Invalide, dezentriertes Subjekt 455 3. Gattungstypologie 459 3.1 Tragödie – Tragik – Katharsis: Pluralisierung und Kontrolle 459 »Wiedergeburt der Tragödie« / »Inflation« des Tragik-Begriffs 459 – semantische Dimension der Katharsis: ethisch (Weisenborn, Andres, Piscator) 464 – christlich (Rutenborn, Andres, Ahlsen) 466 – metaphysisch (Vietta, Zuckmayer) 467 – marxistisch (Wolf) 469 – ästhetische Dimension der Katharsis: episch (Brecht, Hacks, Rutenborn, Hermanowski, Hausmann) 470 – transzendental (Borchert, Schneider) 473 – metapoetisch (Weisenborn) 474 3.2 Komödie – Komik I: Differentialdiskurs 475 Probleme der Begriffsbestimmung / Vielfalt der Perspektiven: anthropologisch (Burg, Mostar, Böll, Waldmann, Wittlinger u.a.) 475 – sozialkritisch: Kabarett (Lommer, Neumann), Dramatik (Sauer, Fleisser, Hubalek u.a.) 477 – universalistisch (Brodwin, Vietta, Coubier, Hey u.a.) 480 – defätistisch (Ambesser, Kästner, Asmodi) 485 – anarchistisch (Hacks, Müller) 486 3.3 Komödie – Komik II: Tangentialdiskurs 488 »Tod der Tragödie« / Mediation von Verlachen und Humor 488 – Affirmatives Lustspiel (nicht-systemische Binnenkritik): aristotelisch (Wangenheim, Wolf, Freyer, Lucke, Sakowski, Zinner u.a.), episch (Baierl) 491 – DDR-Satire I (systemische Außenkritik: Knauth, Dudow/Keisch/Tschesno-Hell, Kuhn, Hauser) 494 – Transgressives Lustspiel: DDR-Satire II (latent systemische Binnenkritik: Kipphardt, Knauth) 497 3.4 Die Tragikomödie: Sinnstiftung imModus der Diskrepanz 504 3.5 Aufhebung von Tragödie und Komödie 509 3.5.1 Positiv (Hacks): Das realistische Theaterstück als »Ende« der Kunst 509 3.5.2 Negativ (Ionesco-Rezeption): Darstellung des Abgrunds in der anarchischen »Mitte« 512 4. Dramen- und Theaterkonzepte 516 4.1 Aristotelisch-illusionistische Modelle 516 4.1.1 Vom Antagonismus zur Entscheidung: Die Bühne als »geistiger Kampfplatz« (Wolf) 520 4.1.2 Zwischen Identifikation und Distanz: Theater der »äußersten Konfliktmöglichkeiten« (Kipphardt) 528 4.1.3 Transzendenz und Totalität: Metaphysischer Naturalismus (Zuckmayer) 534 4.1.4 Transzendenz und Diskontinuität: Poetischer Naturalismus (Matusche) 539 4.2 Episch-distanzierende Modelle548 4.2.1 Internationale Vorgaben und deutsche Rezeption 548 Wilders ›Universaltheater‹ 548 – Dramaturgische Umsetzung: ethisch (Pilaczek, Altendorf) – sozialkritisch (Kipphardt, Sylvanus) 551 – transzendent: Claudel-Integration (Andres, Rutenborn, Vietta, Hausmann) 554 – defätistisch: Anouilh-Integration (Lampel, Ambesser, Meier, Wittlinger, Tettenborn) 557 – modernegeschichtliche Einordnung 561 4.2.2 Der späte Brecht: Ästhetik der Dispersion 561 Form- und Strategiepluralismus: Die dritte Werkperiode 561 – Theater der »guten Kausalität« 564 – Zentralbegriff ›Fabel‹: Das Drama als Staat 566 – Neue Dialektik von Identifikation und Verfremdung 570 – Der 17. Juni 1953 und die Folgen 573 – Aporien des Realsozialismus: Das Büsching/Garbe-Fragment 576 4.2.3 Filiation I: Vom Blankvers-Volksstück zum prosaischen »Bilderbogen« (Strittmatter) 581 Katzgraben: Zusammenarbeit mit Brecht 581 – Die Holländerbraut 590 4.2.4 Filiation II und proletarisches Erbe: Experimentelle Nachkriegsdramatik in der DDR591 Agitprop-Renaissance 591 – Didaktisches Theater: affirmativ (Baierl, Keller), transgressiv (Müller, Hacks) 596 – Aufwertung dialektischer Konzepte 600 4.2.5 Filiation III: Brecht-Rezeption in Westdeutschland 602 Existentialistisch (Warsitz) 602 – Sozialkritisch (Weisenborn, Hubalek) 604 – Marxistisch (Harlan) – Defätistisch (Asmodi) 609 – Absurdistisch (Hildesheimer) 611 4.3 Poetisch-performative Modelle 611 Poetisch-surreales Theater (Eliot, Fry, Syberberg) 612 – Absolutes Theater (Vietta, Sachs) 613 – Poetisch-absurdes Theater / Commedia dell’Arte (Tardieu, Ionesco, Beckett, Grass, Hildesheimer, Dorst, Asmodi, Waldmann, Moers, Sellner) 618 – Postdramatische Tendenz versus Integralbildung: perspektivisch (Beckett, Ionesco, Hildesheimer, Grass, Dürrenmatt, Willems), dramaturgisch (Vauthier, Audiberti, Anouilh, Grass, Weiss) 625 4.4 Film-, Hörspiel-, ›ortlose‹ Dramaturgie632 Funktion und Kritik filmischer Verfahren (Zuckmayer, Weiss, Brecht, Müller u.a.) 632 – Hörspieltechnik / ›ortlose‹ Dramaturgie: Perspektiverweiterung (Wilder, Rutenborn, Hausmann u.a.) 635 – Raumästhetik / Lichtregie (Kriwet, Fehling, Piscator u.a.) 636 – »Zentrierung« der Fabel (Weisenborn) 638 – Absolute »Ortlosigkeit« (Hey, Dorst) 640 4.5 Ansätze zum Dokumentarismus 641 Allgemeine Tendenzen 641 – Piscator-Tradition (Weisenborn, Kipphardt) 642 Bibliographie 647 Abkürzungen 649 Siglenverzeichnis 650 Quellen 654 Forschungsliteratur 706 Register und Nachweise Personenregister 759 Dramenregister 781 Abbildungsverzeichnis 799 Leseprobe: »Es ließe sich fraglos ein umfangreiches wissenschaftliches Werk über die Situation des Dramatikers deutscher Sprache nach dem Kriege abfassen. [...] Es ist nicht wahr, daß die Schubkästen leer sind! Es scheint sogar, daß heute viel mehr geschrieben wird als früher. Die meisten Verlage und Bühnenvertriebe können sich nicht retten von Manuskripten!« (Rolf Italiaander, 1951) »Manuskripte deutscher Autoren gibt es genug. Sogar ›Zeitstücke‹. Sie stapeln sich in den dramaturgischen Büros der Intendanten und Bühnenverleger. Und legte nicht das künstlerische Verantwortungsbewußtsein der ›geschäftstüchtigen‹ Dramaturgen einen vorsorglichen Damm zwischen diese Manuskript-Flut und die Öffentlichkeit – vielleicht, daß dann manchem der behenden Kritiker doch das voreilige Wort im Halse steckenbliebe.« (Sabina Lietzmann, 1948) »Der Mensch hat sein Jenseits, das Abstrakte, aufgehoben. Gut, böse, komisch, ernst, ironisch, unwichtig, wichtig. Keine Wertungen mehr. Nichts schließt vom Abenteuer aus. Seine Erlebnisse sind Reihung, Brüche, Unterschiede, Verhältnisse, Strukturen.« (Claus Bremer, 1957) 1. Einleitung Der einschlägigen Forschung gilt die Nachkriegsepoche, d.h. die Phase zwischen 1945 und dem Beginn der sechziger Jahre, vor allem mit Blick auf Drama und Theater als »Dürrezeit«.1 Eine ›Stunde Null‹ habe es nicht gegeben, und die Schubläden seien bis auf ›drei Ausnahmen‹2 leer gewesen. Nach den Staatsgründungen scheint insbesondere der Westen von einer »nahezu alle gesellschaftlichen Bereiche betreffenden ›Restauration‹ « gelähmt,3 was Jost Hermand noch 1998 zu der These veranlaßt, das DDR-System sei dem Adenauer-Staat vorzuziehen, weil es sich zumindest um die Künstler bemüht habe.4 Demgegenüber feiert man die sechziger Jahre als »Jahrzehnt der Veränderungsbewegungen «5 und schlägt ihnen zum Beweis die »Neo-Avantgarde« der vorangegan- 1 Schröder (1994b), S. 151. 2 Zuckmayer: Des Teufels General (1942-1945), Weisenborn: Die Illegalen (1946), Borchert: Draußen vor der Tür (1947). Vgl. hierzu Kapitel 2 (Der Mythos vom »Schweigen des Dramas «). 3 Fischer-Lichte (1993a), S. 393. Dieselbe These begegnet, wie Kiesel (1997) nachgewiesen hat, in fast allen neueren Literaturgeschichten (vgl. S. 16-25). Von Emmerich wird sie noch 2007 affirmiert (S. 425). 4 Vgl. Hermand (1998), S. 383. 5 Schnell (1986), S. 168. Einleitung ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2 genen Dekade zu.6 Mitunter begegnet auch der Versuch, vierziger und fünfziger Jahre in ähnlicher Weise zu separieren. Während die frühe Nachkriegszeit gesellschaftskritisch ausgerichtet sei, zielten die fünfziger Jahre auf poetische Derealisierung mit dem Ziel der Vergangenheitsverdrängung.7 In sozialgeschichtlichen Studien wird der Restaurationsbegriff allerdings schon seit Mitte der siebziger Jahre problematisiert, nicht zuletzt angesichts von Fakten, die dem Befund klar widersprechen: u.a. Entideologisierung der politischen Parteien, Aufbrechen des Konfessionalismus im Kirchenbereich, Unterordnung des Militärs unter eine demokratische Machtinstanz, zunehmende Heterogenität der Kultur durch Westbindung. Helmuth Kiesel hat – beginnend mit Hans- Werner Richter und Walter Dirks – Geschichte, Bedeutung und Strategiewert des Restaurationsbegriffs untersucht und dabei herausgearbeitet, daß der Terminus »nicht nur als factum brutum festgestellt, sondern als raffinierter Verblendungsvorgang ausgegeben « wurde, »was zur Folge hatte, daß jemand, der die Restauration bezweifelte, gleich auch gegen sich selber den Verdacht hegen mußte, ein naives Opfer ihrer reformerischen und modernisierenden Augenwischereien zu sein«. Kiesel schlägt deshalb den Begriff »Restitution« vor als »Erweiterung und Verbesserung« der »Zivil- oder Bürgergesellschaft «.8 Zwar gibt es nach 1945 unübersehbare personelle Kontinuitäten in Industrie, Justiz und Universität, mit deutlichen Abstrichen auch im Dramen- und Theaterbereich (A, 2.2), aber nicht jede Karriere unterm Hakenkreuz führt notwendigerweise zu ideologischer Deformation, wie die Beispiele Fehling, Gründgens und Sellner zeigen. Weshalb – so die nicht unberechtigte Frage Fritz Kortners – sollte der Deutsche »gerade Hitler gegenüber ehrlich gewesen sein«.9 Des weiteren ist die künstlerische Bilanz der Nachkriegszeit keineswegs so mager, wie häufig behauptet wird. Wichtige Autoren, die auch oder sogar vorwiegend Dramen schreiben, beginnen hier ihre literarische Karriere (Heinrich Böll, Tankred Dorst, Günter Grass, Peter Hacks, Wolfgang Hildesheimer, Heinar Kipphardt, Heiner Müller, Peter Weiss) oder entwickeln eigene Konzepte weiter (Bertolt Brecht, Marieluise Fleißer, Nelly Sachs, Friedrich Wolf, Carl Zuckmayer). Ähnliches gilt für den Theaterbereich (Jürgen Fehling, Gustaf Gründgens, Fritz Kortner, Erwin Piscator, Gustav Rudolf Sellner). Bühnenautoren wie Herbert Asmodi, Ernst Wilhelm Eschmann, Hans-Joachim Haecker, Richard Hey, Peter Hirche, Alfred Matusche, Hermann Moers oder Egon Vietta sind darüber hinaus zu Unrecht vernachlässigt worden, und selbst die sich langsam konstituierende »Frauendramatik«10 hat bisher kaum Beachtung gefunden, obwohl gerade sie sich der Vergangenheitsaufarbeitung verschreibt (Ingeborg Drewitz, Elisabeth Flickenschildt, Marie Luise Kaschnitz, Ilse Langner, Hedwig Rohde, Ingeborg Strudthoff). Auch andere Künste erleben in der Nachkriegszeit neue Impulse: 1946 ruft das Internationale Musikinstitut Darmstadt 6 Lehmann (²2001), S. 84. Gegen jede Evidenz konstatiert der Autor: »in den 60er Jahren steht das ›absurde Theater‹ imMittelpunkt des Interesses« (S. 86). Hätte er »60er« durch »50er« ersetzt, stimmte die These. Vgl. B, 5.1 und C, 4.3. 7 Vgl. Balzer (1995b), S. 133 und Trinks (2002), S. 105, 207. 8 Kiesel (1997), S. 14, 43. Vgl. auch ders. (2003), S. 187-189. 9 Kortner: Aller Tage Abend (1959), S. 557. 10 Drewitz: Wege zur Frauendramatik (1955/56), passim. Vgl. C, 4.1. Einleitung ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3 (IMD) die »Internationalen Ferienkurse für Neue Musik« ins Leben,11 1955 der Kasseler Maler und Akademieprofessor Arnold Bode die »documenta«. Seit Ende des 20. Jahrhunderts werden daher vermehrt Sammelbände publiziert, in denen die ›Janusköpfigkeit‹ der Nachkriegsepoche, vor allem der fünfziger Jahre, profiliert ist.12 D.h. man unternimmt den Versuch einer »Rekonstruktion« der »Gemengelagen und Spannungsverhältnisse zwischen Kontinuitätslinien und neuen Elementen einer zuvor noch ungekannten Modernität«.13 Gegenüber dem wiedergewonnenen »Glanz«14 der Wirtschaftswunderzeit scheinen die sechziger Jahre nicht mehr nur Epoche der intellektuellen Emanzipation, sondern auch der ›Reideologisierung‹ oder – wenn man böswillig die Etiketten tauscht – der ›Restauration‹ jener Bipolaritäten, die in der westlichen Nachkriegsavantgarde bereits weitgehend verabschiedet wurden. Es ist sicher richtig, daß die ›Schockwirkung‹ des Dokumentartheaters weniger auf ästhetischer Innovation beruht als dem Aggressionspotential gesellschaftlicher Anklage und Frontenbildung. Nicht ganz grundlos wendet sich Joachim Kaiser 1990 gegen die Verherrlichung »bloßer Schuldzuweisungs-Dramaturgie«,15 und Wolfgang Schneider fordert 2004 sogar, es sei endlich »an der Zeit, die oft gescholtenen fünfziger Jahre zu rehabilitieren« gegenüber dem »Muff der Ideologie und der ›Politisierung‹« der beiden nachfolgenden Dekaden.16 Yaak Karsunke konstatiert 1992 mit Recht, daß der oft geforderte Rekurs auf die zwanziger Jahre, deren Theatermodelle »die Zuschauer zur Veränderung aufrufen«, implizit voraussetzt, »daß die Welt in einem gewünschten Sinn geändert werden kann und daß Methoden und Ziel dieser Veränderung bekannt sind«.17 Vor diesem Hintergrund scheint es problematisch, das poetisch-absurde Theater sozialer Unverbindlichkeit zu zeihen. Für Wolfgang Hildesheimer ist der ästhetisch evozierte Nonsens nichts weniger als »krasser Realismus«, und die Wirklichkeit, deren Darstellung Brecht-Anhänger Henning Rischbieter wünscht,18 lediglich »dramatisiertes Symptom unter einer Vielzahl von dramatisierten Symptomen«.19 Auch Tankred Dorst hinterfragt das Mimesis-Postulat: »Wer sagt mir denn verbindlich, daß unsere alltägliche Welt, so wir wie sie gewöhnt sind und wie sie uns aufgegeben ist, die wirkliche ist, und in welcher Weise ist sie es? Haben wir uns vielleicht bloß an sie gewöhnt? Unterliegen wir vielleicht dem bloßen Sog der Mode, die uns gestern das Existentielle, heute das 11 Man muß kein ausgesprochener Adorno-Adept sein, um darauf hinzuweisen, daß diese Tatsache sowie die Integration zeitgenössischer Kunstmusik durch Sellner (A, 3.1.3) eher Modernitätssigna darstellen als die oft betonte Etablierung der Popkultur. Zur künstlerischen Avantgarde zählen Carl Orff und Ernst Křenek, nicht Elvis Presley oder Mick Jagger. 12 Vgl. u.a. Schildt/Sywottek (1998), S. 4; Bollenbeck/Kaiser (2000), S. 7; Faulstich (2002), S. 8 und Hummel/Nieberle (2004), S. XIIf. Seit 2005 existiert für diesen Zeitraum sogar ein neues Publikationsorgan: Treibhaus. Jahrbuch für die Literatur der fünfziger Jahre (hrsg. von Günter Häntzschel, Ulrike Leuschner und Roland Ulrich). 13 Schildt (2002), S. 11. 14 Vgl. den von Michael Koetzle, Klaus-Jürgen Sembach und Klaus Schölzel herausgegebenen Sammelband Die fünfziger Jahre. Heimat · Glaube · Glanz · Der Stil eines Jahrzehnts (1998). 15 Kaiser (1990), S. 73. 16 Schneider (2004), S. 40. 17 Karsunke (1992), S. 91. 18 Vgl. Rischbieter: Hoffnung für das deutsche Drama? (1962), S. 11f. 19 Hildesheimer: Die Realität selbst ist absurd (1962), S. 8. Einleitung ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4 Gesellschaftliche als einzigen Schlüssel zur Wirklichkeit in die Hand gibt?«20 Solche Äußerungen machen deutlich, daß derjenige, der das Jahr 1945 als »[v]ertane Chance« ansieht,21 damit weniger eine vergangene Literaturperiode kennzeichnet als eine aktuelle ideologische Tendenz. Ihm fehlt, wie Helmut Motekat selbstkritisch konzediert, der zeitliche Abstand, um von eigenen Präferenzen absehen zu können.22 Dies trifft auf fast alle bisherigen Gesamtdarstellungen zu, weshalb Lothar Bossle bereits 1986 in bezug auf die Nachkriegsepoche konstatiert, die »Verschüttungen durch ideologische Einseitigkeiten und Mißverständnisse« seien »mittlerweile von einem katastrophalen Ausmaß «.23 1998 mahnt Klaus von Delft hinsichtlich desselben Zeitraums »eine gründliche Entideologisierung der divergierenden Grundparadigmen« an.24 Fast zwei Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung und dem Ende des Kalten Krieges müßte es möglich sein, das deutsche Nachkriegsdrama unvoreingenommener zu betrachten.25 Dieses Vorhaben ernstnehmen heißt aber auch, die Zuschreibungen keineswegs zu invertieren. Mit anderen Worten: Das DDR-Schauspiel sowie die engagierte westdeutsche Literatur der sechziger Jahre sind nicht deshalb ›vormodern‹, weil sie auf einen politisch-gesellschaftlichen Zweck verpflichtet werden. An die Stelle der Dichotomie von ›Restauration‹ und ›Innovation‹ soll vielmehr die diskursive Analyse ästhetischer Polyvalenz treten. Nun hat sich die Rehabilitierung der fünfziger Jahre bisher jenseits von Drama und Theater vollzogen; keiner der genannten Sammelbände enthält hierzu fundierte Beiträge. Vor allem mit Blick auf das Schauspiel erweist sich die Forschungssituation als defizitär: Die einschlägigen Gesamtdarstellungen berücksichtigen kaum zehn Prozent des tatsächlich Existenten. Auch der Theoriediskurs im Theaterbereich ist weitgehend ignoriert worden. Kritikwürdig scheint daher nicht nur das »ungenaue Lesen« der gegenwärtigen Literatur- und Kulturwissenschaft,26 sondern auch das extrem selektive. Wer meint, man könne zu gesicherten Erkenntnissen gelangen, ohne »›flächendeckende‹ Untersuchungen« vorzunehmen, ja sogar die »Partialität« der Perspektive transzendental auflädt als »Bedingung der Möglichkeit« moderner Forschung, sollte seinen Wissenschaftsbegriff überdenken. Der Hinweis darauf, daß man nie »umfassend« und »vollständig« sein kann,27 ist so obsolet wie wohlfeil, entbindet er doch gleichsam apriori von fundierter Philologie. Aus diesem Grund wundert es nicht, daß die deutsche Nachkriegszeit in entsprechenden Studien peripher behandelt und/oder ästhetisch denunziert wird.28 Bernhard Greiner plädiert daher zu Recht für ein Betrachten der Literatur »nicht im nachträglichen Bestätigen dessen, was sich durchgesetzt hat, sondern 20 Dorst: Die Wirklichkeit auf dem Theater (1962), S. 8. Ähnlich sieht es Richard Hey: »je ›realistischer‹ das Theater heute ist, um so größer der Abstand zur Realität« (Der Sinn des Theaters [1957], S. 86). 21 Kröll (1986), S. 164. 22 Vgl. Motekat (1977), S. 18. 23 Bossle (1986), S. 324. 24 Delft (1998), S. 175. 25 Vgl. U. Heukenkamp (1990b), S. 233-235. 26 Rickes (1999), Titel, passim. 27 Fischer-Lichte (1995), S. 13. 28 Vgl. Fischer-Lichte (1993a), S. 393-398; Lehmann (²2001), S. 84f. und Schalk (2004b), passim. Einleitung ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5 aus einer Perspektive, die in dieser Zeit eröffnet war«.29 Ähnlich sieht es bereits der Regisseur Oscar Fritz Schuh, wenn er 1955 mit Blick auf die deutsche Dramatik der Weimarer Republik konstatiert: »Ich glaube, wenn wir uns heute mit den Werken dieser Zeit wieder auseinandersetzen, so bleibt nicht allzuviel. Ich habe kürzlich versucht, ein Stück von Paul Kornfeld wieder zu lesen oder ›Jenseits‹ von Hasenclever – ich bin nicht über den ersten Akt hinausgekommen. Aber in ihrer Zeit hatten die Stücke ihre Gültigkeit«.30 Sicher ist die Dramatik der zwanziger Jahre dem Nachkriegsschauspiel keinesfalls unterlegen; die Verächter des letzteren sollten allerdings bedenken, daß kein Heimkehrerstück der Zwischenkriegszeit heute noch annähernd so bekannt ist wie Borcherts Draußen vor der Tür (1947). Ungeachtet des Gesagten kann das Ziel der Arbeit nicht darin bestehen, die Stoffmenge von über 500 Dramen quasi in toto analytisch zu bewältigen.31 Die Gefahr, große Paradigmen aus den Augen zu verlieren, wäre kaum mehr zu vermeiden. Deshalb besitzt das Transgressive den interpretativen Vorrang gegenüber dem Affirmativen, ohne daß jenes ausgeschlossen würde. Die vorliegende Abhandlung versteht sich vielmehr als Grundlage weiterer Spezialstudien zum Drama und Theater der Nachkriegszeit. Als dieser zugehörig begreift der Verfasser Stücke, die zwischen 1945 und 1961 geschrieben werden, sowie Dramen, deren Entstehungszeit bis 1945 reicht (Zuckmayer: Des Teufels General) oder die kurz vorher abgeschlossen sind, aber Nachkriegsthemen behandeln (Brecht: Der kaukasische Kreidekreis). Sinn und Zweck der Studie ist jedoch keineswegs nur die philologische Aufarbeitung des deutschen Nachkriegstheaters, sondern auch der Versuch seiner Einordnung in die Geschichte der Moderne und demnach die Neubewertung der Epoche. Selbstverständlich muß ein derartiges Unterfangen die nationalliterarischen Grenzen überschreiten – gerade bei Zeitphasen bzw. Gattungen, die wie wenige andere international gespeist sind. Die ohnehin kaum mehr übersehbare Literatur zum Modernebegriff soll damit aber nicht um ein neues Kapitel erweitert werden. Die zentralen Parameter scheinen bekannt, wobei unklar ist, ob sie zusammen oder nur je einzeln Eigenschaft entsprechend zu klassifizierender Texte sind (Fragmentarisierung, Hybridisierung, Konstruktionismus, Offenheit der Form, Performanz statt Referenz, anti-totalitäre Weltsicht etc.). Hinzu kommt, daß der Begriff nur selten an dramatischen Texten exemplifiziert wird; meist greift man auf narrative Genres zurück (Roman, Erzählung). Auch die Debatte um das Verhältnis zwischen Moderne und Postmoderne erweist sich als so diffus, daß man sie – nicht zuletzt aufgrund inhärenter »Aporien«32 – inzwischen »reizlos« findet.33 Die nachfolgenden Überlegungen bezwecken daher nur bedingt eine Fortsetzung der Diskussion, noch weniger allerdings den Versuch, die Nachkriegsepoche als ›Postmoderne avant la lettre‹ aus tiefem Vergessen gleichsam direkt auf den Platz an der Sonne zu heben. Statt dessen soll gezeigt werden, daß Drama und Theater dieser Zeit, die man bis dato fast nie progressiv eingeschätzt hat, erstaunlich viele der obengenannten Merkmale erfüllen. Helmuth Kiesel ist deshalb zuzustimmen, wenn er mit Blick auf die Nachkriegsepoche von einer »Kontinuität der Moderne« spricht, d.h. von »einer zweiten Moderne, in der die Muster der vorausgehenden, durch das ›Dritte 29 Greiner (1983a), S. 342. Ähnlich sieht es Brockmann (2004), S. 5. 30 Darmstädter Gespräch »Theater« (1955), S. 328. 31 Hör- und Fernsehspiele sind nur integriert, wenn sie Vorlagen zu Dramen bilden. 32 Kiesel (2004), S. 10. 33 Baßler (2007), S. 435. Einleitung ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 6 Reich‹ sistierten Moderne zur Geltung gebracht und fortentwickelt« werden.34 Trotz Persistenz traditionalistischer Schreibweisen bzw. Inszenierungsformen sind Schauspiel und Bühne sogar die Genres, die schneller als Prosa, Architektur oder Film Anschluß an internationale Tendenzen und Diskussionen finden. Bereits 1946 sind zahlreiche Stücke der ausländischen Gegenwartsdramatik auf deutschen Theatern präsent (A, 2.2/ 2.3); nahezu gleichzeitig werden sie produktiv adaptiert – oft epigonal, mitunter aber durchaus eigenständig (C, 4.2.1/4.3). Grundlage des weltanschaulich-ästhetischen Pluralismus ist die These, die gegenwärtige Situation sei mit der am Ende des Ersten Weltkriegs nicht zu vergleichen. Nach Egon Vietta ist man von 1918 »durch einen Abgrund getrennt«,35 und auch Frank Thiess konstatiert »fast mit Schrecken, die geradezu komische Entfernung, die uns von einer Welt trennt, an die so viele allzu unbedenklich wieder anknüpfen möchten«.36 »Stürzte man sich damals«, so Rüdiger Syberberg, »mit Idealismus in allerlei große soziale und kulturelle Utopien, suchte sein Heil in religiösen Zwischenbereichen, oder flüchtete sich endlich auf irgendwelche seeligen Inseln, um in reiner Menschlichkeit seine Tage zu verbringen, so steht der Mensch heute in schrecklicher Nacktheit einer nicht minder entblößten Welt gegenüber«.37 Mit anderen Worten: Die eigene Epoche wird erstmals in der deutschen Literaturgeschichte als dezidiert postideologisch verstanden, und zwar nicht nur angesichts der »Niederlage aller ideologischen Aktionen «,38 sondern auch wegen der »unüberschaubaren Verästelung und Aufspaltung von Ideen und Begriffen«.39 Dies trifft mit Abstrichen selbst auf den engagierten Diskurs zu, der selbstverständlich noch an Narrativen festhält. So konstatiert Brecht um 1945: »Die Welt ist gewiß aus den Fugen, nur durch gewaltige Bewegungen kann alles eingerenkt werden«.40 Ähnlich sehen es Weisenborn und Piscator: Für den Dramatiker lebt man in einer »beispiellosen Zeit,41 für den Regisseur in der »schlimmsten Epoche der Weltgeschichte«.42 Während der affirmative Diskurs beider deutscher Zonen bzw. Staaten die Rückkehr zum Humanismus des 18. Jahrhunderts fordert (A, 1.1/2.1) Schuld- und Wandlungsbekenntnisse inszeniert (B, 1.2.2) oder neobiedermeierlich das Glück gemeinsamen Wiederaufbaus (B, 2.2), setzt sich vor allem im westlichen Avantgardebereich zunehmend die für die Postmoderne konstitutive »anti-totalitäre Option« durch, die Absage an »Einheitswünsche«.43 Das Reden vom »Zerfall der großen Erzählungen«44 kulminiert in Ionescos Diktum vom »Ende der Ideologien«45 (B, 5.1.1). Es überrascht 34 Kiesel (2004), S. 438f. 35 Vietta: Theologie ohne Gott (1946), S. 6. 36 Thiess: Zum Problem der künstlerischen Freiheit (1946), S. 13. 37 Syberberg: Der Mensch im Spiegel des Dramas (1946), S. 47. Siehe auch Buch: Vom Gegenwartsauftrag des Theaters (1946), S. 64; Drews: Für und wider das Zeitstück (1947), S. 99 und Stobbe: Europäisches Theater – deutsche Situation (1947/48), S. 113. Dieselbe Ansicht vertritt Walter Jens 1961 in seiner Deutschen Literatur der Gegenwart (vgl. S. 31). 38 Vietta: Die tragische Gestrigkeit des heutigen Theaters (1951/52), S. 140. 39 Buch: Vom Gegenwartsauftrag des Theaters (1946), S. 75. 40 GBA 22.2, S. 817 (Der Messingkauf). 41 Weisenborn: An die Deutschen Dichter im Ausland (1947), S. 3. 42 PT, S. 442 (Die Bühne als moralische Anstalt in der Prägung dieses Jahrhunderts [1966]). 43 Welsch (1987), S. 5, 33. 44 Lyotard: Das postmoderne Wissen, S. 54. Vgl. auch ebd., S. 16, 112, 122, 175. 45 Ionesco: Habe ich Anti-Theater gemacht? (1961), S. 3. Einleitung ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 7 daher nicht, daß Lyotard den »Übergang« in das postmoderne Zeitalter »Ende der fünfziger Jahre« situiert.46 Tatsächlich hat man bereits hier das Gefühl, »mit Tabu-Attacken in allen Bereichen offene Türen« einzurennen.47 1961 erklärt Richard Hey: Entlarvungen sind überflüssig geworden, da alles längst entlarvt ist, was zu entlarven war: die Bürger, die Generäle, die Arbeiter, die Sprache, die Wissenschaft, sogar die Kunst. Wir wissen, hinter Plüsch lauern ebenso wie hinter Nylon die Triebe, und Ausbeutung, Lüge, Unrecht ist in allen Klassen zu finden. Sofern überhaupt noch Klassen zu finden sind. [...] Alle Dramatiker aber werden davon betroffen, daß die alte Antithese, die sie seit eh und je in Brot gesetzt hat, die Antithese: Individuum – Gemeinschaft abgelöst wird durch die undramatische Verhältnisgleichung Spezialist – Kollektiv (WA, 4).48 Auch Professor Scholz-Babelhaus, Protagonist von Wolfgang Hildesheimers absurdem Theaterstück Die Verspätung (1961), muß schmerzlich erkennen, daß die »Ideologie der Potenzierung, der Innovation, der Überholung und Überwindung«49 an ihr Ende gelangt ist: Alles war erforscht, entdeckt, vom Größten bis zum Kleinsten. Da habe ich Entdeckungen erdacht, mir aus den zehn Fingern gesogen, habe Akademien bestürmt, in dröhnenden Aufsätzen, habe gegen Widersacher gewettert, widerlegt, was ich las, habe Thesen an die Türen der Hochschulen und Institute angeschlagen. Und wissen Sie, was geschah? [...] Alles, was ich in der Qual schlafloser Nächte ersonnen hatte, gab es schon, sowohl das Erdachte als auch das Widerlegte (HT, 421). Ganz ähnlich äußert sich 1983 der französische Soziologe Jean Baudrillard, einer der führenden Theoretiker der Postmoderne: »Alles« ist »schon eingetreten«. »Es ist nichts mehr zu erwarten«, »weder die Realisierung einer revolutionären Utopie« »noch andererseits ein explosives Atomereignis. [...] der Endpunkt liegt schon hinter uns.«50 Bereits Teile der westdeutschen Nachkriegsdramatik, die angeblich ›schweigt‹,51 bekennen sich somit zum Ende der Philosophie, das Maurice Blanchot 1959 in seinem gleichnamigen Aufsatz konstatiert.52 So fordert Hans-Joachim Haecker auf der Basis einer fundamentalen »Skepsis gegenüber den Metaerzählungen«53 das moderne Schauspiel der »illusionslosen«54 Epoche (B, 6.3.2), und auch Tankred Dorst entwirft eine »Dramatik der Absage«, weil »Sicherheit der Wahl« nicht mehr vorhanden sei.55 Hildesheimer antizipiert sogar – zumindest im Theoriediskurs – das »Stay cool«56 postmoderner Weltaneignung, wenn er schreibt, man müsse im Absurden »heimisch« werden, 46 Lyotard: Das postmoderne Wissen, S. 19. Auch der Begriff selbst wird Anfang der sechziger Jahre in der nordamerikanischen Literaturdebatte formiert (vgl. Hoffmann/Hornung/Kunow [1988], S. 21f.). 47 Žmegač (1991), S. 23. 48 Vgl. auch Der Sinn des Theaters (1957), S. 86 (R.H.). 49 Welsch (1987), S. 6. 50 Der Tod der Moderne (1983), S. 103f. 51 Vgl. Schröder (1990), S. 287. 52 Für Derrida mutet Blanchots »Grabgesang« allerdings so »gespenstig« an, daß er nach »Auferstehung « klingt (Marx’ Gespenster, S. 57). 53 Lyotard: Das postmoderne Wissen, S. 14. 54 Haecker: Die Antike und der Autor der Gegenwart (1954/55), S. 154. 55 DS, S. 116f. (Die Bühne ist der absolute Ort [1962]). 56 Hochschild (1977), S. 196. Einleitung ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 8 d.h. den endgültigen Utopieverlust ohne sentimentalische Wehmut betrachten.57 Wie weitreichend diese ›Epochenstimmung‹ ist, zeigt eine Äußerung Erwin Piscators, der trotz allen politischen Impetus in den fünfziger Jahren konzedieren muß: »Ob wir es wollen oder nicht, wir sind relativ geworden. Wir trauen auch gar nicht einem einzigen Urteil, selbst der primitive Mensch tut das nicht«.58 »Wir leben in der Situation des ›Wartens auf Godot‹!«59 Mit dem ›Ende der Ideologien‹ verbindet man demnach die Vorstellung des Posthistoire, die Wolfgang Welsch unverständlicherweise von dem Begriff ›Postmoderne‹ trennt.60 Denn gerade das Gefühl, sich jenseits der Geschichtsteleologie zu befinden, bildet eine wichtige Grundlage für das Anerkennen des Verlusts archimedischer Perspektiven. Dies zeigt paradigmatisch die Avantgarde-Problematik. Nun hat sich die Forschung bisher fast ausnahmslos mit den ›historischen Avantgarden‹ beschäftigt, obwohl auch Ionesco stark an diesem Diskurs partizipiert und 1963 in der Pariser Zeitschrift Théâtre zwischen ihm und Piscator ein Kampf ausbricht um die Deutungshoheit im Modernitätsdiskurs.61 Hinsichtlich der Entwicklung des Phänomens ist dabei folgendes festzuhalten: Das dynamische System konkurrierender Avantgarden, wie es zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit vielfältiger Facettierung entsteht,62 wird in der Nachkriegsepoche dispers. So zählen die »Pariser Theateravantgardisten«63 Beckett, Ionesco, Adamov etc. zu den letzten stilbildenden Künstlern und in gewisser Weise auch zu den radikalsten, weil sie Sinn erstmals umfassend in Frage stellen und tradierte Modelle ad absurdum führen – im Gegensatz zu Brecht, der trotz aller Innovation noch immer »Aristoteliker« bleibt.64 Gleichzeitig erscheint die Pariser Avantgarde als Übergangsbewegung, die sich nachhaltig von ihren Vorläufern unterscheidet – nicht zuletzt durch den Verzicht auf Gruppenidentität. Zwar besitzt Ionescos Cantatrice chauve (1951) noch eine »erwartungsirritierende «, »normbrechende Programmierung«, wie man sie Avantgarden attestiert,65 wenig später wendet sich der Autor jedoch einem integralen Modell zu, das dauerhafte Provokationsästhetik als Irrweg begreift. Denn obwohl Beckett und er mit der aristotelischen Dramaturgie brechen, lassen sie deren Rahmen (Aktaufbau, Einheiten) als veraltetes Korsett stehen – ein Verfahren, das bereits Alfred Jarry in Ubu roi (1896) praktiziert. Wie es kein wirkliches Außen der Welt gibt (Fin de partie, Les chaises), existiert auch kein Anderes der Tradition. Die Wiederholung (En attendant Godot) ersetzt die avantgardistische »Ideologie der Dauerüberholung«,66 wie sie noch Adorno fort- 57 In der Verspätung ist dieser Prozeß allerdings nicht ohne sentimentalische Implikate dargestellt, d.h. die »Sehnsucht nach der verlorenen Erzählung« persistiert (Lyotard: Das postmoderne Wissen, S. 122). Vgl. B, 5.1.2. 58 PT, S. 328 (Erläuterungen zur Aufführung von Biedermann und die Brandstifter [1959]). 59 PT, S. 285 (Meine Räuberinszenierung [1957]). Vgl. A, 3.2.2. 60 Vgl. Welsch (1987), S. 17f. Siehe hierzu die Kritik von Žmegač (1991), S. 24. Auch Gumbrecht denkt Postmoderne und Posthistoire zusammen (vgl. [2003], S. 83 und [2006], S. 32f.). 61 Vgl. Wer ist die Avantgarde? (1963). H. 2, S. 57. 62 Peter Bürgers normative »Theorie der Avantgarde« (1974) ist daher zu Recht wegen ihres Konstruktcharakters kritisiert worden. Vgl. u.a. Boehncke (1976), S. 173f.; Oehler (1976), S. 147 und Hardt (1983), S. 151. 63 Maske und Kothurn 4 (1958). H. 1, S. 1. 64 K.-D. Müller (2000), Titel, passim. Vgl. C, 4.2.2. 65 Plumpe (2001), S. 7. 66 Welsch (1987), S. 7. Vgl. hierzu ausführlich W.G. Schmidt (2009a). Einleitung ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 9 schreibt, wenn er in der Ästhetischen Theorie konstatiert: »Nur das je Fortgeschrittenste hat Chance gegen den Zerfall in der Zeit« (AS 7, 67). Während der fünfziger Jahren wird diese These bereits mit Skepsis betrachtet. Man sieht, daß sich die Halbwertszeit ästhetischer Revolten reduziert, d.h. der Abstand zwischen Innovation und deren Aufhebung in rezeptiv gesicherten Strukturen. »Es dauert keine Generation«, so der Theaterkritiker Paul Ellmar 1953, »und die herausfordernden Neuerer werden in ihren Zielen überrundet von neuen Avantgardisten, und die Alten gliedern sich gelassen ein in die Reihen der biederen Lieferanten des Boulevardtheaters«.67 Es wundert deshalb nicht, daß, als die Pariser Dramatiker zu Beginn der sechziger Jahre an Bedeutung verlieren, mit ihnen auch der Avantgardismus problematisiert wird – u.a. von dem deutschen Dramatiker Gerd Oelschlegel: Sprechen wir es doch aus: die verworrene Hilflosigkeit unseres Kulturbetriebes ist nichts anderes als ein Spiegelbild der gesellschaftlichen Situation. Revolutionen hängen im luftleeren Raum oder rennen offene Türen ein, Avantgardismen werden zu Beifallsempfängern degradiert und setzen spätestens unter den Lobeshymnen der Kritiker Patina an (WA, 4).68 Mit der Sinndestruktion des Absurdismus scheinen auch die letzten Extrempositionen erobert – in semantischer wie ästhetischer Hinsicht. Folge ist der bereits für die gesamte Nachkriegszeit konstitutive Objektivitätsverlust. Hans Magnus Enzensberger muß daher 1962 einräumen, daß »sich kein Standpunkt ausmachen« läßt, »von dem aus zu bestimmen wäre, was Avantgarde ist und was nicht«.69 Im deutschen Drama scheint diese Einschätzung schon früher präsent und wird zudem ohne Bedauern vorgetragen. So parodiert Günter Grass in dem Einakter, den er seiner Blechtrommel (1959) integriert, die Attitüde des Malers Lankes, »ne neue Stilart« zu preisen, die »noch keiner gemacht « hat (GGW 2, 413). Gleiches gilt für den Maler Kotschenreuther, der in dem Stück Noch zehn Minuten bis Buffalo (1957) erklärt: »Ich bin ein Mensch, dessen Uhr um mehrere Jahrhunderte vorgeht. Wer sich mit mir verabredet, kommt unweigerlich zu spät« (GGW 8, 146). Auch in Peter Hirches bisher unbeachtet gebliebenem Schauspiel Die Söhne des Herrn Proteus (1960) wissen die Nachkommen mit den sprechenden Namen Schall und Rauch, daß »keine neue Sprache«, »keine neuen Gefühle« erfunden werden können. Ihr Leitspruch lautet deshalb: »Wir wiederholen das Alte« »Ohne Erschöpfung / – Ohne Enttäuschung« (123, 137). Dieser These korreliert die Ansicht Octavio Paz’, die »Avantgarde von 1967« sei im Grunde keine mehr, weil sie nur »die Taten und Gesten derjenigen von 1917« wiederhole.70 Edgar Lohner muß 1976 sogar einräumen: »In der Gegenwart weiß niemand mehr, wo die Avantgarde zu suchen ist«.71 Es hat somit durchaus Sinn, die Epoche der Avantgarden, wie ein belgisches Forschungsteam unter Leitung von Jean Weisgerber vorschlägt, auf die Zeit zwischen 67 Ellmar: Das französische Avantgardetheater (1953/54), S. 49. 68 Carl Zuckmayer bekennt sich vor diesem Hintergrund dazu, »nichts dagegen« zu haben, »für einen Narren oder Arrièregardisten gehalten zu werden«. »Arrière [sic!] ist nicht schlecht, denn ich weiß, wie rasch die Kolonne kehrtmacht, dann ist man wieder vorne« (Bienek: Werkstattgespräche mit Schriftstellern, S. 204). 69 Enzensberger: Die Aporien der Avantgarde (1962), S. 300. Ähnlich sieht es Arnold Gehlen (vgl. Zeit-Bilder [1960], S. 222). 70 Paz: Essays 2, S. 329 (Baudelaire als Kunstkritiker [1967]). 71 Lohner (1976), S. 121. Einleitung ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 10 1905/10 und 1960/65 zu begrenzen.72 Tatsächlich erweist sich das poetisch-absurde Theater, zu dem auch einige der zitierten deutschen Vertreter gehören, bereits als eine Art »Trans-Avantgarde«,73 denn es suspendiert das bis dato »untrennbare Bündnis zwischen Revolution und Kunst«, d.h. die »Gleichsetzung von politischen [sic!] und künstlerischem Fortschritt«.74 In der Tat trennt Ionesco beide Bereiche, indem er der Kunst – anders als der Philosophie – einen postideologischen Status zuspricht (B, 5.1.1) und gleichzeitig den Avantgarde-Begriff pluralisiert: »En réalité, tous les courants littéraires font partie de l’avant-garde au moment où ils surgissent, avant d’être récupérés et digérés par la culture qu’ils ont aidé[e] à promouvoir«.75 ›Literatur‹ erscheint hier als komplexes System ästhetischen Fortschritts, dem alle Strömungen und Gruppen angehören, die auf je eigene Weise bestehende Ordnungen übertreten, bevor sie ihrerseits Teil der Tradition werden. Diese Sehweise trifft besonders für die Nachkriegszeit zu, in der auf deutscher wie internationaler Ebene eine Vielzahl unterschiedlicher Theaterkonzepte präsent sind. Nach Friedrich Dürrenmatt gibt es »nur noch Dramaturgien und keine Dramaturgie mehr«,76 Oscar Fritz Schuh spricht vom »Ausverkauf der Stile« »nach 1945« (TiG, 90), und Kurt Hirschfeld konstatiert »so viele Stilrichtungen, wie es Dramatiker gibt« (114). Wahrhaftig ist im Schauspielbereich kaum es etwas denkbar, das mit Kriegsende nicht übernommen, aktualisiert oder neu entwickelt wird.77 Ernst Wilhelm Eschmann bezeichnet die Nachkriegszeit aus diesem Grund als »Epoche der mehrfachen Betrachtungsweisen «,78 und für Helmut Schelsky existieren »so viel Wahrheiten« wie »Theorien «.79 Nach Ansicht von Walter Jens ist »›Diskontinuität‹« daher das wesentliche Charakteristikum der Gegenwart. Man finde »keine verpflichtende Grundposition, kein[en] -ismus im Thematischen«.80 Ähnlich sieht es Arnold Hauser, wenn er 1953 die »Gleichzeitigkeitsstimmung« des »heutigen Menschen« betont. Dieser erlebe alles »im Nebeneinander, in der Verbundenheit und Verschränktheit der Dinge und Vorgänge«.81 Auch Arnold Gehlen versteht den Synkretismus der »zahllose[n] ›Standpunkte‹«, die »niemand mehr« aufregen, als Hauptsignatur der Kunst.82 Die fünfziger Jahre weisen damit Parallelen zu den achtzigern auf, mit denen sie im Positiven wie Negativen zuweilen verglichen werden.83 Während Werner Faulstich den ersten Teil der Kohl-Ära wieder mit dem Begriff »Restauration« versieht,84 spricht Jürgen Habermas von »neu- 72 Vgl. Hardt (1983), S. 147. Klaus von Beyme (2005) nimmt eine ähnliche Eingrenzung vor: »ca. 1905-1955« (S. 24). 73 Borchmeyer (1991), S. 118. Die Bezeichnung wird Anfang der achtziger Jahre von dem italienischen Kunsthistoriker Achille Bonito Oliva geprägt (vgl. Im Labyrinth der Kunst, S. 54). 74 Lohner (1976), S. 117. 75 Entretien avec Eugène Ionesco (1976), S. 9. 76 Dürrenmatt: Theater-Schriften und Reden, S. 102 (Theaterprobleme [1955]). 77 Vgl. die verschiedenen Kapitel in Teil B bzw. C der vorliegenden Arbeit. 78 Eschmann: Von Schauspielern und anderem (1951/52), S. 33. 79 Schelsky: Die Bedeutung des Klassenbegriffes für die Analyse unserer Gesellschaft (1961), S. 368. 80 Jens: Deutsche Literatur der Gegenwart (1961), S. 64, 21. 81 Hauser: Sozialgeschichte der Kunst und Literatur, S. 500. 82 Gehlen: Zeit-Bilder (1960), S. 203. 83 Vgl. Podiumsdiskussion (1990), S. 299 (Helmut Mörchen); Hauck (1995), S. 111 und Kiesel (2003), S. 186. 84 Faulstich (2005), S. 10. Einleitung ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 11 e[r] Unübersichtlichkeit«.85 Frauke Langguth und Jan Weirauch erkennen ebenfalls ein »Mosaik aus lauter Gegensätzen«.86 Es ist sicher kein Zufall, daß die postmodernen Philosopheme, die Mitte der fünfziger Jahre an Kontur gewinnen, erst zwei Dekaden später breit rezipiert werden. Angesichts der Vielfalt an Narrativen und Dramaturgien wird der Begriff ›Avantgarde‹ im Rahmen der vorliegenden Arbeit funktional verstanden. Es scheint geboten, für verschiedene Diskurse ›Vorreiterinstanzen‹ zu postulieren, die eine Metaerzählung oder Gattungskonzeption an die Grenzen führen, während andere sie lediglich bestätigen. Die Trennung von Avantgarde und zeitgenössischer Moderne ist demnach – auch im Rekurs auf Ionescos Definition – kaum sinnvoll.87 Dies bedeutet jedoch, daß es auch im Sozialismus ›Avantgarden‹ gibt (u.a. Brecht, Hacks, Müller), deren Existenz von der marxistischen Forschung erst 1979 anerkannt wurde.88 Eine Kunst, die zumindest in der Theorie dieselbe Ausrichtung hat wie das Gemeinwesen, muß sich gegenüber dem gesellschaftlichen Status nur sehr bedingt als experimentell und innovativ erweisen. Der Dramatiker Herbert Keller schlägt daher vor, den Begriff »modern« durch »sozialistisch « zu ersetzen,89 denn – so ein DDR-Autorenkollektiv – »neuer als wir kann kein Pseudoavantgardist sein«.90 Die Innovation beschränkt sich allerdings meist auf den semantischen Bereich. Dahinter steht die Vorstellung, »der Abgrund« von 1945 könne »nur durch neuen Inhalt, durch neue Substanz gefüllt werden«.91 Einige Sinnstiftungsmodelle sind im folgenden mit Termini aus der Mathematik versehen: u.a. »integrales« bzw. »tangentiales Theater« (A, 3.1/3.3) sowie »Differentialkomik « (C, 3.2). Dies hat zwei Gründe: Einerseits lassen sich die Phänomene (wie zu zeigen sein wird) auf diese Weise adäquater beschreiben. Nicht von ungefähr greifen Adorno und Iser in anderen Kontexten ebenfalls auf den Integral- und/oder Differential- Begriff zurück.92 Auch der Ausdruck »Tangente[]« begegnet in einer Publikation zum DDR-Theater.93 Andererseits ist die Bezugnahme auf mathematische Termini Teil des zeitgenössischen Diskurses. So projektiert Dürrenmatt eine »Dramaturgie aller möglichen Fälle« als Äquivalent einer »Geometrie«, die »alle möglichen Dimensionen einschließt «.94 Das Erdenken konstruierter Welten schafft gleichsam den geordneten Gegenpol zu einer Realität, die man für dispers und chaotisch hält (B, 6.2.2). Ähnliches gilt mit Blick auf die Anthropologie: Der Mensch scheint nämlich ebensowenig bere- 85 Habermas: Die neue Unübersichtlichkeit (1985), Titel, S. 139-163. 86 Langguth/Weirauch (1999), S. 7. Glaubt man Gumbrecht (2003), so ist auch das beginnende 21. Jahrhundert eine »›Gegenwart der Simultaneitäten‹« (S. 82). 87 Dies gilt nicht für die von Becker/Kiesel (2007) zu Recht vorgenommene Unterscheidung zwischen Avantgardismus und klassischer Moderne (vgl. S. 25-29). 88 Vgl. Barck/Schlenstedt/Thierse (1979), S. 18. 89 Keller: Versuch einer Vorbemerkung (1958), S. 65. 90 [Wolf/Hauptmann/Kaiser/Roscher:] Die literarische Hauptaufgabe (1959), S. 3. 91 DD, S. 20 (Herbert Ihering: 1932 oder 1946?). 92 Vgl. u.a. AS 7, S. 260 (Ästhetische Theorie), AS 16, S. 555 (Wagners Aktualität) sowie Iser: Das Fiktive und das Imaginäre, S. 16. 93 Pfelling (1972b), S. 329. Er ist zudem Teil des zeitgenössischen Realismus-Diskurses (vgl. Strittmatter: Notizen vom Schriftstellerkongreß in Moskau [1959], S. 10). Die Begriffe »Integral «, »Differential« und »Tangential« werden in den betreffenden Kapiteln von Teil A bzw. C genau definiert. 94 Dürrenmatt: Theater-Schriften und Reden, S. 102 (Theaterprobleme [1955]). |
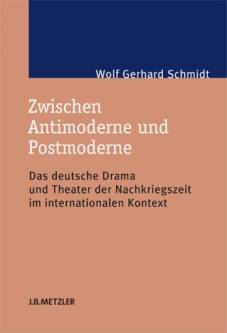
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen