|
|
|
Umschlagtext
Sechzig Gedichte vom Mittelalter bis zur Gegenwart stellt Peter von Matt vor. Elegant bringt er die Texte zum Leuchten, seine geschliffenen Interpretationen machen den Leser unangestrengt mit den jeweiligen Besonderheiten vertraut, unterhalten blendend und regen zu eigenen Deutungen an.
»Ein reines Lektürevergnügen.« Die Welt »Die Deutungen neben den Gedichten werden selbst zu kleinen Meisterwerken.« Leipziger Volkszeitung Rezension
Sechzig Gedichte erschließt Peter von Matt in diesem Buch, vom Mittelalter bis zur Gegenwart, von Klassikern wie Goethe, Heine, Hölderlin oder Brecht bis zu lyrischen Funden von kaum bekannten Dichtern. Den Originaltexten folgt eine geschliffene Interpretation, die das Metrum, die Sprache, die Zeitgeschichte ausleuchtet und nicht mehr Lektürezeit in Anspruch nimmt als das jeweilige Gedicht. So wird der Leser unangestrengt mit den Besonderheiten der Texte vertraut gemacht, blendend unterhalten und nicht zuletzt zu eigenen Gedanken angeregt: über die Schönheit der Natur, die Politik, die Gesellschaft, über Vergänglichkeit und Tod und immer wieder über die Liebe in ihren vielen Formen.
Dieter Bach, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Lyrik lesen! »Das Gedicht vermag so unmittelbar zu faszinieren und zu irritieren, zu begeistern und zu verärgern wie keine andere literarische Form«, sagt Peter von Matt. Daher hat er sich daran gemacht, eine umfassende Auswahl der besten Gedichte zusammenzustellen: Sechzig kleine Meisterwerke, vom Mittelalter bis zur Gegenwart, von Klassikern wie Goethe, Heine, Hölderlin oder Brecht ebenso wie von kaum bekannten Dichtern. Elegant bringt Peter von Matt die Texte zum Leuchten mit einer geschliffenen Interpretation, die nicht mehr Lektürezeit in Anspruch nimmt als das Gedicht. So wird der Leser in ›Wörterleuchten‹ unangestrengt mit den jeweiligen Besonderheiten vertraut gemacht, blendend unterhalten und nicht zuletzt zu eigenen Deutungen angeregt. Zu den weniger bekannten Dichtern, die Peter von Matt neben den Klassikern erschließt, zählen zum Beispiel Heinrich Hetzbold von Weißensee, Theodor Kramer oder Monika Rinck. Solche kaum bekannten Lyriker werden hier so präsentiert, dass es eine wahre Freude ist, sie nun endlich kennenzulernen. Der Leser bekommt aber nicht nur einen umfassenden Überblick über die wichtigsten Gedichte aus Vergangenheit und Gegenwart. Sondern er wird in ›Wörterleuchten‹ auch über die je individuellen Ausprägungen von Sprache, Metrum, historischen oder biografischen Bezügen informiert. Gleichzeitig wird er bestens unterhalten. Und nicht zuletzt zu eigenen Gedanken angeregt: über die Schönheit der Natur, über Gesellschaft und Politik, Vergänglichkeit, Liebe in ihren vielfältigen Formen. So bekommen die Worte, ob in jüngerer oder schon vor langer Zeit geschrieben, ihren ganz eigenen Glanz und leuchten in unseren Alltag hinein. Peter von Matts ›Wörterleuchten‹ ist ein kleines Meisterwerk über lyrische Meisterwerke. So verwundert es nicht, dass das Buch durchwegs hoch gelobt wurde: »Mit Begeisterung und begeisternd geht von Matt zu Werke, ohne je pädagogisch-oberlehrerhaft zu wirken ... Ob er den biographischen, politischen, theologischen oder ästhetischen Aspekt betrachtet, immer ist von Matts Perspektive originell oder zumindest informativ und unterhaltend. Auch sein Stil bleibt stets flexibel, elegant und bescheiden. Es gibt wohl kaum einen anderen Gelehrten, der solch leichthändige, geradezu journalistische Formulierungen findet.« Süddeutsche Zeitung »Ein Buch voller Überraschungen, dass sehr bekannte Gedichte sehr bekannter Autoren gedeutet werden ... ist eher die Ausnahme. Manchmal erweist sich, dass wir es gar nicht richtig gekannt haben, das bekannte Gedicht.« Tages-Anzeiger, Zürich »Lesen Sie das Gedicht, dann das, was Matt dazu schreibt und dann noch einmal das Gedicht. Sie werden sich wundern, wie es aufblüht! Ein Lieblingsbuch.« TZ, München »Ein reines Lektürevergnügen.« Die Welt »Die Deutungen neben den Gedichten werden selbst zu kleinen Meisterwerken.« Leipziger Volkszeitung »Peter von Matts ›Wörterleuchten‹ ist mehr als ein Buch mit klugen und elegant geschriebenen Interpretationen ... Das Schöne, wie es in den Interpretationen aufscheint, ist mehr als ein ästhetisches Phänomen, ein Produkt von Inspiration und Kunstfleiß. Es hat mit Wirklichkeit und Wahrheit zu tun.« Frankfurter Allgemeine Zeitung Peter von Matt, geboren 1937 in Luzern, ist emeritierter Professor für Neuere Deutsche Literaturwissenschaft an der Universität Zürich. Zahlreiche Veröffentlichungen insbesondere zur Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts. Inhaltsverzeichnis
Auge in Auge mit dem Gedicht. Ein Vorwort 11
Das Glück des Ungeküßten Heinrich Hetzbold vonWeißensee: Wol mich der stunde 15 Pfeilschnell ins Glück Christian Hoffmann von Hoffmannswaldau: Sonnet.Vergänglichkeit der schönheit 18 Das seltsame Brautgeschenk Johann Christian Günther: Als er der Phillis einen Ring mit einemTotenkopfe überreichte 21 Der bittere Verdacht Matthias Claudius: Kriegslied 24 Lessings Not Gotthold Ephraim Lessing: Lied. Aus dem Spanischen 27 Diese unheimlichen Diminutive Johann Wolfgang Goethe: Heidenröslein 30 GefährlicheVollkommenheit Johann Wolfgang Goethe: Mignon 33 Die Nacht, die Frauenzeit Johann Wolfgang Goethe: Philine 36 Selbstbewußte Demut Johann Wolfgang Goethe: Grenzen der Menschheit 40 Hochgemut und chancenlos Jakob Michael Reinhold Lenz: Willkommen 44 Wovon soll der Dichter leben? Friedrich Schiller: Die Teilung der Erde 47 Die Pflicht erwürgt das Glück Friedrich Schiller: Der spielende Knabe 51 Die Heimkehr des Geschundenen Friedrich Schiller: Odysseus 54 Die verborgene Flamme Friedrich Schiller: Punschlied 57 Todernste Heiterkeit Johann Peter Hebel: Wie heißt des Kaisers Töchterlein? 60 Der Schatten Hamlets Friedrich Hölderlin: An die Deutschen 63 Sisyphos in preußischer Uniform Adelbert von Chamisso: Tragische Geschichte 66 Wie Liebe auf den Teufel kommt Ludwig Uhland: FräuleinsWache 69 Der Sturmwind und die bleierne Welt Joseph von Eichendorff: Herbstklage 73 Die Loreley im Walde Joseph von Eichendorff: Waldesgespräch 76 Von alter Unanfechtbarkeit Ferdinand Raimund: Das Hobellied 79 Liebesnot und Gegenwehr Annette von Droste-Hülshoff: Lebt wohl 82 Knalleffekt und Raffinesse Heinrich Heine: Belsatzar 85 Heine in extremis Heinrich Heine: Der Scheidende 89 Aus der Zeit getreten Eduard Mörike: Die schöne Buche 92 Die letzten Blumen Hermann von Gilm zu Rosenegg: Allerseelen 96 Armer Sieger Friedrich Hebbel: David und Goliath 99 Humanität und Fortpflanzung Theodor Storm: Von Katzen 103 Im Weltwind Gottfried Keller: Waldlied 108 Der Meermensch Conrad Ferdinand Meyer: Nicola Pesce 111 Liebesglück im Zwielicht Conrad Ferdinand Meyer: Dämmergang 114 Narkotische Fahrt Stefan George: Vogelschau 117 Wer spricht aus dem Mund der Dichter? Rainer Maria Rilke: Eine Sibylle 120 Zweideutige Melancholie Hermann Hesse: Im Nebel 123 Dschungelliebe in Berlin Else Lasker-Schüler: Giselheer dem Tiger 126 Eine letzte Hoffnung Karl Kraus: An den Schnittlauch 129 Schweres Scheitern, hohe Fahrt Regina Ullmann: Alles ist sein 132 Modernes Hohelied Kurt Schwitters: An Anna Blume. Merzgedicht 1 135 Weltverfinsterung Robert Walser: Was fiel mir ein? 139 Eine Liebesgeschichte Gertrud Kolmar: Salamander 142 Das Glück jenseits der Sprache Silja Walter: Tänzerin 145 Auf schwankenden Füßen Günter Eich: Latrine 148 Trümmermärchen Günter Eich: Brüder Grimm 152 Die Nacht des Emigranten Theodor Kramer: Oh, wer geht mit mir rasch noch ins Kino vor Nacht 155 Der Körper als Kunstwerk Bertolt Brecht: Der Bauch Laughtons 159 Wie ist das Gold so gar verdunkelt Paul Celan: Todesfuge 162 Nah am tödlichen Rand Alexander Xaver Gwerder: Ich geh unter lauter Schatten 166 Die unersättlichen Augen Ingeborg Bachmann: An die Sonne 169 Von einer anderen Melodie Gottfried Benn: Restaurant 173 Aufforderung zum Verdacht Hans Magnus Enzensberger: Ins Lesebuch für die Oberstufe 176 Die Krippe am Eismeer Christine Lavant: Wieder Nacht ... 179 Vom Sonnenschicksal Friedrich Dürrenmatt: Siriusbegleiter 182 Skrupellos glücklich Peter Rühmkorf: Außer der Liebe nichts 185 Unverhoffte Herrlichkeit Friederike Mayröcker : an eineMohnblume mitten in der Stadt 189 Lautgedicht und Schmerzensmann Ernst Jandl: waunsas wissn woiz ... 192 Schöner Ort mit unsichtbarer Hexe Sarah Kirsch: Beginn der Zerstörung 196 Ein Talisman gegen die Vergänglichkeit Michael Krüger: Die Schlüssel 200 Die Dichter und die Macht Heiner Müller: Geschichten von Homer 203 Gefahr als Droge Durs Grünbein: Krater des Duris 207 Poesie und Blitz und Donner Monika Rinck : i had a pony (her name was lucifer) 210 Nachweise 213 Leseprobe: 11 Auge in Auge mit dem Gedicht Ein Vorwort Sechzig Solitäre. Sie sind über Jahre hin zusammengekommen, genau genommen über sechsundzwanzig Jahre. Stets als einzelne. Was sie verbindet, ist die Zuneigung des Deuters. Von jedem dieser Gedichte war er beim Schreiben tagelang wie besessen. DieVerse wühlten ihm im Gehirn. Er fürchtete sich vor dem Weiterschreiben am nächsten Morgen, fürchtete, auf den gegebenen zwei Seiten das Entscheidende zu verpassen. Und er freute sich doch wieder beinahe sportlich auf die stilistische Schußfahrt. Mit vielen Stücken war er seit langem vertraut, befreundet darf man wohl sagen. So etwa mit Lessings kaum beachtetem »Lied. Aus dem Spanischen«.Andere sprangen ihm beim Suchen plötzlich entgegen, verschlugen ihm fast denAtem, und imMoment dieser intellektuellen Kollision begann schon die Arbeit. So etwa, im Oktober 2007, Eichendorffs »Herbstklage«. Auch wenn hier keine Poesiegeschichte angestrebt wird, merkt man wahrscheinlich, daß sich die deutsche Literatur der letzten dreihundert Jahre imKopf des Deuters als vielgestaltig-gewaltige Landschaft erstreckt, zusammenhängend, mit Nebelzonen, gewiß, und mit schärfer besonnten Gebieten, aber als erlebte Einheit, durch Straßen und Ströme erschlossen, die Gebirge mit den Ebenen verbunden und dieUrwälder mit den Boulevards. An den literaturgeschichtlichen Signalen, die dadurch in die einzelnen Deutungen gelangen, ist demVerfasser viel gelegen. Denn aus dieser Landschaft nährt sich elementar das kulturelle Gedächtnis der deutschsprachigen Länder. Es gibt deren mehrere.Daran darf gelegentlich erinnert werden. Deutsche Gedichte kommen nicht nur aus Deutschland. Die Landschaft der deutschen Literatur dehnt sich über vieleGrenzen hinweg, geographische und geschichtliche, über die von Preußen, Sachsen und Bayern wie von 12 Österreich und der Schweiz, auch Herders Königsberg liegt noch darin und Keyserlings Kurland, das Böhmen Kafkas, Celans Czernowitz und Celans Paris, das Kalifornien, London, Jerusalem der Emigranten. Der Vertriebene, der in der Fremde ein deutschesGedicht schreibt,macht den Exilort zu einem Teil dieser Landschaft, auf immer. Für den Schweizer, der das vorliegende Buch geschrieben hat, ist sie Heimat, so selbstverständlich und lebensnotwendig wie die Confoederatio Helvetica. Sechzig Solitäre. Sechzig Begegnungen. Der Akt des Lesens fällt zusammen mit dem Akt des Schreibens. Wichtige Nuancen des Textes offenbaren sich dem Interpreten erst im Denkgerangel seines Formulierens. Die Exegese auf kleinstem Raum ist einWerben um das Gedicht, um die Sinnzusammenhänge im Wörterleuchten, und zugleich ein Werben um die Leser für das Gedicht. Ein brauchbarer Germanist ist immer auch ein matchmaker. Er bedarf der Geschicklichkeit der alten Heiratsvermittler. Er will nicht sich selbst darstellen, sondern das Zusammenfinden von Leser und Werk ermöglichen, mit Tricks gegebenenfalls, mit Schmeicheleien, faustdicken Lobreden, diskreten Hinweisen auf versteckte Reize, mit schnellem Schimpfen zwischendurch und hartnäckigem Aufdecken des Scharfsinns im Text, des Gedichts als einer philosophischen Tat. Im Gedicht gewinnt die deutsche Sprache die äußerste Verdichtung ihrer sinnlichen und intellektuellen Möglichkeiten. Es geschieht auf einmal, so wie uns ein Gesicht auf einmal erscheint. Das Nacheinander der Verse wird ebenso rasch zu einem Zugleich wie das Nacheinander von Stirn und Augen, Nase, Mund und Kinn. Das merkwürdig archaische Gesetz, das vom Gedicht einen graphischen Umriß verlangt, der es von allen andern Texten der Schriftkultur unterscheidet, eine optische Gestalt, die selbstgewiß Raum greift und Raum verschwendet, sich damit für einzigartig erklärend, zum Solitär eben – wie man den einzeln gefaßten Diamanten einen Solitär nennt oder den Baumriesen allein auf seinem Hügel –, dieses Gesetz nähert das Gedicht tatsächlich dem begegnenden menschlichen Gesicht an. Beider Merkmal ist die begrenzte Fläche, gegenwärtig auf einen Blick, aber mit einem unendlich sprechenden Inhalt. 13 Daß die zwei Wörter Gedicht und Gesicht sich nur in einem Laut unterscheiden, ist ein schöner Zufall der deutschen Sprache. Zum Gesicht gehört, daß es erschrecken kann. Seinem Wesen nach und mit biologischen Gründen. Lange vor dem Auftreten des Menschen haben die Züge eines Gesichts auf Falterflügeln und Insektenrücken zur Abschreckung gedient. Selbst die weiße Fläche am Hinterteil des Rehs, der Spiegel, wie die Jäger sagen, simuliert das Auftauchen eines Gesichts. Das verweist auf dessen merkwürdige Zeitstruktur, seine Plötzlichkeit. Sie leitet sich her von der potentiellen Gefahr, die es verkörpert. Das kleine Kind reagiert darauf schon nach wenigen Wochen. Auch die Erwachsenen halten das volleAug-in-Auge kaum eine Sekunde lang aus; die Blicke suchen sich und gleiten wieder weg.Nur die Gesichter derVerliebten können endlos ineinander versinken. Aber auch dieser kostbare Zustand hat seine zeitlichen Grenzen. Soll das nun ebenso vom Gedicht gelten? Sicher nicht im erwähnten biologischen Zusammenhang. Dennoch gibt es Analogien. Lichtenberg hat das menschliche Gesicht »die unterhaltsamste Fläche auf der Erde für uns« genannt. Die ebenso knapp umzirkte Fläche des Gedichts darf damit wohl als einzige in Konkurrenz treten. Beide sind ähnlich komplex in ihrer Organisation und wollen mit ähnlicher Dringlichkeit gelesen, gedeutet, verstanden werden. Ob dies je ganz gelingen kann, ist hier so fraglich wie dort. Beide verstecken ihre Wahrheit, melden aber deren Vorhandensein energisch an. Deshalb vermag das Gedicht so unmittelbar zu faszinieren und zu irritieren, zu begeistern und zu verärgern wie keine andere literarische Form. Viele verwerfen es grundsätzlich und rabiat. Die Gründe dafür sind zahlreich. Sie ergeben eine bedrohliche Sammlung von Verdachtsmomenten, die sich abstecken läßt mit den Stichworten: Nutzlosigkeit, Sentimentalität, Verlogenheit, Infantilität, Nebel, Dusel, Luxus, Unverständlichkeit, Weltferne, Vorgestrigkeit, Eskapismus, Täuschung, Affektiertheit, Abstrusität. Tatsächlich könnte jeder dieser Begriffe ertragreich diskutiert werden und erbrächte ein tüchtiges Stück Lyriktheorie.Denn jeder reagiert auf bestimmte Eigenschaften und Tendenzen des Gedichts. Nur wischt das platte Urteil diese vorschnell 14 vom Tisch, statt sie in ihrer intellektuellen und ästhetischen Provokation zur Kenntnis zu nehmen. Gerade das Phänomen der Abschreckung müßte an der Lyrik so sorgsamuntersucht werden wie an den Flügeln des Tagpfauenauges, auch wenn es hier um das Überleben einer Schmetterlingsart, dort um die Gewinnung talentierter Leser geht. Sechzig Solitäre. Die vielen Lyriktheorien undMusterinterpretationen, die das 20. Jahrhundert hervorgebracht hat, haben zu keinem Verfahren geführt, das sich auf alle diese Texte gleichermaßen resultatsicher anwenden ließe.Die Arbeit des Deutens, die das Gedicht nicht als Gerät für methodische Kunstturner versteht, sondern als eine Aufgabe der Erkenntnis und der Vermittlung zugleich, des Werbens um die Verse wie auch um ihre Leser, muß sich von Mal zu Mal etwas einfallen lassen. Die vielerlei Listen, mit denen das Gedicht seine Sinnzusammenhänge anzeigt und versteckt, erfordern Gegenlisten. Einem Text, der sich als poésie pure versteht, kann man unter Umständen biographisch beikommen und einem Text, der sich als privates Bekenntnis gibt, mit formalen Kategorien.Was zählt, ist allein das Resultat. Darüber entscheiden die Leser. Die Form der Kleinen Deutung ist keine Erfindung des Verfassers. Sie ist Marcel Reich-Ranicki zu verdanken, der 1974 die »Frankfurter Anthologie « begründet hat und sie bis heute leitet. Die meisten Interpretationen des vorliegenden Bandes wurden für diese wöchentliche Reihe in der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung« geschrieben. Auch wenn es noch keine Theorie der Kleinen Deutung gibt, ist diese doch zu einer unverwechselbaren Gestalt der literarischen Kritik und Auslegung geworden. Sie zieht viele Literaturwissenschaftler an, andere lehnen sie grimmig ab. Der Verfasser des vorliegenden Buches war dem Spiel verfallen, seit er 1982 mit Chamissos »Tragischer Geschichte« den ersten Versuch machte. Er verdanktMarcel Reich-Ranicki manchen wertvollenHinweis, bald auf einen Patzer, bald auf einen übersehenen Zusammenhang, auch viele konkrete Text-Vorschläge. Wem, wenn nicht ihm, sollte dieses Buch gewidmet sein? Dübendorf bei Zürich, im Sommer 2008 Peter von Matt Weitere Titel aus der Reihe dtv |
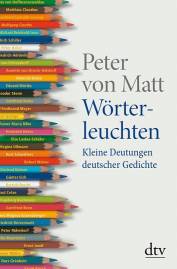
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen