|
|
|
Umschlagtext
Der deutsche Schulpreis 2012 - gute Schulen in Deutschland
Schule! An kaum einem anderen Ort treffen sich Kinder und Jugendliche so selbstverständlich wie in Klassenzimmern und auf Pausenhöfen. Hier sind die großen Themen unserer Zeit - Vielfalt und respektvolles Miteinander - äußerst lebendig. Sie gehören zum Alltag der Lernenden und Lehrenden: pragmatisch und immer wieder anders, anspruchsvoll. Wer hinsieht, erkennt, dass der produktive Umgang mit Vielfalt zu den herausragenden Leistungen guter Schulen gehört. Das ist es, was die Robert Bosch Stiftung und die Heidehof Stiftung, die Initiatoren des Deutschen Schulpreises, erreichen wollen: Den Blick der Fachleute, der Öffentlichkeit und der Politik auf die Leistung und Bedeutung guter Schulen lenken und möglichst viele andere dazu ermutigen, sich anstecken und anregen zu lassen. Der Deutsche Schulpreis hat sehr rasch große Beachtung gefunden; weit über tausend Schulen haben sich bei den bisherigen Ausschreibungen beteiligt, Schulen aller Bundesländer und Schularten. In diesem Jahr blickt der Preis bereits auf sechs Jahre Geschichte zurück. 122 Schulen konnten diesmal in das Juryverfahren aufgenommen werden; 20 Schulen wurden von Expertenteams besucht, 15 Schulen für den Schulpreis nominiert, 6 mit Preisen bedacht. Mit Konzept, Augenmaß und großem Engagement am Miteinander gestalten die ausgezeichneten Schulen ihren pädagogischen Alltag. So entsteht in bewusster Auseinandersetzung mit der Vielfalt von Schülern und Lehrenden das, was Schule im besten Sinne sein soll: Vorbereitung auf das Leben. Die Schulporträts, Interviews und der Materialteil in diesem Buch zeigen, wie dies gelingen kann. Was für Schulen! Herausgeber: Prof. Dr. Michael Schratz lehrt am Institut für LehrerInnenbildung und Schulforschung der Universität Innsbruck. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Bildung, Gesellschaft und Lernen, Leadership und Qualitätsentwicklung. Er ist Mitglied zahlreicher internationaler Kommissionen, darunter auch Jurymitglied des Deutschen Schulpreises. Prof. Dr. Hans Anand Pant ist Direktor des Instituts zur Qualitätssicherung im Bildungswesen und lehrt an der Humboldt-Universität zu Berlin. Prof. Dr. Beate Wischer ist Professorin für Schulpädagogik mit dem Schwerpunkt Schultheorie und Schulforschung an der Universität Osnabrück. Rezension
Angesichts einer immer größeren Multikulturalität unserer Gesellschaft wächst auch in den Schulen die Bedeutung des Umgangs mit Vielfalt, der im Jahr 2012 im Mittelpunkt des Deutschen Schulpreises stand. Seit mehr als sieben Jahren gibt es nun den Deutschen Schulpreis, der schnell große Beachtung gefunden hat; über tausend Schulen aller Bundesländer und Schularten haben sich an den bisherigen Ausschreibungen beteiligt. Und dies ist das Buch zum Deutschen Schulpreis 2012: Schulen, die den Umgang mit Vielfalt in Beispielen guter Praxis vorführen. Dieses Buch zeigt: So stark und spannend sind Deutschlands gute Schulen; sie wurden gesucht und ausgezeichnet: Schulen, die dem Lernen Flügel verleihen und Wege zur Schulqualität sichern. Mit Porträts der Preisträgerschulen und der nominierten Schulen sowie Steckbriefen aller Schulen, die sich 2012 um den Deutschen Schulpreis beworben haben. Nicht nur geeignet für Schulleiter und Lehrer, die ihre Schule weiterentwickeln möchten, sondern auch für Eltern, die die richtige Schule für ihr Kind suchen.
Oliver Neumann, lehrerbibliothek.de Inhaltsverzeichnis
Vorwort 5
Bundespräsident a.D. Roman Herzog zum Deutschen Schulpreis 2012 6 Einführung der Herausgeber: Vielfalt – Blick auf einen schillernden Begriff 7 Interview: „Aus Träumen leiten sich Ziele ab …“ 16 Der Deutsche Schulpreis 2012 – Laudationes für die Preisträgerschulen 18 Porträts der nominierten Schulen Evi – „Lehren ohne Liebe macht müde“ Hauptpreisträger: Die Evangelische Schule Neuruppin 20 Erstaunlich! Oder: So gelingt der Wandel Preisträger: Die Erich Kästnerschule, Bochum 30 Jeder Schüler konsequent im Mittelpunkt Preisträger: Die Paul-Martini-Schule, Bonn 38 Chancen der Vielfalt: verstanden, gewürdigt, umgesetzt Preisträger: Die Schule am Pfälzer Weg, Bremen 46 Ein filigranes System von kleinen Chefinnen und Chefs Preisträger: Die Schule Rellinger Straße, Hamburg 54 Hauptschule: Herausforderung angenommen, mustergültig umgesetzt Preis der Jury: Die August-Claas-Schule, Harsewinkel 62 Die Vielfalt vor der eigenen Haustür bewahren Das Alexander-von-Humboldt-Gymnasium, Hamburg 70 Inklusion durch Ausbildungserfolge Die AsiG Berufsfachschule, Berlin 76 Jeder Mensch zählt Die Bertolt-Brecht-Gesamtschule, Bonn 82 Unspektakulär – und doch so ganz besonders Die Erich Kästner Schule, Hamburg 88 Zeit für Beziehungen in einem komplexen System Die Gewerblichen und hauswirtschaftlich-sozialpflegerischen Schulen Emmendingen 94 Inklusion – lebenswert für alle Die Grundschule am Barbarossaplatz, Berlin 100 Schulgebäude nach dänischem Vorbild: ein Glücksfall Die Grundschule Südschule, Lemgo 106 Kulturschule oder: die Suche nach dem Umgang mit dem Anderen Die Klosterschule, Hamburg 112 Schulentwicklung in soliden Schritten Die Markgraf-Georg-Friedrich Realschule, Heilsbronn 118 Materialseiten der nominierten Schulen 124 Die Bewerberschulen im Überblick 138 Der Deutsche Schulpreis 142 Die Jury des Deutschen Schulpreises 2012 / Die Autorinnen und Autoren 143 / 144 Vorwort Vielstimmigkeit und Vielfalt prägen die gesellschaftliche Wirklichkeit: Wir sind konfrontiert mit unterschiedlichen Lebensstilen und Soziallagen, Glaubens- und Wertvorstellungen sowie kulturellen Orientierungen. Arbeits- und Erwerbsformen differenzieren sich weiter aus und auch die Möglichkeiten der Information und Kommunikation sind vielfältiger geworden. Wie man die vorhandene Vielfalt wahrnimmt und wie man ihr im Leben und Lernen begegnet, ist die entscheidende Frage – auch für Schulen. Denn in jedem Klassenzimmer kommen höchst unterschiedliche Schülerinnen und Schüler zusammen. Sieht man vor allem die Herausforderungen im Umgang mit Vielfalt, dann kann sie belastend wirken, sieht man in Vielfalt aber die Chance auf Bereicherung, dann kann sie auch beflügeln. „Vom Umgang mit Vielfalt – Beispiele guter Praxis“ lautet der Untertitel dieses Buches. Gute Schulen individualisieren den Unterricht und fördern das Lernen aller Kinder entsprechend ihrer unterschiedlichen Voraussetzungen. Gute Schulen beziehen Schüler in Entscheidungen ein, die ihr Lernen betreffen und arbeiten gemeinsam mit ihnen an individuellen Fortschritten. Gute Schulen finden Wege, um produktiv und achtungsvoll mit vielfältigen Begabungen, Interessen und Leistungsmöglichkeiten, mit Unterschieden der kulturellen und nationalen Herkunft und des Geschlechts umzugehen. Das Ziel einer guten Schule ist immer, allen Kindern optimale Entwicklungsmöglichkeiten zu eröffnen. Um diese Schulen auch für andere sichtbar zu machen und ihre Leistung zu würdigen, schreiben die Robert Bosch Stiftung und die Heidehof Stiftung in Kooperation mit dem stern und der ARD seit 2006 den Deutschen Schulpreis aus. In den vergangenen sechs Wettbewerbsjahren haben sich bereits über 1 000 Schulen aller Schularten aus ganz Deutschland beworben, 37 Schulen wurden ausgezeichnet. Um Beispiele guter Praxis und nachahmenswerte Konzepte an möglichst viele weiterzugeben, nahm 2007 die Akademie des Deutschen Schulpreises ihre Arbeit auf. Sie dient der Zusammenarbeit und dem Erfahrungsaustausch zwischen den Preisträgern und allen Schulen, die aus eigener Initiative gute Schule gestalten wollen und sich auf den Weg der Schulentwicklung begeben haben. Zu den Angeboten der Akademie gehören neben unterschiedlichen Veranstaltungsformaten auch Hospitations- und Fortbildungsmöglichkeiten sowie das Förderprogramm SchulLabor, in dem Schulen gemeinsam innovative Schul- und Unterrichtskonzepte entwickeln. Alle Aktivitäten stehen auf einem Fundament: den sechs Qualitätsbereichen des Deutschen Schulpreises. Der sechste Band innerhalb der pädagogischen Reihe zum Schulpreis versammelt die Erträge der Ausschreibung 2012, um die Erfahrungen und Erkenntnisse guter Schulen für die Diskussion in Fachkreisen und Öffentlichkeit, vor allem aber für die breite pädagogische Praxis fruchtbar zu machen. Wir danken dem Verlag Klett-Kallmeyer, den Herausgebern Michael Schratz, Hans Anand Pant und Beate Wischer sowie den Autoren des vorliegenden Bandes für ihre Beiträge. Besonderer Dank gilt aber allen pädagogischen Mitarbeitern, Eltern und Schülern, die sich von Vielfalt beflügeln lassen und dadurch gute Schule in Deutschland ermöglichen. Wir hoffen, dass diese Publikation ihnen zusätzliche Anregungen gibt und viele Schulen dazu motiviert, sich ebenfalls auf den Weg zu machen. Dr. Eva Madelung, Heidehof Stiftung Dr. Ingrid Hamm, Robert Bosch Stiftung Vielfalt – Blick auf einen schillernden Begriff Dieses Buch nimmt erstmals eine Schwerpunktsetzung auf einen der insgesamt sechs Qualitätsbereiche des Deutschen Schulpreises vor (vgl. S. 13). Mit dem Thema „Umgang mit Vielfalt“ greifen wir eine Herausforderung auf, die nicht nur von hoher gesellschafts- und bildungspolitischer Bedeutung ist. Die aktuellen und intensiv geführten Debatten zu diesem wesentlichen Qualitätsbereich des Deutschen Schulpreises können vielmehr deutlich machen: Die damit verknüpften Frage- und Problemstellungen sind komplex und vielschichtig – und die konkreten An- und Herausforderungen sind alles andere als einfach zu bestimmen oder gar umzusetzen. Betrachten wir kurz die mit Vielfalt einhergehende Komplexität: • Vielfalt ist ein schillernder Begriff, hinter dem sich selbst wiederum eine immense Vielfalt an Dimensionen und möglichen Perspektiven verbirgt: Es gibt diverse und unendlich erweiterbare Kriterien – Geschlecht, Leistung, sozialer Hintergrund usw. – für Vielfalt, dahinter steckt aber nicht nur Verschiedenes, sondern auch problematisches Ungleiches; und Unterschiede zwischen den Schülerinnen und Schülern werden nicht nur in die Schule mitgebracht; sind also keineswegs als Eigenschaft einfach vorhanden: Differenzen werden auch sozial erzeugt und hergestellt; und gerade daran ist auch die Schule in umfassender Weise beteiligt. • Vielfalt darf nicht ignoriert werden, wenn Bildungs- und Erziehungsprozesse erfolgreich gestaltet werden sollen; das Lernen – so hatten Fauser/Prenzel/Schratz (2009, S. 20) im Einleitungstext zu „Was für Schulen!“ formuliert – sei „individuell, die Individualisierung der Lernförderung die wichtigste Konsequenz“. Dem gegenüber steht jedoch, dass die Schule traditionell gerade darauf nur wenig eingestellt ist. Man könnte sogar zugespitzt argumentieren: Individualbedürfnisse haben in der Schule kaum Platz. Deren Berücksichtigung ist strukturell nicht vorgesehen, sie steht sogar im direkten Widerspruch zur Grammatik der Schule als einer gesellschaftlichen Institution und Organisation: Organisationen – dazu z.B. ein provokativer Hinweis – zeichnen sich gemeinhin dadurch aus, dass sie vom Einzelfall bzw. von den konkreten Subjekten abstrahieren und stattdessen „eine Vielzahl von individuellen Bedürfnissen, Wünschen oder Problemlagen bündeln und typisieren und dann nach demselben Schema abarbeiten“ (Preisendörfer 2008, S. 161). • Schließlich ist auch gar nicht so einfach zu beantworten, welche Ziele im Umgang mit Vielfalt eigentlich angestrebt werden sollen, woran also ein erfolgreicher Umgang mit Vielfalt im Ergebnis zu bestimmen wäre. Ein Maßstab sind zweifellos die erzielten Schülerleistungen. Sie stellen in den meisten Bildungssystemen ein zentrales Erfolgskriterium dar, zumal sie weltweit das hauptsächliche Messkriterium für Schulqualität sind. Hierbei geht es allerdings nicht einfach nur um generelle Leistungsmaximierung, also nur um ein hohes Leistungsniveau („excellence“), sondern auch um den Ausgleich ungleicher Chancen („equality“). Und neben fachlichen Leistungen sind immer auch – wie beim Deutschen Schulpreis für das Qualitätskriterium „Leistung“ ausdrücklich vorgesehen – besondere Erfolge in anderen Bereichen (Projekte, Vorführungen, Auszeichnungen, Wettkämpfe u.a.m.) einzubeziehen. Kurz: Die Bestimmung von Erfolg im Umgang mit Vielfalt ist vor dem Hintergrund „one size does not fit all“ im Spannungsfeld von Chancengleichheit und -gerechtigkeit zu sehen. Diese hier nur schlaglichtartig genannten Herausforderungen heben den Anspruch des Deutschen Schulpreises, aber auch die Zielstellung dieses Buches besonders hervor: Es geht nicht allein darum, Schulen in ihren Entwicklungen zu bestärken und ihre Arbeit öffentlich zu honorieren. Bedeutsamer ist vielmehr die für Schulen, Wissenschaft und Bildungspolitik gleichermaßen zentrale Frage: Was können wir von der Arbeit und Entwicklung guter Schulen lernen? Ganz konkret: Welche Strategien haben Schulen entwickelt, um den vielfältigen Ausgangslagen, Interessen und Bedürfnissen ihrer Schülerinnen und Schüler gerecht zu werden? Wie werden die zahlreichen Spannungsfelder – z.B. zwischen Gleichheit und Differenz, zwischen optimaler Leistungsentwicklung und Chancenausgleich – ausbalanciert? Welche organisatorischen und methodischen Lösungswege lassen sich aufzeigen, um entgegen der problematischen Grammatik der Schule als Institution Vielfalt produktiv zu nutzen? Um zu zeigen, wie „Vielfalt geht“, wurde erstmals eine Auswahl an Arbeitsblättern der nominierten Schulen in einen Materialteil (S. 124 ff.) aufgenommen, der auch zum Download angeboten wird (siehe Code auf der hinteren Umschlagseite). Diese Materialien haben sich bereits in der Praxis bewährt und veranschaulichen, wie vielfältig Vielfalt umgesetzt werden kann. Empfohlen sind sie zur Anregung und Nachahmung auch für andere Schulen, die sie auf ihre spezifische Situation hin adaptieren und weiterentwickeln können. Einen guten Einblick in die Arbeit der Schulen geben aber vor allem die nachfolgenden ausführlichen Porträts (S. 20 ff.), in denen die einzelnen Schulen jeweils in ihrer gesamten Arbeit gewürdigt werden. Auch wenn, beziehungsweise gerade weil hier nicht allein der Umgang mit Vielfalt im Fokus steht, wird dadurch bereits ein zentraler Aspekt dieses Qualitätskriteriums hervorragend dokumentiert: Der Umgang mit Vielfalt lässt sich weder auf einzelne Bausteine oder Maßnahmen noch auf nur ein einzelnes schulisches Handlungsfeld reduzieren! Der Umgang mit Vielfalt ist vielmehr eine Querschnittsaufgabe, die die Schule als Ganzes – ihre Bildungsund Organisationsqualitäten – betrifft. Im engen Zusammenhang dazu steht aber auch: Es kann keine für alle verbindlichen Patentrezepte geben! Schulen müssen jeweils eigene Lösungen finden, die zu ihrer spezifischen Ausgangslage (Personal, Entwicklungsgeschichte etc.), ihrer Schülerschaft und den regionalen und lokalen Besonderheiten passen. Es gilt also, worauf in den Büchern der vergangenen Jahre bereits mehrfach aufmerksam gemacht wurde: Die Güte der einzelnen Schulen erschließt sich nicht über die isolierte Betrachtung einzelner Qualitätsbereiche oder formaler Organisationsmuster, sondern über die Betrachtung der einzelnen Schule als „Kultur“. Anders formuliert: „Wenn man verstehen will, wie Schule ‚gemacht‘ wird“, dann muss man verstehen, wie das „Gesamtgeflecht von miteinander verschränkten oder abgestimmten Erwartungen, Routinen, von Handlungsverhältnissen, von Zuständigkeiten, Gruppen und Grenzen entsteht und wie es sich verändern lässt“ (Fauser/ Prenzel/Schratz 2009, S. 13). In diesem Text soll nun der Blick auf einige ausgewählte und konkrete Herausforderungen gelenkt werden, die mit dem Umgang mit Vielfalt grundsätzlich verbunden sind. Wir schließen dabei an die in den bisherigen Büchern zum Deutschen Schulpreis verhandelten Fragen zum Umgang mit Vielfalt an: 1. Welche „Philosophie“ von Diversität bestimmt das Handeln an der Schule? Welches Verständnis bestimmt den Umgang mit Vielfalt in den strukturellen und unterrichtlichen Maßnahmen, die an der Schule gesetzt werden? 2. Welche praktischen Konsequenzen werden aus (1), dem Verständnis von Vielfalt, gezogen? Wie gehen die Schulen mit dem Problem um, dass Schülerinnen und Schüler ganz „uneinheitliche Subjekte“ darstellen und über unterschiedliche Formen der Differenzierung pädagogisch sinnvoll gruppiert werden? 3. Was bedeuten (1) und (2) für die Professionalität von Lehrerinnen und Lehrern heute? Welches professionelle Selbstverständnis setzt der Umgang mit Vielfalt an der Schule voraus? Wir skizzieren jeweils zunächst einige hinter diesen angesprochenen Bereichen stehende Problemlagen und Fallstricke, um anschließend exemplarisch auf die von den einzelnen Schulen gefundenen Lösungsstrategien näher einzugehen. 1. Verständnis von Diversität Diversität, Vielfalt oder auch Heterogenität – unter diesen zumeist synonym, bisweilen auch schlagwortartig verwendeten Begriffen werden derzeit die vielfältigen Herausforderungen rund um die Verschiedenheit von Schülerinnen und Schülern diskutiert. Dabei ist allen an Schule beteiligten Akteuren nur allzu bewusst, dass junge Menschen unterschiedliche Voraussetzungen für die Schule mitbringen, unterschiedliche Biografien haben, unterschiedliche familiäre Kontexte erleben, unterschiedliche Strategien des Lernens entwickelt haben und vor diesem Hintergrund „uneinheitliche Subjekte“ sind, dass sie also alle „anders anders“ sind (vgl. Arens/ Mecheril 2010). Bei näherer Betrachtung tun sich allerdings komplizierte Fragen auf: Was kann dies konkret bedeuten? Von welchen Dimensionen ist die Rede? Auf welche Kriterien aus dem gleichsam unendlichen Spektrum möglicher Unterscheidungsoptionen kommt es an? Und welche Unterschiede sind dann speziell im schulischen Kontext relevant? Die aktuellen Diskurse liefern dazu durchaus unterschiedliche Antworten (vgl. ausf. Trautmann/Wischer 2011). Betrachtet man Schule zunächst „nur“ als einen Ort der systematischen Organisation von Lehr-Lernprozessen, dann findet man etwa wichtige Hinweise in der empirischen Lehr-Lern-Forschung, die Lernermerkmale in ihren Einflüssen auf die (vor allem fachlichen) Lernleistungen untersucht. Für eine effektive Unterrichtsgestaltung wären demnach in erster Linie das Vorwissen, die kognitiven Grundfähigkeiten und ausgewählte motivationale und affektive Dimensionen zu berücksichtigen. Eine derartige Konzentration auf Lernermerkmale und Lernleistungen bildet zwar zweifellos einen entscheidenden Auftrag der Schule ab, sie geht aber keineswegs allein darin auf; zumal zu berücksichtigen ist, dass solche Lernermerkmale nicht einfach vorhanden sind, sondern auch sozial erzeugt werden. Auf dieses Problem weisen vor allem sozialwissenschaftliche Diskurse sehr eindrücklich hin. Sie stellen die Frage nach den Konstruktionsprinzipien von Differenzlinien (wie Geschlecht, Nationalität oder Behinderung) und den damit verbundenen Ungleichheiten in den Mittelpunkt. Unterschiede gelten in dieser Perspektive als historisch und gesellschaftlich bedingte – allerdings nicht grundsätzlich zu vermeidende! – Konstruktionen, in die Vorstellungen von Normalität und Abweichung, Dominanz, Hierarchie und Unterdrückung eingebaut sind. Bildungspolitisch verortet sich der Umgang mit Vielfalt im Kontext der aktuellen Debatte um Inklusion – im Gegensatz zur Exklusion, der Ausgrenzung bestimmter Gruppen von gesellschaftlicher Teilhabe. Schule ist so betrachtet also nicht nur ein institutioneller Ort, der Lernen möglichst effektiv anbahnen und hervorbringen soll. Schule soll alle jungen Menschen unabhängig von ihrer Herkunft auf die gesellschaftliche Teilhabe vorbereiten. Dabei geht es nicht mehr um die Integration der „Anderen“, etwa der sogenannten „behinderten“ Schülerinnen und Schüler, der Kinder mit sogenanntem „Migrationshintergrund“, sondern um den reflektierten Umgang mit der Differenz, die über die Heraushebung des Andersseins (Behinderte, Migranten etc.) geschaffen wird. Eine differenzsensible Schul- und Unterrichtskultur erfordert einen neuen Blick auf die Schülerinnen und Schüler. Gleichzeitig aber – und mindestens so wichtig – „müssen sich pädagogische Institutionen und pädagogisch Handelnde fragen, inwiefern sie selbst am ‚doing difference‘ beteiligt sind, welche Zuschreibungen sie vornehmen, wie sie in ihrer täglichen und notwendig anerkennenden Arbeit durch Anreden, Zuordnungen, Diagnosen, räumliche Settings etc. Weitere Titel aus der Reihe Was für Schulen! |
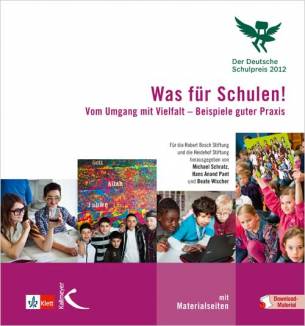
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen