|
|
|
Umschlagtext
Welche Möglichkeiten bietet die psychomotorische Förderung in Kindergarten, Vorschule und Grundschulalter? Wie kann man auf der Grundlage der Entwicklungspsychologie ein theoretisches Modell der Motorik entwerfen und daraus praxisrelevante Hinweise für die Organisation und Durchführung von Förderung entwickeln? Wie kann man aus der Psychotherapie Hinweise für das praktische Handeln und die Durchführung von Übungen, Fördersequenzen, Spielen und szenischen Arrangements ableiten? Diese und andere Fragen versucht der Autor, seit mehr als 20 Jahren Professor für Psychologie der Behinderten in der Sonderschullehrerausbildung an der Universität Hannover, aus seinen wissenschaftlichen Arbeiten, aber vor allem aus der Zusammenarbeit mit Praktikern und Studenten im Rahmen der psychomotorischen Förderung zu beantworten. Die einzelnen Kapitel des Textbandes widmen sich der theoretischen Begründung der Methode und versuchen dabei auch, die Frage zu beantworten welche Rechtfertigung es dafür gibt, in unserer Zeit der psychomotorischen Förderung in Vorschule und Grundschule einen so bedeutenden Platz einzuräumen. Weiter wird, vor allem anhand von internationalen Untersuchungen und vielen Studien zur Wirksamkeit der Effektivität der psychomotorischen Förderung, der Versuch unternommen, differentielle Anwendungsgebiete zu beschreiben: Welche Wirkungen können z.B. von einer psychomotorischen Förderung in bezug auf die Förderung der Intelligenz, der Sprache und der emotionalen und sozialen Entwicklung erwartet werden? Wie weit reicht der große pädagogische Optimismus, der im Rahmen dieses Ansatzes in der Praxis zu beobachten ist? Das Schwergewicht der vorgeschlagenen Übungen und Fördersequenzen im Arbeitsbuch liegt im Bereich der Prävention von Störungen und in der Betonung der Rolle des Spiels als entwicklungsförderndes Mittel, gerade für Kinder mit Lern- und Entwicklungsauffälligkeiten. Hierfür werden im Arbeitsbuch eine Reihe von Übungen und Sequenzen sowie Spielentwürfen vorgeschlagen, die sich in der Praxis bewährt haben und die vor allem dem Praktiker eine Hilfe für Variationen seiner eigenen Tätigkeit in die Hand geben wollen.
Rezension
"Psychomotorik ist keine spezielle Methode und auch kein besonderes Lernprogramm, sondern der Versuch einer alltäglichen, "natürlichen", kindgerechten, entwicklungsorientierten und ganzheitlichen Erziehung durch Bewegung und Spiel zum gemeinsamen Handeln."
Dieser Satz, zu finden auf Seite 8 des Textbandes, bringt das Anliegen des Werkes klar auf den Punkt. Die Autoren wenden sich vor allem an (Sonder-)Pädagogen, die mit Kindern im Grund- und Vorschulalter arbeiten, die einen besonderen Förderbedarf haben. Gerade in der heutigen Zeit, wo Betreuungsplätze rar sind und besonders Stadtkinder durch ein "kinderfeindliches" Umfeld mehr und mehr in die Verhäuslichung gedrängt werden, ist es wichtig, den Entwicklungserschwernissen durch ein möglichst vielfältiges und motivierendes Bewegungsangebot entgegenzuwirken. Im Textband des zweibändigen Werkes werden klar gegliedert und sehr umfassend die theoretischen Grundlagen für das Praxiskonzept dargestellt. Dabei erfährt der Leser nicht nur wichtige Ergebnisse aus der empirischen Forschung sondern erhält auch einen Überblick über verschiedene Modelle der psychomotorischen Förderung. Besonders wertvoll sind die ausführlichen Hinweise zur Diagnostik, die - verstanden als Förderdiagnostik - einschlägige Hinweise auf mögliche individuelle Fördermaßnahmen geben kann. Das Arbeitsbuch enthält dann eine Fülle von Übungsvorschlägen für die verschiedensten Förderbereiche, die allesamt sehr gut gegliedert und beschrieben werden und somit eine schier unerschöpfliche Anzahl von motivierenden Ideen für die tägliche Förderung liefern. Insgesamt sehr interessant zu lesen und vor allem ein sehr wertvoller wenn nicht unverzichtbarer Praxisbegleiter für die Arbeit mit förderbedürftigen Kindern. B. Lensch, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
„Um es vorwegzunehmen, diese beiden Bücher habe ich gerne und mit Gewinn gelesen. Begriffe wie Psychomotorik, sensomotorische Förderung und Bewegungsförderung gehören ja mittlerweile schon zur Alltagssprache von Sonderpädagogen, aber irgendwie habe ich immer den roten Faden, den großen Zusammenhang vermißt; dabei immer eine leichte Skepsis gegenüber modischen Tendenzen gespürt. D. Eggert und seinen Mitarbeitern ist es mit diesen beiden Büchern gelungen, basierend auf 20jähriger Erfahrung in Forschung und Praxis, ein geschlossenes System der Begründung und praktischen Ausformung psychomotorischer Förderung ... vorzulegen. Die beiden Bände sind aus meiner Sicht eine wirklich sinnvolle Investition für Studenten, Lehrkräfte und all diejenigen, die an einer ganzheitlichen Förderung von Kindern interessiert sind. Das pädagogische Konzept ist überzeugend. Zum Schluß noch: Layout, Format und Papier sind von überdurchschnittlicher Qualität. Zwei Bücher, die man schon aus diesem Grund gerne in die Hand nimmt.“ Pädagogische Impulse „In bewußter Abkehr von den motometrischen Testverfahren, die meist nur isolierte Komponenten der Motorik messend erfassen, hat sich die Gruppe um Eggert mit guten Gründen für den Einsatz von Verhaltensinventaren entschieden. (Mit dem DMB und DIAS haben die Autoren zwei Verfahren für den praktischen Einsatz vorgelegt, die den Anspruch auf Förderdiagnostik und damit der funktionellen Einheit von Diagnostik und Behandlung einlösen.) ... Allein das Arbeitsbuch ist schon eine wahre Fundgrube, aus der sich alle mit Gewinn bedienen können, die in förderlicher Absicht mit Kindern spielen! Überhaupt und zusammenfassend kann man Eggert und seinen MitarbeiterInnen bescheinigen, daß sie mit ihrem Ansatz das bislang überzeugendste integrale Konzept psychomotorischer Persönlichkeitsförderung vorgelegt haben, das nüchtern-kritische Wissenschaftlichkeit ebenso einschließt wie begeisterungsfähige Anleitung zu helfender Praxis.“ Praxis der Kinderpsych. u. Kinderpsychiatrie „Das zweiteilige Buch bietet dem interessierten Leser nicht nur einen eindrucksvollen Überblick über langjährige Forschungs- und Praxiserfahrungen, es vermittelt vor allem Anregungen, die der Pädagoge in den verschiedensten Bereichen, vom Kindergarten über die Grundschule oder die Sonderschule praktisch nutzen kann, um behinderten bzw. von Behinderung bedrohten Kindern zu helfen.“ Ergotherapie & Rehabilitation „Hervorragend: gründlicher Theorieteil, ausgezeichneter Praxisteil. Guter Einstieg für alle Pädagogen, die sich mit Psychomotorik befassen wollen.“ Leserinnenzuschrift „Die Psychomotorik ganzheitlich und entwicklungspsychologisch zu sehen liegt nicht nur im Trend der Zeit, sondern entspricht den realen Tatsachen. Diese Auffassung und Sichtweise in ein Konzept der sonderpädagogischen Psychomotorik, speziell der Förderdiagnostik, zu integrieren, kann von keinem besser bewältigt werden als von D. Eggert, der sich seit Jahren dieser Aufgabe gewidmet hat. Der nunmehr vorliegende Textband und das entsprechende Arbeitsbuch ist das umfassende Resultat dieser Arbeit. ... Die verinnerlichte Auffassung vom Zusammenhang zwischen Theorie und Praxis zieht sich wie ein roter Faden durch das gesamte Buch. Ihren Höhepunkte erreicht die von Eggert und seinen Mitarbeitern gedachte und praktizierte Auffassung in dem 247 Seiten umfassenden Arbeitsbuch. Auf hohem didaktischen Niveau stehend, mit grafischen Mitteln vorbildlich umgesetzt, werden dem Untersucher strukturierte Vorgaben in die Hand gegeben, wie Gleichgewicht, Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, Gelenkigkeit, visuelle, auditive und taktil-kinestetische Wahrnehmung erfaßt werden können. Ebenso anschaulich die Präsentation der psychomotorischen Materialien und die Darstellung psychomotorischer Erfahrungsräume sowie die einfühlende Beschreibung von Themen und Geschichten mit Bezug zu unterschiedlichen Lebensbereichen des Kindes, die bis zur Weltraumfahrt reichen. Textband und Arbeitsbuch stehen für eine moderne psychomotorische Arbeitsrichtung, die ob ihrer interdisziplinären Denkrichtung weit über den Fördergedanken hinausreicht und weite Verbreitung erfahren wird.“ Zeitschrift für ärztliche Fortbildung Inhaltsverzeichnis
TEXTBAND
Vorwort (9) Einleitung (11) 1. Zur Theorie der psychomotorischen Förderung (18) 1.1 Begriffsbildung (18) 1.2 Probleme der theoretischen Fundierung (19) 1.3 Begründung und Ausrichtung einer psychomotorischen Förderung (20) 1.3.1 Lernen durch Bewegung (21) 1.3.2 Bewegung als Weg zum Kind (24) 1.3.3 Modelle der Entwicklung der Motorik (24) 1.3.4 Dimensionen motorischer Fähigkeiten (27) 1.3.5 Ein einfaches Strukturmodell der Entwicklung der Motorik als Bezugsrahmen für Diagnostik und Förderung (29) 1.4 Das Praxiskonzept (31) 1.4.1 Psychomotorische Handlung als Interaktionssituation (31) 1.4.2 Psychomotorische Handlung als Aktivität der ganzen Person (34) 1.4.3 Förderdiagnostische Prinzipien in der Handlungspraxis(36) 1.4.4 Musik und psychomotorische Förderung (37) 1.4.5 Zielgruppen der psychomotorischen Förderung (39) 2. Begründung der Praxis aus den Ergebnissen der Forschung (41) 2.1 Empirische Untersuchungen zur Bedeutung der Motorik (41) 2.2 Motorische Entwicklungsstörungen (45) 2.3 Ist die Annahme eines Tranfers von motorischem auf kognitiv-verbales Lernen plausibel? (48) 2.3.1 Motorik und Sprache (48) 2.3.2 Zusammenhänge zwischen Intelligenz und Motorik (50) 2.4 Untersuchungen zur Effizienz psychomotorischer Förderung (51) 2.4.1 Ergebnisse von Effektivitätsstudien im Sinne “kontrollierter Praxis” in Hannover (54) 2.4.2 Schlußfolgerungen aus den Forschungsergebnissen zur Effektivität (62) 3. Weitere Modelle psychomotorischer Förderung (64) 3.1 Grundzüge perzeptuell-motorischer Programme in den USA (64) 3.1.1 DOMAN & DELACATO: Theorie der neurologischen Organisation (64) 3.1.2 Die perzeptuell-motorische Prozeßtheorie: N.S. KEPHART (65) 3.1.3 BARSCHs movigenische Theorie (67) 3.1.4 GETMAN: Das visuomotorische Modell (68) 3.1.5 Das Konzept der Bewegungserziehung von Marianne FROSTIG (68) 3.1.6 Jean AYRES: Sensorische Integration (70) 3.1.7 CRATTY: Theorie des motorischen Lernens (72) 3.1.8 Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Programmen (73) 3.2 Konzepte der psychomotorischen Erziehung und Therapie in Frankreich und der Schweiz (74) 3.3 Psychomotorische Übungsbehandlung, Motopädagogik und Mototherapie: E.J. KIPHARD (76) 3.4 Von den funktionellen Programmen zu den ADAPTED PHYSICAL ACTIVIES (77) 3.4.1 Psychomotorische Momente des Sports mit Behinderten (78) 3.4.2 Die Adapted Physical Activities Bewegung (APA) (79) 4. Integration behinderter Kinder durch Psychomotorik (83) 4.1 Grundgedanken der Integrationsdebatte (83) 4.1.1 Integration in der Schule (83) 4.1.2 Integration im Alltag (84) 4.2 Erfahrungen in England, Australien und den USA (84) 4.3 Skandinavien (85) 4.4 Thesen zum Stand der Integration in Deutschland (86) 4.5 Die Rolle von Sport, Motopädagogik und Psychomotorik für die Integration (87) 4.6 Ist nun eine spezielle Didaktik des Sports bzw. der Psychomotorik für einen integrativen Unterricht nötig? (87) 4.7 Integration durch Sport (89) 4.8 Zur Praxis des integrativen Sports (90) 4.9 Sportpädagogik und Integration in Deutschland (91) 5. Die diagnostische Phase der psychomotorischen Förderung: Motodiagnostik als Förderdiagnostik (94) 5.1 Von der normorientierten Motometrie zur Förderdiagnostik in der Motodiagnostik (94) 5.1.1 Die Messung der Bewegung (95) 5.1.2 Kritik an den motometrischen Verfahren (97) 5.1.3 Generelle Kritik an motometrischen Verfahren und Veränderung der Paradigmen für die Diagnostik (97) 5.2 Prinzipien und Ziele der Förderdiagnostik (101) 5.3 Grundlagen und Entwicklung der Diagnostischen Inventare als förderdiagnostische Methoden (102) 5.3.1 Merkmale von diagnostischen Inventaren (102) 5.4 Das Diagnostische Inventar Motorischer Basiskompetenzen (DMB) (103) 5.4.1 Entwicklung der Aufgaben des motodiagnostischen Inventars (103) 5.4.2 Untersuchungsstrategien in einer abgestuften diagnostischen Phase (104) 5.5 Das Diagnostische Inventar auditiver Alltagshandlungen (DIAS) (106) 5.6 Erfahrungen mit den diagnostischen Inventaren (108) 5.7 Ergebnisse der Arbeit mit den “Diagnostischen Inventaren” (109) 6. Die pädagogisch/therapeutische Phase: Praxis der sonderpädagogischen Förderung (111) 6.1 Handlungsprinzipien (111) 6.1.1 Theoretische Orientierung der Förderung an der allgemeinen Struktur der Entwicklung der Motorik (111) 6.1.2 Praktische Orientierung an der individuellen Entwicklung der Motorik (111) 6.1.3 Orientierung an den Prinzipien der Förderdiagnostik (112) 6.1.4 Betonung der frühen Prävention vor späterer Intervention (112) 6.1.5 Integration vor Segregation (112) 6.1.6 Betonung des aktiven und selbsttätigen Handelns des Kindes (113) 6.1.7 Orientierung am Alltag der Kinder (113) 6.1.8 Empirische Effizienzkontrolle für den gesamten Förderansatz (113) 6.1.9 Handlungskontrolle für den Pädagogen/Therapeuten (114) 6.2 Wie organisiert man psychomotorische Förderung in der Praxis? (115) 6.3 Organisationsformen der sonderpädagogischen Förderung (115) 6.3.1 Schritte der Förderung (116) 6.3.2 Basiskompetenzen (116) 6.4 Handlungsfelder (116) 6.4.1 Kindergarten und Vorschule (116) 6.4.2 Die tägliche Bewegungszeit (117) 6.4.3 Psychomotorischer Anfangsunterricht (117) 6.4.4 Ganzheitlicher Sportunterricht und fächerübergreifender Unterricht (119) 6.4.5 Sportförderunterricht (119) 6.4.6 Psychomotorische Therapie oder Mototherapie (119) 6.4.7 Die Bedeutung der Musik für die psychomotorische Förderung (119) 6.5 Psychomotorische Förderung in der praktischen Phase: eine Kombination der Elemente von Gruppen-Psychotherapie und offenem Unterricht mit Bewegung (122) 6.5.1 Waschzettel der Faktoren der Förderung (122) 6.5.2 Psychomotorik und Psychotherapie (123) 6.5.3 Elemente der Themenzentrierten Interaktion in der sonderpädagogischen Psychomotorik (124) 6.5.3.1 Regeln für das therapeutisch orientierte Vorgehen in der psychomotorischen Förderung (124) 6.5.3.2 Spezielle Elemente der Themenzentrierten Interaktion in ihrer Bedeutung für die psychomotorische Förderung (125) 6.5.4 Die Axiome der Themenzentrierten Interaktion (126) 6.5.5 Die Postulate der Themenzentrierten Interaktion (127) 6.5.6 Die neun Hilfsregeln nach COHN (128) 6.5.7 Rolle des Leiters (129) 6.5.8 Zusammenstellung der Gruppe (129) 6.5.9 Verbindung von Thema und Gruppe (130) 6.5.10 Das Problem der Veränderung des Verhaltens (131) 6.5.11 Regeln für das Therapeutenverhalten in der klientenzentrierten Spieltherapie (131) 6.5.12 Grenzen therapeutischen Handelns – Grundschuldidaktik und Psychomotorik (133) 6.6 Erfahrungen in der Ausbildung (135) 6.6.1 Das Ausbildungskonzept: Inhalte der Ausbildung im Schwerpunkt sonderpädagogische Psychomotorik (135) 6.6.2 “Reise ins Märchenland”: Märchen in der Psychomotorik (136) 6.6.3 Psychomotorische Förderung in einer Schule für Geistigbehinderte (138) 6.6.4 Weitere Beispiele für Handlungsstrategien in der Schule: Förderung sprachbehinderter Schüler (139) Literatur (142) ARBEITSBUCH Einführung (6) I Gleichgewicht (12) 1. Körpererfahrung (13) 2. Materialerfahrung (18) 3. Sozialerfahrung (23) 4. Sequenzen (28) II Kraft (31) 1. Körpererfahrung (32) 2. Materialerfahrung (37) 3. Sozialerfahrung (43) 4. Sequenzen (49) III Ausdauer (52) 1. Körpererfahrung (53) 2. Materialerfahrung (59) 3. Sozialerfahrung (65) 4. Sequenzen (71) IV Schnelligkeit (73) 1. Körpererfahrung (74) 2. Materialerfahrung (79) 3. Sozialerfahrung (85) 4. Sequenzen (93) V Gelenkigkeit (98) 1. Körpererfahrung (99) 2. Materialerfahrung (103) 3. Sozialerfahrung (106) 4. Sequenzen (110) VI Visuelle Wahrnehmung (113) 1. Farb-, Form-, und Größenunterscheidung (114) 2. Optisches Zielverfolgen (119) 3. Visuelles Gedächtnis (123) 4. Optisches Kalkulieren (127) 5. Soziale Wahrnehmung (130) 6. Sequenzen (134) VII Auditive Wahrnehmung (136) 1. Differenzierung von Schallquellen (137) 2. Differenzierung von Schalleigenschaften (142) 3. Richtung und Raumorientierung (147) 4. Rhythmisches Empfinden (152) 5. Auditives Gedächtnis (157) 6. Sequenzen (159) VIII Taktil-kinästhetische Wahnehmung (161) 1. Körpererfahrung (162) 2. Materialerfahrung (167) 3. Sozialerfahrung (172) 4. Sequenzen (178) IX Psychomotorische Materialien (181) 1. Mobiles Psychomotorikmaterial (182) 2. Konstruktives Psychomotorikmaterial (194) 3. Installierte Psychomotorik-Geräte (200) X Psychomotorische Erfahrungsräume (203) 1. Natur als psychomotorisches Erfahrungsfeld (204) 2. Wasser als psychomotorisches Erfahrungsfeld (207) 3. Psychomotorik im Klassenraum (213) XI Themen und Geschichten (214) 1. Psychomotorische Einheit "Fremder Stern” (215) 2. Psychomotorische Einheit “Gespenster” (223) 3. Psychomotorische Einheit “Reise um die Welt” (227) 4. Psychomotorische Einheit “Wetter” (232) 5. Psychomotorische Einheit “In der Großstadt” (236) Literatur (239) Anhang (240) |
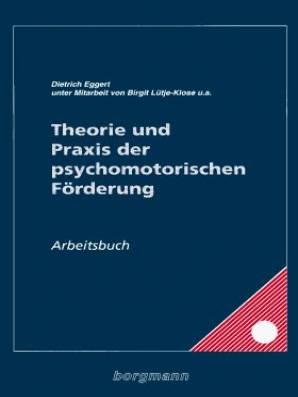
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen