|
|
|
Umschlagtext
Dieses Buch liegt jetzt in der vierten überarbeiteten und erweiterten Auflage vor. Es wurde für Lehramtsstudentinnen und Lehrerinnen geschrieben. Es ist weniger praxisnah als ein Kochbuch und weniger theoretisch orientiert als ein Nachschlagewerk. Sein Anliegen ist einfach, aber schwer zu realisieren: einen Überblick über klassische und aktuelle Themen der Pädagogischen Psychologie zu vermitteln, sie kritisch zu hinterfragen und auf ihre einigermaßen gesicherten Auswirkungen für die Schulpraxis hin zu untersuchen.
Wo immer es ohne wesentlichen Verlust an Exaktheit möglich war, wurde eine umgangssprachliche Darstellung gegenüber dem wissenschaftlichen Fachvokabular bevorzugt. Rezension
Die Pädagogische Psychologie ist nicht nur eine bedeutsame Disziplin in der Lehrerausbildung, sie ist auch in der unterrichtlichen Alltagspraxis von großer Relevanz. Dieses Buch wurde für Lehramtsstudentinnen und Lehrerinnen geschrieben: einen Überblick über klassische und aktuelle Themen der Pädagogischen Psychologie zu vermitteln, sie kritisch zu hinterfragen und auf ihre einigermaßen gesicherten Auswirkungen für die Schulpraxis hin zu untersuchen. Wo immer es ohne wesentlichen Verlust an Exaktheit möglich war, wurde eine umgangssprachliche Darstellung gegenüber dem wissenschaftlichen Fachvokabular bevorzugt. - Eng verbunden mit dieserDarstellung ist ein separat erschienenes "Arbeitsbuch", das die selbstständige Auseinandersetzung mit der Disziplin durch einschlägige Aufgaben und Quellenlektüre ermöglicht, - allerdings möglich nur in enger Verbindung mit diesem Lehrbuch des Autors: Insbesondere aber diese selbständige Erarbeitung vertieft und ergänzt das Lehrbuch-Wissen und führt gezielt zu eigenständigen, begründeten Entscheidungen hinsichtlich der Pädagogischen Psychologie.
Oliver Neumann, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Osnabrücker Schriften zur Psychologie Herausgegeben von Prof. Dr. Henning Schöttke, Prof. Dr. Manfred Tücke, Prof.Dr. Josef Rogner Mit der Reihe "Osnabrücker Schriften zur Psychologie" werden aktuelle Lehr- und Forschungsbeiträge in Form von Dissertationen, Habilitationen, Tagungsberichten und bewährten Vorlesungsskripten aus dem Fachbereich Psychologie der Universität Osnabrück veröffentlicht. Die Beiträge umfassen das gesamte Leistungsspektrum der Psychologie. Inhaltsverzeichnis
0 VORWORTE 17
1 GEGENSTAND DER PÄDAGOGISCHEN PSYCHOLOGIE 23 1.1 MERKMALE DER PSYCHOLOGIE 23 1.1.1 Beschreibungsaspekt 24 1.1.2 Erklärungsaspekt 28 1.1.3 Prognoseaspekt 30 1.1.4 Interventionsaspekt 32 1.2 MERKMALE DER PÄDAGOGIK 33 1.3 KONSEQUENZEN FÜR DIE PÄDAGOGISCHE PSYCHOLOGIE 34 1.4 DAS PÄDAGOGISCHE DREIECK 34 1.4.1 Beispiel für eine Untersuchung an Lehrern 36 1.4.2 Beispiel für eine Untersuchung an Schülern 37 1.4.3 Beispiel für eine Untersuchung zur Lehrer-Schüler-Interaktion 37 1.4.4 Beispiel für eine Untersuchung zur Präsentation des Unterrichtsstoffes 39 1.5 ALLTAGSTHEORIEN IM SCHULISCHEN KONTEXT 41 1.5.1 Was sind Alltagstheorien? 41 1.5.2 Alltagstheorien in der Schule 43 1.5.3 Alltagstheorien und Zensur engebung 45 2 METHODISCHES 49 2.1 PRINZIPIEN DER UNTERSUCHUNGSPLANUNG 49 2.1.1 Die Bedeutung des Untersuchungsplans 51 2.1.2 Festlegung von Grundgesamtheit und Stichprobe 53 2.1.3 Das Problem der Kontrollgruppe 53 2.1.4 Operationalisierungder Variablen 55 2.1.5 Variablenkontrolle 56 2.2 PROBLEME BEI DER INTERPRETATION VON UNTERSUCHUNGSERGEBNISSEN 57 2.2.7 Innere und äußere Gültigkeit 57 2.2.2 Korrelation und Kausalität 59 2.2.3 Variablenkonfundierung 60 2.2.4 Ein besonderes Problem: Pfadanalysen 61 2.2.5 Exkurs: Wie man (sich) mit Statistik täuschen kann 63 2.2.5.1 Unzulässige Vergleiche 63 2.2.5.2 Fehlerhafte Stichprobenauswahl 63 2.2.5.3 Unterschiede bei der Datenerhebung 64 2.2.5.4 Falsche Interpretation von Korrelationen 64 2.2.5.5 Vernachlässigung der Streuung 65 2.2.5.6 Mangelhafte Formulierung 65 2.2.5.7 Irreführende Darstellung 65 2.2.5.8 Technische Fehler 66 2.2.6 Einige besonders unangenehme methodische Fallen 66 2.2.6.1 DerHawthorne-Effekt 66 2.2.6.2 DerPlacebo-Effekt 67 2.2.6.3 Mangelnde situative Konstanz 68 2.2.6.4 Paradoxe Effekte pädagogischer Interventionen („unerwünschte Nebeneffekte") 68 2.2.6.5 Decken-und Bodeneffekte 69 3. EINIGE DATEN ZUM DEUTSCHEN BILDUNGSSYSTEM 71 3.1 RAHMENBEDINGUNGEN 72 3.1.1 Das deutsche Bildungssystem 72 3.1.2 Einflussstrukturen im deutschen Schulsystem 74 3.2 GRUNDDATEN ZUM SCHULBESUCH 76 3.2.7 Angaben zu verschiedenen Schulformen 76 3.2.2 Entwicklung der Lehrer-Schüler-Relationen 78 3.2.3 Die Orientierungsstufe 80 3.2.4 Unterschiede beim Schulbesuch in verschiedenen Bundesländern 81 3.3 EINZELPROBLEME 82 3.3.7 Lehrergeschlecht 82 3.3.2 Altersentwicklung der Lehrer 83 3.3.3 Teilzeitbeschäftigung von Lehrern 83 3.3.4 Vorzeitige und verspätete Einschulung 85 3.3.5 Nichtversetzung86 3.3.6 Ausländische Schüler 88 3.3.7 Gymnasium und Abitur 90 3.4 SCHULE UND ELTERNHAUS 92 3.5 ZUR LEISTUNGSFÄHIGKEIT DES DEUTSCHEN BILDUNGSSYSTEMS IM INTERNATIONALEN VERGLEICH 97 3.5.7 Die TIMSS-Studien 101 3.5.2 Die PISA-Studien 104 3.5.2.1 Ergebnisse aus PISA 2000 105 3.5.2.1.1 Schülerleistungen im internationalen Vergleich : Lesekompetenz 105 3.5.2.1.2 Schülerleistungen im internationalen Vergleich : Mathematische Kompetenz 107 3.5.2.1.3 Schülerleistungen im internationalen Vergleich : Naturwissenschaftliche Kompetenz 108 3.5.2.1.4 Schülerleistungen in den einzelnen Bundesländern: Lesekompetenz 111 3.5.2. l .5 Schülerleistungen in den einzelnen Bundesländern: Mathematische Kompetenz 112 3.5.2.1.6 Schülerleistungen in den einzelnen Bundesländern: Naturwissenschaftliche Kompetenz 113 3.5.2.2 Ergebnisse aus PISA 2003 114 3.5.2.2.1 Lesekompetenz 114 3.5.2.2.2 Mathematische Kompetenz 115 3.5.2.2.3 Naturwissenschaftliche Kompetenz 116 3.5.2.2.4 Fächerübergreifende Problemlösekompetenz 117 3.5.2.2.5 Zur Bedeutung von Computern in der Schule 119 3.5.2.2.6 Geschlechterunterschiede 120 3.5.3 Die IGLU-Studie 120 3.5.3.1 Lesekompetenz 121 3.5.3.2 Mathematische Kompetenz 122 3.5.3.3 Naturwissenschaftliche Kompetenz 123 3.5.3.4 Vergleich ausgewählter Bundesländer 124 3.5.4 Ein besonderes Problem: die Schulform der integrierten Gesamtschule 125 4 EINSCHULUNG UND SCHULFÄHIGKEIT 129 4.1 EINFÜHRUNG 129 4.2 BEGINN DER SCHULPFLICHTl 32 4.3 DASEINSCHULUNGSVERFAHREN 135 4.3.1 Die körperliche Schulfähigkeit 137 4.3.2 Die geistige Schulfähigkeit 139 4.3.3 Die soziale Schulfähigkeit 140 4.4 RELATIONALE DEFINITION DER SCHULFÄHIGKEIT 140 4.5 DIE KONTROVERSE UM EINSCHULUNGSTESTS („SCHULREIFETESTS") 143 4.5.1 Ein Beispiel: die Weilburger Testaufgabenfür Schulanfänger 143 4.5.2 Zur Vorhersagegenauigkeit des Schulerfolgs durch Einschulungstests 144 4.6 WAS TUN MIT NICHT SCHULFÄHIGEN KINDERN? 148 4.6.1 Erste Möglichkeit: Zurückstellung vom Schulbesuch 148 4.6.2 Eine Alternative: Besuch vorschulischer Einrichtungen 150 4.7 ZUR EINSCHULUNG BEHINDERTER KINDER 152 5 PROBLEMLÖSEN UND BEGRIFFSBILDUNG 157 5.1 PROBLEME UND PROBLEMLÖSEN 157 5.2 ZUM ZUSAMMENHANG ZWISCHEN INTELLIGENZ UND PROBLEMLÖSEN 164 5.3 PROBLEMLÖSESTRATEGIEN UND -HEMMNISSE 165 5.3.1 Problemlösestrategien 165 5.3.1.1 Allgemeine Prob lemlösestrategien 166 5.3.1.1.1 Verbalisierung 166 5.3.1.1.2 Der IDEAL-Problemlöser 167 5.3.1.2 Spezielle Problemlösestrategien 169 5.3.1.2.1 Problcmbearbeitung durch systematische Variation 170 5.3.1.2.2 Anregung von unten („Materialanalyse") 170 5.3.1.2.3 Anregung von oben („Zielanalyse") 171 5.3.1.2.4 Lösungsstammbäume 172 5.3.1.2.5 Analogiebildung 173 5.3.1.2.6 Automatisierung 173 5.3.2. Problemlösehemmnisse 174 5.3.2.1 Funktionale Gebundenheit 174 5.3.2.2 Situative Gebundenheit 175 5.3.2.3 Rigidität176 5.4 BEGRIFFE UND BEGRIFFSBILDUNG 178 5.4.1 Was sind Begriffe? 178 5.4.1.1 Scharf definierte Begriffe: Kategorien gemeinsamer Merkmale 180 5.4.1.2 Schwach definierte Begriffe: Prototypen 180 5.4.2 Begriffsbildung 181 5.5 FÖRDERUNG VON BEGRIFFSBILDUNGEN UND PROBLEMLÖSUNGEN IM UNTERRICHT 183 5.5.7 Grundregeln für die effektive Vermittlung von Problemlösekompetenz 184 5.5.2 Einige Hinweise zur Erleichterung der Begriffsbildung 185 5.5.3 Integrierte Programme zur kognitiven Erziehung186 5.5.3.1 Das Productive Thinking Program 187 5.5.3.2 Das Instrumental Enrichment Program 187 5.5.3.3 Die ACT*-Strategie188 6 INTELLIGENZ UND INTELLIGENZMESSUNG 191 6.1 INTELLIGENZ IM ALLTAG 192 6.1.1 Intelligenz zeigt sich bei der Bewältigung alltäglicher Probleme 193 6.1.2 Intelligenz hat viele Aspekte 194 6.1.3 Intelligenz ist kulturabhängig 194 6.2 WAS VERSTEHT DIE PSYCHOLOGIE UNTER INTELLIGENZ? 195 6.2.1 Einige Intelligenzdefmitionen 195 6.2.2 Einige Intelligenztheorien 199 6.2.2.1 Die Theorie der multiplen Intelligenzen von Gardner 199 6.2.2.2 Die Theorie der triarchischen Intelligenz von Sternberg 201 6.2.2.3 Die Theorie der geistigen Primärfähigkeiten nach Thurstone 202 6.2.2.4 Die Theorie von Wechsler 203 6.2.2.5 Die Theorie der Allgemeinintelligenz nach Spearman 203 6.2.2.6 Die Überlegungen von Alfred Binet 204 6.3 EIN IN DEUTSCHLAND SEHR GEBRÄUCHLICHER INTELLIGENZTEST: DER HAWIK-III 206 6.3.7 Die Zusatztests des HAWIK-III209 6.3.2 Die Intelligenzindikatoren des HAWIK-III210 6.4 TESTGÜTEKRITERIEN 211 6.4.1 Objektivität 211 6.4.2 Zuverlässigkeit (Reliabilität) 212 6.4.3 Gültigkeit (Validität) 213 6.5 WAS MESSEN INTELLIGENZTESTS UND WO LIEGEN IHRE GRENZEN? 214 6.6 BEWÄHRUNG VON INTELLIGENZTESTS BEI DER VORHERSAGE DES SCHUL- BZW. BERUFSERFOLGS 216 6.7 GESETZLICHEGRUNDLAGEN FÜR DIETKSTANWENDUNG IN DER SCHULE 218 6.8 ElNZELFRAGEN ZUR INTELLIGENZ 219 6.8.1 Die Kontroverse um die Erblichkeit der Intelligenz 219 6.8.2. Zur Kontroverse um Intelligenzförderungsprogramme 220 6.8.3 Der Flynn-Effekt 222 6.9 KREATIVITÄT-EIN SCHWER FASSBARES KONSTRUKT 224 7 HOCHBEGABTE KINDER 227 7.1 ALLTAGSVORSTELLUNGEN ÜBER HOCHBEGABTE KINDER 228 7.2 HOCHBEGABUNG UND PSYCHISCHE PROBLEME: HISTORISCHE VORURTEILE UND NEUERE ERGEBNISSE 231 7.3 MODELLE DER HOCHBEGABUNG 232 7.4 IDENTIFIKATION VON HOCHBEGABTEN 236 7.4.1 Checklisten-236 7.4.2 Intelligenztests 238 7.4.3 Das Lehrerurteil bei der Identifikation hochbegabter Kinder 240 7.5 FRÜHERKENNUNG UND FRÜHFÖRDERUNG HOCHBEGABTER KINDER 242 7.6 HOCHBEGABTE KINDER IN DER SCHULE 244 7.6.7 Sonderklassen für Hochbegabte? 244 7.6.2 Weitere mögliche Fördermaßnahmen innerhalb der Schule 245 7.6.2.1 Vorzeitige Einschulung 246 7.6.2.2 Klassen überspringen 246 7.6.2.3 Sonstige unterrichtliche Maßnahmen 247 7.6.3 Außerunterrichtliche Fördermaßnahmen 248 7.7 HOCHBEGABTE MÄDCHEN 249 8 SPEZIFISCHE LERNSCHWIERIGKEITEN AM BEISPIEL DER LESE-RECHTSCHREIB-SCHWÄCHE (LRS) 255 8.1 WAS SIND „SCHLECHTE SCHULLEISTUNGEN"? 256 8.2 BEZUGSNORMEN FÜR SCHÜLERLEISTUNGEN 258 8.2.1 Die soziale Bezugsnorm 259 8.2.2 Die individuelle Bezugsnorm 260 8.2.3 Die sachliche Bezugsnorm 261 8.3 WIE ERKLÄREN LEHRER SCHLECHTE SCHULLEISTUNGEN? 262 8.4 SCHLECHTE SCHULLEISTUNGEN UND „BEGABUNG" 263 8.5 „ERWARTUNGSWIDRIGE SCHULLEISTUNGEN" 264 8.6 VOM UMGANG MIT SCHWACHEN SCHULLEISTUNGEN 266 8.7 EIN BEISPIEL: DIELESE-RECHTSCHREIB-SCHWÄCHE(LRS) 269 8.7.1 „Legasthenie" und Lese-Rechtschreib-Schwäche 269 8.7.2 Mögliche Ursachen einer Lese-Rechtschreib-Schwäche 270 8.7.2.1 Aufmerksamkeitsfaktoren 271 8.7.2.2 Ausnutzung der Intra-Wort-Redundanz 272 8.7.2.3 Segmcntierungsprobleme272 8.7.2.4 Phonematische Bewusstheit 273 8.7.2.5 Übermäßiger Einsatz von Bildern in Lesebüchern 271 9. GENERELLE LERNSTÖRUNGEN I: MANGELNDE MITARBEIT IM UNTERRICHT UND AUFMERKSAMKEITSSTÖRUNGEN 277 9.1 ZUR BEDEUTUNG MANGELNDER SCHÜLERMITARBEIT IM UNTERRICHT 277 9.2 WEITERE MÖGLICHE URSACHEN FÜR MANGELNDE MITARBEIT IM UNTERRICHT 280 9.2.1 Nicht erkannte Hochbegabung 280 9.2.2 Aufmerksamkeitsstörungen 281 9.2.2.1 Symptome und diagnostische Kriterien 283 9.2.2.2 ADHS-Kinder in der Schule 286 9.2.2.3 Was können Lehrer und Eltern für ADHS-Kinder tun? 287 9.2.2.4 Professionelle Hilfe bei ADHS 288 9.2.5 Ausländische Schüler 289 9.2.4 Sitzordnung 291 9.2.5 Beispiele für weitere Bedingungen mangelnder Mitarbeit im Unterricht 292 9.3 EXEMPLARISCHE INTERVENTIONSMÖGLICHKEITEN BEI AUFMERKSAMKEITSSTÖRUNGEN 294 10. GENERELLE LERNSTÖRUNGEN II: SCHULANGST 301 10.1 WAS VERSTEHT DIE PSYCHOLOGIE UNTER ANGST? 303 10.2 ANGSTSYMPTOME 305 10.3 FORMALISIERTE DIAGNOSTIK VON SCHULANGST: DER ANGSTFRAGEBOGEN FÜR SCHÜLER (AFS) 308 10.4 ANGST IN DER SCHULE 309 10.5 SOZIALE ÄNGSTE IN DER SCHULE 311 10.6 ANGST UND LEISTUNG 313 70.6.7 Die Yerkes-Dodson-Regel 314 10.6.2 Angst und subjektives Wohlbefinden 316 10.7 SCHULISCHE FOLGEN VON LEISTUNGSANGST 317 10.7.1 Beeinträchtigung von Lernprozessen bei komplexen Problemlösungen 317 10.7.2 Mangelnde Konzentrationsfähigkeit 318 10.7.3 Beeinträchtigung des Gedächtnisses 318 10.7.4 Beeinträchtigung positiver Bewältigungen, insbesondere nach Misserfolgen 319 10.7.5 Beeinträchtigung des Selbstkonzepts 320 10.8 SCHULISCHE INTERVENTIONS- UND PRÄVENTIONSMÖGLICHKEITEN 320 10.8.1 Schaffung einer vertraulichen Klassenatmosphäre 321 10.8.2 Vorsichtiger Einsatz von Leistungsvergleichen zwischen Schülern 323 10.8.3 Klarer und durchschaubarer Unterrichtsablauf 324 10.8.4 Kein vermeidbarer Zeitdruck, kein unnötiger Druck 325 10.8.5 Ankündigung von wichtigen bevorstehenden Ereignissen 327 10.8.6 Erlaubnis zur Benutzung sinnvoller Hilfsmittel 328 10.8.7 Kontinuierliche Rückmeldung 329 10.8.8 Reduzierung von Angst durch Erhöhung der Kompetenz 330 11. PÄDAGOGISCH-PSYCHOLOGISCHE DIAGNOSTIK UND INTERVENTION 335 11.1 ALLTÄGLICHES DIAGNOSTIZIEREN IN DER SCHULE 335 11.2 DER ROSENTHAL-EFFEKT ("PYGMALION-EFFEKT") 338 11.3 VON DER BEOBACHTUNG ZUR INTERVENTION 341 11.4 EIN GUTES BEISPIEL FÜR DIE DIAGNOSTISCHE ABKLÄRUNG UND MODIFIKATION EINES PROBLEMVERHALTENS 347 11.4.1 Der Fall Steffen 348 11.4.2 Schritte zur Modifikation des Problemverhaltens 348 11.5 DIAGNOSTISCHE HILFSMITTEL 351 11.5.1 Methoden der Verhaltensbeobachtung 351 11.5.2 Diagnostische Gesprächs- und Befragungsmethoden 352 11.6 PÄDAGOGISCH-PSYCHOLOGISCHE DIAGNOSTIK UND DIE LÖSUNG VON LEHRER-SCHÜLER-KONFLIKTEN 354 11.6.1 Nicht alltägliche Problemsituationen 354 11.6.2 Ein Beispiel 355 11.6.3 Der Prozess der Diagnose 356 11.6.4 Interventionen 357 11.6.5 Erfolgskontrolle 358 11.7 ZUR (UN-) ZUVERLÄSSIGKEIT DER BEURTEILUNG VON SCHÜLERLEISTUNGEN 358 11.7.1 Funktionen der Schülerbeurteilung durch Noten 359 11.7.2 Zur „Objektivität" von Schulnoten360 11.7.3 Sonstige Einflüsse auf die Schulnote362 11.7.3.1 Beliebtheit der Schüler 362 11.7.3.2 Ängstlichkeit 362 11.7.3.3 Schulfach362 11.7.4 Das ,,Klasseninterne Bezugssystem" 363 11.7.5 Ergänzende Verfahren zur Beurteilung von Schülerleistungen 365 12 EFFEKTIVER UNTERRICHT UND LERNMOTIVATION 369 12.1 BEDINGUNGEN EFFEKTIVEN UNTERRICHTENS 369 12.1.1 Experten und Berufsanfänger 369 12.1.1.1 Unterschiede im Einsatz motivationaler Unterrichtsstrategien 370 12.1.1.2 Unterschiede bei der Analyse und Bewertung von Schülerverhalten 371 12.1.1.3 Unterschiede bezüglich professioneller Kenntnisse und Fähigkeiten 373 12.1.1..4 Unterschiede bei der Unterrichtsplanung 374 12.1.2 Lernziele als Hilfe bei der Unterrichtsplanung 374 12.1.3 Was zeichnet effektive Lehrer aus? 377 12.1.4 Beispiele für effektive Unterrichtsplanung 378 12.1.4.1 Ein lern- und gedächtnispsychologisch fundierter Entwurf nach Gagne (1973) 379 12.1.4.2 Beispiel für einen an der Organisation des Lernstoffs orientierten Unterrichtsentwurf 380 12.2 EFFEKTIVER UNTERRICHT UND SCHÜLERMOTIVATION 381 12.2.1 Effektiver Unterricht aus der Lehrerperspektive: das QAIT-Modell von Slavin 382 12.2.2 Effektiver Unterricht aus der Schülerperspektive: das Modell der Handlungsveranlassung von Heckhausen & Rheinberg 383 12.3 WIE KANN MAN SCHÜLER IM UNTERRICHT MOTIVIEREN? 384 12.3.1 Intrinsische und extrinsische Motivation 384 12.3.2 Motivierung durch Lob und Tadel 387 12.3.3 Motivierung durch Änderung der Attributionsmuster 390 12.3.4 Motivierung durch angepasste Aufgabenschwierigkeit 391 12.4 EIN PROBLEM: GERINGE ANSTRENGUNGSBEREITSCHAFT 392 12.4.1 Erlernte Hilflosigkeit 392 12.4.2 Zum Einfluss der Selbstbewertung („Self Efficacy") 396 12.4.3 Anstrengungsvermeidung 397 13 UNTERRICHTSSTÖRUNGEN UND DISZIPLINPROBLEME 401 13.1 ZUR EINFÜHRUNG: EINIGE ZITATE UND ZAHLEN 403 13.1.1 Einige Zitate 403 13.1.2 Einige Zahlen 404 13.1.2.1 Unterrichtsstörungen aus der Lehrerperspektive 404 13.1.2.2 Unterrichtsstörungen aus der Schülerperspektive 406 13.2 WELCHE UNTERRICHTSSTÖRUNGEN WERDEN VON LEHRERN UND SCHÜLERN ALS BESONDERS UNANGENEHM EMPFUNDEN? 408 13.2.1 Lehrerperspektive 408 13.2.2 Schülerperspektive 409 13.3 WIE HÄNGEN LEHRER- UND SCHÜLERVERHALTEN ZUSAMMEN UND WELCHE AUSWIRKUNGEN ZEIGEN SICH BEZÜGLICH DER UNTERRICHTSSTÖRUNGEN? 411 13.4 EINIGE INTERVENTIONSMÖGLICHKEITEN BEI UNTERRICHTSSTÖRUNGEN 414 13.4.1 Grundprinzipien der Verhaltensmodifikation 416 13.4.2 Schülerbezogene Interventionsmöglichkeiten-verhaltensorientiert 418 13.4.2.1 Reduzierung unerwünschten Verhaltens 419 13.4.2.1.1 Löschung (Extinktion) 419 13.4.2.1.2 Bestrafung 420 13.4.2.1.3 Negative Verstärkung 423 13.4.2.1.4 Sättigung 423 13.4.2.1.5 Anlegen eines Strafkontos 424 13.4.2.1.6 Soziale Isolierung 425 13.4.2.1.7 Reizkontrolle 427 13.4.2.2 Aufbau von erwünschtem Verhalten 427 13.4.2.2.1 Verstärkung durch Aufmerksamkeitszuwendung oder Lob 427 13.4.2.2.2 Verhaltensformung und sukzessives Ausblenden von Hilfen 428 13.4.2.2.3 Einige verbreitete Techniken der Verhaltensmodifikation 430 13.4.2.2.4 Verhaltensmodellierung 432 13.4.3 Argumente gegen verhaltensorientierte Interventionen in der Schule 432 13.4.4 Schülerbezogene Interventionsmöglichkeiten - kognitiv orientiert 433 13.4.5 Lehrerbezogene Interventionsmöglichkeiten 436 13.4.6 Institutionelle Rahmenhcdingungen für einen störungsarmen Unterricht 439 14 GEWALT IN DER SCHULE 445 14.1 EINIGE UNTERSUCHUNGEN ZUR VERBREITUNG UND ERSCHEINUNGSFORMEN VON GEWALT IN DER SCHULE 447 14.1.1 Die skandinavischen Untersuchungen von Olweus (1995) 447 14.1.2 Gewalt und Aggression aus der Schülerperspektive: Die Berliner Untersuchung von Dettenborn & Lautsch (1993) 451 14.1.3 Gewalt und Aggression an Schulen in Schleswig-Holstein: Die Untersuchung von Hanewinkel, Niebel & Ferstl (1995) 452 14.1.3.1 Entwicklung schulischer Gewalt im Urteil der Schulleiter 453 14.1.3.2 Ausmaß von Gewalt in verschiedenen Schultypen 453 14.2 EINIGE INTERVENTIONSMÖGLICHKEITEN BEI GEWALT IN DER SCHULE 455 14.2.1 Wann ist eine Intervention notwendig? 455 14.2.2 Allgemeine Präventions- und Interventionsmaßnahmen459 14.2.3 Ausgewählte spezielle Präventions- und Interventionsprogramme 462 15 SOZIALE PROZESSE IN DER SCHULKLASSE 467 15.1 EINLEITUNG: ZWEI KLASSISCHE BEISPIELE FÜR SOZIALE EINFLÜSSE AUF UNSER VERHALTEN 469 15.2 DIE SCHULKLASSE ALS GRUPPE 471 15.2.1 Soziale Funktionen und Einflüsse der Schulklasse 472 15.2.2 Cliquen und ihre Bedeutung in der Schule 474 15.2.3 Die Untersuchung von Cliquen und das Soziogramm 475 15.3 SOZIALE UNGLEICHHEIT, SOZIALE ROLLEN UND SOZIALER STATUS: UNGLEICHHEIT UND ARBEITSTEILUNG IN DER GRUPPE 479 75.3.7 Soziale Gleichheit und Ungleichheit von Gruppenmitgliedern 480 15.3.2 Soziale Rollen und sozialer Status 481 15.3.3 Gruppenanführer 483 15.4 DIE ARBEIT IN DER GRUPPE: WANN ARBEITET EINE GRUPPE EFFEKTIV? 485 75.4. l Leistungsvorteile in der Gruppe und was man dafür tun kann 485 15.4.2 Leistungsnachteile in der Gruppe und was man dagegen tun kann 487 15.5 ETHNISCHE UND GESCHLECHTSSPEZIFISCHE VORURTEILE UND STEREOTYPE 490 75.5.7 Was sind Stereotype? 490 15.5.2 Kulturelle Stereotype im Unterricht 492 15.5.3 Geschlechterunterschiede im Unterricht 497 16 WICHTIGE INFORMATIONSQUELLEN FÜR LEHRER 501 16.1 ELEKTRONISCHE DATENBANKEN 502 16.2 INFORMATIONEN FÜR LEHRER IM INTERNET 505 17 LITERATUR 509 18 INDEX 531 Weitere Titel aus der Reihe Osnabrücker Schriften zur Psychologie |
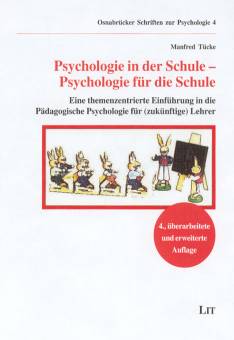
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen